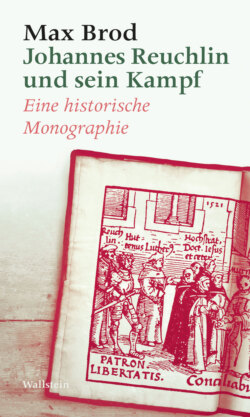Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ZWEITES KAPITEL
Der junge Reuchlin 1
ОглавлениеHutten gehörte als eine der letzten großen Gestalten dem absinkenden Stande der Reichsritterschaft an, die nach kurzer Blütezeit infolge wirtschaftlicher Umwälzungen (Frühkapitalismus) und ›Vervollkommnung‹ der Mordwerkzeuge (Feuerwaffen) wieder in Degeneration begriffen war, wie etwa zwei Jahrhunderte vorher, zur Zeit Rudolfs von Habsburg, da sie zur Raubritterschaft entartet erschien. »Reiten und Rauben ist keine Schande, – das tun die Besten im Lande«. Ehe dieser Spottvers sich ernstlich durchsetzte, hatte es unter der Ritterschaft die höchsten Gestalten der deutschen Dichtkunst gegeben, Wolfram von Eschenbach, Heinrich von Morungen, Walther und die andern. Der Ritter von Hutten ist ihr später, politisierter, aber immer noch sprachgewaltiger Nachfahr. Neben dem niedergehenden Rittertum, das noch einmal in Franz von Sickingen einen Mann der Tat und zugleich des kühlen politischen Planens, einen Berserker mit Weitblick (seltener Fall!) hervorbrachte, steigen aber die andern Stände empor, immer entschiedener das bürokratische Territorialfürstentum, dem die Zukunft gehörte, – die Bauernschaft, die dann in großem, schlecht organisiertem, sei es auch elementar berechtigtem Aufruhr zusammenbrach, – die freien Reichsstädte und großen Provinzialhauptorte, die dem kulturellen Fortschritt durch alle konservativen Hemmungen ihres Eigenlebens hindurch immer wieder zum Durchbruch verhalfen: so die Hansestädte des Nordens; Köln, das man ›das Rom Deutschlands‹ nannte; die reiche Feste der Fugger: Augsburg; das kunstreiche Nürnberg; Erfurt mit seiner bedeutenden eigenständigen Universität; Straßburg, die Stadt des ›Narragonien‹-Fahrers Sebastian Brant, und Basel, das ›goldene Tor der Schweiz‹, Stadt des Reformkonzils und der humanistischen Buchdruckereien.
Pforzheim ist in der Perlenschnur dieser Städte des deutschen Südwestens eine der weniger bedeutenden (3 000–4 000 Einwohner!), aber eine der schönsten Perlen. Von allen Punkten der Stadt aus fliegt der Blick zu den Vorhöhen des Schwarzwaldes. Drei Flüsse (Enz, Nagold und Würm) durchströmen die Ebene, vereinen die Ebene, vereinen sich im Gebiet der Stadt. Sie gehörte zum alten Bestand der Markgrafschaft Baden, und über 150 Jahre lang war sie Residenz der Markgrafen. Sie war also nicht reichsunmittelbar. Es gibt eine zwischen 1190 und 1197 ausgestellte Urkunde, in der Pforzheim noch ›villa‹ genannt wird, das ist, wie ich dem grundgelehrten und reich dokumentierten Buch von J. G. F. Pflüger ›Geschichte der Stadt Pforzheim‹ entnehme, nicht mit ›Weiler‹ zu übersetzen, sondern mit Dorf oder Flecken; in unserem Falle mit Marktflecken, da die Urkunden bereits einen Markt erwähnen. Die Hauptmerkmale der mittelalterlichen Städte, Mauern und Gräben, besaß Pforzheim damals noch nicht. Wohl aber zu Reuchlins Zeit, 300 Jahre später. Der schöne Stich von Merian, noch über 150 Jahre später, zeigt außer vielen Kirchtürmen auch Stadttürme, Bastionen, Festungsanlagen. Erich Rummel hat in der Festschrift von 1955 auf eine weit frühere handgezeichnete Darstellung der Stadt (von Gadner) aufmerksam gemacht, die die »einstige strategische Wichtigkeit« Pforzheims verdeutlicht.
Der Name der ursprünglich römischen Siedlung weist auf ›porta‹ (das Tor zum Schwarzwald) oder ›portus‹ (Hafen, Halteort der Flöße). Die letztere Ableitung dürfte die richtige sein, sie wird durch die Benennung auf einem Meilenstein aus der Römerzeit bekräftigt. – Nach den Sturzfluten der Völkerwanderung wurde Pforzheim erst alemannisch, dann fränkisch, wechselte mehrmals den Herrn (den Gaugrafen), wurde geteilt und wiedervereinigt, kam dann an die hohenstaufischen Schwabenherzoge, die dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation einige der mächtigsten und kulturell bedeutsamsten Kaiser gaben. Ein Pfalzgraf bei Rhein erwarb durch Heirat mit einer Staufentochter den Besitz der Stadt, auf demselben Wege (als Mitgift) ging die Stadt an einen Marchio de Badin, einen badischen Markgrafen, über und blieb dann viele Jahrhunderte lang diesem Regentengeschlecht untertan. Man sieht: der Satz »Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube« (»Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, heirate«) gilt nicht nur für Österreich und Kaiser Maximilian I.; auch andere Herrschaftsmächte haben diese Art von Bereicherung gern praktiziert. Leider nie wörtlich, nie alternativ. Sie haben nämlich alle sowohl geheiratet als Kriege geführt. Gegen das Heiraten ist ja öfters gar nichts einzuwenden, Krieg aber ist immer der äußerste Frevel, dessen die Menschheit fähig ist, die eigentliche, nicht mit dem fiktiven Dogma zu verwechselnde Ursünde und Erbsünde, die Selbstzerstörung kat’ exochen. –
»Der Menschheit blutgedüngtes Saatenfeld
Hab ich durchwandert mit entsetzen Augen …«
Diese und andere Bereicherungsmethoden auf dem besagten Feld der Menschheit bestimmen den Stand der Dinge zur Zeit der Geburt eines Friedliebenden, – Reuchlins (am 28. Dezember 1455). Erst nach dem zweiten Weltkrieg wurde Baden, nicht ohne historisch und politisch untermauerten Widerstand, mit Württemberg vereinigt.
Kommt man heute in die schöne, gewerbefleißige, bijouterietrunkene Stadt, so findet man von wirklichen Spuren ihres berühmtesten Bürgers fast nichts vor. Doch wie wenig oder wie viel bedeutet ›Wirklichkeit‹! Jedenfalls gibt es ein höchst modernes Reuchlinhaus (Volksbibliothek, Sammlungen, Vortragssäle), ein Reuchlingymnasium, ein Reuchlinmuseum. Aber das sind Schöpfungen einer Spätzeit, eines Heute. Pietätvoll, wirksam. Wie auch die beiden inhaltsreichen Festschriften zu Reuchlins 400. Todestag (1922) und 500. Geburtstag (1955), die seine Geburtsstadt mit sachlich hochbedeutenden Beiträgen zeitgenössischer Gelehrter herausgegeben hat, eine wesentliche Bereicherung der Reuchlin-Literatur darstellen. (Ich zitiere sie im folgenden häufig, mit den Chiffren F. 1 und F. 2). Nur geradezu historische Erinnerungen der ›Wirklichkeit‹ sind sie natürlich nicht.
Den zweiten Weltkrieg hätte Pforzheim recht gut überstanden, – da brach gegen das Ende der Schicksalszeit, die bisher an der Stadt ohne spektakulären Eingriff vorbeigegangen war, ein totales Bombardement über die Gassen herein. Binnen zweiundzwanzig Nacht-Minuten kamen 17 000 Menschen um. Fast alle Gebäude, auch fast alle Altertümer, gingen in Flammen auf. Über die Gründe dieser Maßregel der Alliierten gibt es natürlich nur Vermutungen. So hörte ich, daß die verbündeten Westarmeen bei ihrem Vorrücken in Straßburg Pläne des deutschen Oberkommandos aufgefunden hatten, deren Mitnahme in der Hast des Rückzuges vergessen worden war. Aus diesen Plänen ging, so sagt man, hervor, daß in einigen Pforzheimer Werkstätten, die auf Feinmechanik spezialisiert waren, gewisse sehr kunstreiche Bestandteile hergestellt wurden, deren Bestimmung den Bürgern Pforzheims unbekannt war. Sie dienten den Fernraketen V 2, die von Peenemünde aus in London furchtbare Zerstörungen anrichteten. Ganze Wagenladungen solcher Bestandteile sollen von Pforzheim regelmäßig an die Ostsee abgegangen sein. Kurzerhand beschlossen die Alliierten, die Stadt Pforzheim ›auszuradieren‹, was denn auch approximativ geschehen ist. Der Satan des Krieges, wenn er einmal losgelassen ist, schlägt eben nach allen, auch den am wenigsten vorherzusehenden Seiten rasend um sich. »Der Menschheit blutgedüngtes Saatenfeld …«
Die wichtigsten Kulturdenkmäler und historischen Gebäude der Stadt wurden nach der Katastrophe von 1945 restauriert, so die Schloß- und Stiftskirche St. Michael, der Chor der Barfüßerkirche (Franziskaner) u. a., darunter auch einiges, was auf die Reuchlinzeit zurückweist. Wie überhaupt der Stadtrat unter dem tatkräftigen Oberbürgermeister Dr. Johann Peter Brandenburg alles tat, um auch das Andenken an Reuchlin neu zu beleben, ja zu steigern. – Die Reuchlin-Kammer im Obergeschoß der Sakristei der Schloßkirche zu St. Michael war allerdings nicht mehr zu retten. Hier soll Reuchlin, der ja nach Absolvierung der Pforzheimer Lateinschule nur besuchsweise in die Heimatstadt kam, Vorlesungen gehalten haben. Sein Katheder und Bücherschrank wurden noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts gezeigt, wie ein Chronist berichtet. Seine Bibliothek, die er laut Melanchthons Gedächtnisrede testamentarisch zur Aufbewahrung im St. Michaelsstift und zu freiem öffentlichen Gebrauch, jedoch nicht zum Verleihen bestimmt hatte, wurde von den Markgrafen bei Verlegung der Residenz nach Durlach, später nach Karlsruhe gebracht. (Hermann Wahl ›Reuchlinstätten in Pforzheim‹.) Ein Verzeichnis der Bücher und Handschriften dieser Bibliothek hat 1913 K. Christ in einem Heidelberger Sammelband der Vatikanischen Bibliothek entdeckt und bibliographisch durchleuchtet. Karl Preisendanz hat in der Festschrift 1955 (vorher schon skizzenhaft W. Brambach in F. 1) eine sehr gründliche Analyse dessen veröffentlicht, was wir von Reuchlins Bibliothek haben und über sie wissen. F. 2 bringt das Verzeichnis der hebräischen und griechischen Bestände. Die Bibliothek hat Reuchlin in den späten Kriegs-, Schatten- und Fluchttagen seines Lebens als »Hälfte seiner Seele« bezeichnet. Nur weniges davon ist übriggeblieben, so daß das Verzeichnis unschätzbar bleibt; denn aus diesem Verzeichnis kann manches in seinen Schriften, da wir die Quelle seines Wissens erfahren, richtig verstanden werden; vor allem aus dem allerdings nur in flüchtigen Andeutungen erhaltenen Verzeichnis seiner hebräischen Schätze. – W. Brambach, S. Baer und S. Landauer haben einen Handschriftenkatalog der einst im Besitz Reuchlins befindlichen, jetzt verstreuten Codices herausgegeben, über den Preisendanz schreibt: »Immer … wird man auch beim Blick in das nur wenige Seiten fassende Heft beklagen, daß von Reuchlins einst stattlicher Sammlung lateinischer, griechischer und hebräischer Handschriften und Drucke nur eine so geringe Zahl erhalten bleiben durfte; sie kann heute nur mehr als sichtbares Symbol der Bücherliebe ihres rastlos schaffenden Besitzers gelten, der in schwerer Zeit lieber sterben als den Untergang seiner Bibliothek erleben wollte.«
Der letzte Wille Reuchlins ist nicht wörtlich überliefert. Nur dem Umstand, daß er nicht befolgt wurde, ist es zu verdanken, daß wenigstens ein kleiner Überrest der Bücher und Handschriften auf uns gekommen ist.
Dagegen brachte die verheerende Unglücksnacht paradoxerweise – allerdings nur vorübergehend – Reste eines Gebäudes zum Vorschein, die einst vielleicht zum Wohnhaus der Eltern Reuchlins gehört haben. Reuchlins Vater Georg war weltlicher ziviler Administrator, Stiftsverwalter oder Schaffner jenes geistlichen Ordens, der in unlöslicher, lebenslanger Verstrickung mit dem Schicksal des großen Sohnes stand und auch noch heute – wie später dargelegt werden soll – in eine gewisse lokale Berührung mit seinem Gedächtnis, sei es auch anscheinend nur zufallsmäßig, eingetreten ist. Ich meine hier den Dominikanerorden (auch Praedikantenorden, Predigerorden genannt). »Von Reuchlins Geburtshaus wissen wir nur«, so berichtet Hermann Wahl, »daß es im Bereiche des Dominikaner-Klosters, also auf dem Schulplatz oder in dessen näherer Umgebung zu suchen ist … 1294 wird das Predigerkloster erstmals genannt … Zwar umzog eine Mauer den Klosterbezirk, doch lag es in der Natur des Bettelordens, daß er nicht streng von den umgebenden Bürgerhäusern abgeschlossen war. Die Wohnungen der Laienbediensteten und der Wirtschaftsgebäude können wohl außerhalb der Mauern gelegen haben. Die Zerstörung des Stadtkernes 1945 legte an der Südseite der Reuchlinstraße eine turmartige Ruine frei, die vorher ganz in die schmalen, aber tiefen Häuser des 18. und 19. Jahrhunderts eingebaut war. Das Gebäude ließ zwei übereinanderliegende Kellergewölbe, ein Erdgeschoß und zwei Obergeschosse mit gotischen Fenstern erkennen. Die Stilmerkmale rechtfertigen die Annahme, daß der Bau etwa gleichzeitig mit dem Kloster entstanden sein könnte … Es besteht also durchaus die Möglichkeit, daß es das Schaffnerhaus des Klosters und damit Reuchlins Geburtshaus gewesen sein könnte. Wenn Steine reden könnten, wüßten wir es. Sie hätten es aber tun müssen, bevor sich die Spitzhacke des ›Gotischen Hauses‹ bemächtigte.« – Grundrisse, die von zwei Studenten angefertigt wurden, einige Architekturteile im Museum und eine Zeichnung der Ruine in dem erwähnten Sonderheft – das ist alles, was überdauert. Nicht nur Bücher haben ihre Schicksale.