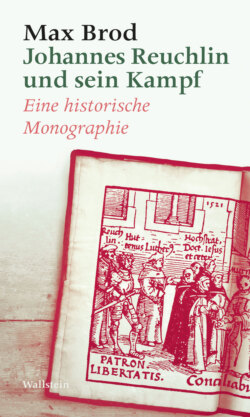Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ERSTES KAPITEL
Umwälzung der Seelen: ein Zeit-Hintergrund 1
ОглавлениеWenn eine weltanschauliche oder künstlerische Bewegung ihren Höhepunkt erreicht, ja schon in ihre Karikatur umzuschlagen und absurd zu werden beginnt, dann ist sie am leichtesten zu konstatieren. Dann ist sie unfehlbar kenntlich. Freilich ohne großen Nutzen, denn die Bewegung ist ja schon in Entstellung oder im Abklingen begriffen, hat ihre ursprüngliche Kraft und Naivität verloren.
Der Beginn einer Bewegung dagegen liegt wesentlich im Dunkeln. Vor der eigentlichen italienischen Renaissance gibt es eine Früh-Renaissance, vor dieser eine Vor-Früh-Renaissance – und so weiter zurück bis zum karolingischen Renaissanceversuch einer universalen europäischen Bildung und noch weiter zurück bis zum unmittelbaren Anschluß an den letzten Wortführer der römischen Literatur, an Namatianus, der um 400 klagend die Ruinen des vom Westgoten Alarich verwüsteten Rom und des ganzen Römerreiches in schönen lateinischen Versen besingt. Die Neigung der Humanisten, in römischer Sprache oder doch im Bannkreis der Antike zu schreiben, zu gestalten, beginnt also, genaugenommen, fast ohne Lücke bereits am Ende des originär lateinischen Schrifttums und der Heidenwelt. Nur mit großer Ungewißheit, nur gradweise lassen sich Stufen unterscheiden: Zur Zeit Karls des Großen der Abt von Fulda, Hrabanus Maurus (dessen »Veni creator spiritus« bei Gustav Mahler neu auftönt), – späterhin Abälard – Dante, Petrarca, Boccaccio – Ariost, Tasso – und so bis zu Michelangelo. Ein machtvoller Strom reißt uns fort, es gibt keine oder nur wenig-merkliche Übergänge.
Die Karikatur hingegen – sie macht sich leicht bemerkbar; sie grinst uns an. Man kann sie nicht übersehen. Heute zwar verwischt sich auch dieses Leicht-Bemerkbare, da sich so viel Karikatur in die Künste drängt, da allenthalben ein wenig talentvolles ›Theater des Absurden‹ begönnert wird, da die Ausnahme den Seltenheitswert verliert, indem alles Ausnahme sein will. Auch da kann es Schönheit geben; der Geist weht, wo er will; man muß sich dann allerdings schon an die Ausnahmen von den Ausnahmen halten. Das Geniale ist glücklicherweise zu allen Zeiten und in allen Völkern da und dort vorhanden.
Ein Beispiel für jene Karikatur, die leicht auffällt, ist mir begegnet, als ich mich einst in die Briefe des Enea Silvio Piccolomini vertiefte, die Max Mell klingend übersetzt hat. In einem der Briefe (an Mariano Sozzini, 1444) ist die lieblich-sehnsüchtige Erzählung von ›Euryalus und Lucretia‹ enthalten, ein Meisterstück des sinnlichen Rausches und der allvernichtenden Melancholie, den besten Novellen des Boccaccio vergleichbar. Enea Piccolomini schrieb sie als junger Mann, indem er, um seinem Freund und Gönner, dem Reichskanzler Kaspar Schlick, zu schmeicheln, eine der köstlichsten Eroberungen des großen Lebemannes im Bilde festhielt, – er hat wohl dem Gegenstande viel von seiner eigenen Blutwärme und Verliebtheit mitgegeben. Später wurde dann aus Piccolomini Papst Pius II., einer von denen, die das Größte angestrebt und dabei viel Gutes bewirkt haben. Er kämpfte gegen den Sklavenhandel, gegen die Judenverfolgungen, war ein Freund des größten Philosophen vieler Jahrhunderte, des Nikolaus von Cues (Cusanus). Um das Vieldeutige auch hier nicht aus dem Blick zu verlieren: In Max Mells Einleitung zu den Briefen erscheint Piccolomini als ziemlich charakterloses Individuum, bloßer Stellenjäger, Karrierist, dessen angebliches ›Ethos‹ nur in seiner schönen Formgestaltung liegen soll, – doch solch ein Mensch hat nie existiert, denn solch ein Ethos gibt es nicht.
In der melodiereichen Jugendnovelle nun bleibt Siena Siena, Kaiser Sigismund als Mittelachse verändert sich gleichermaßen nicht, alles andere aber tritt im antiken Kostüm auf, durchsichtig pseudonym, aus Schlick wird Euryalus, aus der schönen Sienesin eine Lucretia, der betrogene reiche Ehemann bekommt sachgemäß den Namen Menelaos. Bis hierher ist alles (nebst den vielen Zitaten und Anspielungen auf Martial, Vergil und andere Klassiker der Antike) im Rahmen der von den Humanisten geliebten Methode gehalten. Nun aber wird, schon gegen Schluß der Erzählung, ein Bruder des betrogenen Gatten eingeführt, ein Bruder, der »fürchterlich argwöhnisch ist und Lucretia bewacht, als ob er für sie verantwortlich wäre«. Dieser Bruder des Menelaos hat zunächst, als ganz unbedeutende Nebenperson, gar keinen Namen – plötzlich aber heißt er … nun, wie heißt er? Nicht anders als Agamemnon, obwohl er gar nichts Königliches, nichts Zentrales und überhaupt nichts vom ›Hirten der Völker‹ an sich hat. Er ist nur eben der Bruder. Und als Bruder des Menelaos muß er, wenn er überhaupt heißt, Agamemnon heißen. Als ich zu dieser Stelle kam, mußte ich unwillkürlich auflachen. Und mir war, als hätte ich im Augenblick mehr über den Humanismus und die Renaissance erfahren, als wenn ich lange gelehrte Abhandlungen über diese so oft behandelten Ideenrichtungen gelesen hätte. Denn die Karikatur sagt eben oft mehr aus als der beste Spiegel. – Die leise Komik, die sich so mißlich in die humanistische Erneuerung, in eine der edelsten Bewegungen eingemischt hat, deren die Menschheit je fähig gewesen ist, – diese Offenbach-Komik macht in dem zufälligen ›Agamemnon‹ ihren ironischen Knicks. Wir werden auf diesen Seiten solchen Knicksen noch mehr, als uns lieb ist, begegnen.