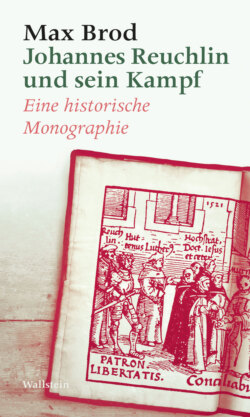Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеAus der Zeit zwischen den beiden italienischen Reisen gibt es interessante Briefe Reuchlins an Jakob Louber, den Prior der Dominikanerkartause in Basel. Reuchlin übersendet dem »reverendo et egregio patri, domino suo, doctori Jacobo Louber, priori Carthusiae Basiliensis« die von ihm selbst verfaßte, handschriftliche Übersetzung einer Schrift des Bischofs Proclus aus frühchristlicher Zeit. Dieser sowie ein zweiter in vertrautem Tone gehaltener Brief (sei es auch mit den dem Zeitgeist entsprechenden Schnörkeln humanistischer Höflichkeit) beweist deutlich, daß Reuchlin bis zu dem großen, durch den rasenden Konvertiten Pfefferkorn verursachten Zusammenstoß mit den Predigermönchen (Dominikanern) in bestem Einvernehmen mit diesen Ordensbrüdern stand. Die Neigung zu ihnen hatte er wohl von seinem Vater übernommen, der ja in ihren Diensten gelebt hatte. In der Folgezeit, bis zu dem erwähnten Zusammenstoß, hat Reuchlin ihnen als Anwalt ihre Rechtsangelegenheiten geführt, und zwar nie entgeltlich, stets nur um Gotteslohn. – In dem zweiten Brief (gleichfalls 1488) erbittet Reuchlin, Louber möge ihm eine Handschrift aus den Bücherschätzen des Dominikanerklosters leihen, ein Neues Testament im griechischen Original, und zwar auf Lebenszeit, er brauche es. Das für Reuchlin so charakteristische Mißtrauen gegen Übersetzungen (sogar gegen die kirchlich approbierte lateinische Vulgata) findet plastischen Ausdruck in den Briefworten: »Die Ursprache jedes Werkes ist süß; und Wein, der mehrmals aus einem Fasse in ein anderes gegossen wird, verliert an Vortrefflichkeit.« »Wenn du meine Bitte erfüllst«, heißt es weiter mit Humanistenpathos, »so hast du mir ein Königreich oder dem Halbtoten das Leben geschenkt.« Dem mit so viel Leidenschaft vorgebrachten Anliegen konnten die Mönche nicht widerstehen. Obwohl der Band eigentlich nicht verliehen werden durfte, dem testamentarischen Willen des Spenders gemäß (eines dalmatinischen Kardinals, der den einem sehr frühen Jahrhundert entstammenden Kodex aus Ragusa zum Konzil nach Basel mitgebracht hatte). Man beschloß, Reuchlin die Handschrift zu leihen, – die denn auch wirklich erst nach seinem Tod in den Besitz des Klosters zurückgekommen ist. In dem Brief, mit dem das Kloster dem Gelehrten die kostbare, auch bibliophil bemerkenswerte Leihgabe übermittelt, heißt es: der Konvent wolle lieber auf die Handschrift als auf Reuchlins Zuneigung verzichten. Und diese ausgesucht höfliche, menschenfreundliche Zuschrift ist vom Ordensprovinzial der Dominikaner, F. Jacobus Sprenger, unterzeichnet. (Preisendanz in F. 2, ferner in den ›Reden und Ansprachen im Reuchlinjahr 1955‹, – sowie ›Briefwechsel‹.)
Man erschrickt. Ist das derselbe Sprenger? Der freilich auch die Gründung der ersten Rosenkranzbruderschaft in Deutschland angeregt hat, dieses lieblichen Dienstes, den Dürers freundlich-festliches Bild im Strahover Stift zu Prag verherrlicht? – Ja, es ist derselbe. Sprenger, der Verfasser des ›Hexenhammers‹, eines der blutigsten entsetzenerregendsten Bücher aller Zeiten. Derselbe Papst Innocenz VIII., der 1486 Picos gutgemeinten, wenn auch leicht chimärischen Weltkongreß der Philosophen in Rom untersagt hatte, autorisierte ein Jahr später dieses fürchterliche Konkokt des Hasses und des Wahnsinns.
Wir können die Gegensätzlichkeiten in Reuchlins Seele, die nie völlig ausgeglichen wurden, sowie den Übergang aus einer immer noch stark vom Mittelalter geprägten Umgebung in das geistige Klima einer Menschlichkeit, wie es in Milde rund um den Grafen von Mirandola und Jakob Loans sich ausbreitete, nicht besser andeuten, als indem wir einen Augenblick bei Sprenger und seinem Hexenglauben verweilen. Das mag auch als Ergänzung zu den Zeitbildern unseres 1. Kapitels verstanden werden. Ich zitiere wieder das verläßliche Werk von Willy Andreas ›Deutschland vor der Reformation‹:
»Zwei Dominikaner waren es, die theoretisch und praktisch gleich unheilvoll und richtunggebend eingriffen, zunächst in Oberdeutschland, dann aber auch über diesen Bereich hinaus. Sie luden damit viel der Schuld, daß diese wahnwitzige Ausschreitung sich weiter einbürgerte, auf ihr Haupt. Es war der hemmungslose und verfolgungswütige Heinrich Krämer, genannt Institoris, der von einer pathologischen Leidenschaft für die Sache ergriffen war, und der Theologieprofessor Jakob Sprenger, der etwas hinter seinem Ordensbruder zurücksteht. Aber er war es, der von Kaiser Maximilian das Patent erwirkte, das die Tätigkeit der zwei Inquisitoren förderte. Diese beiden sind die Verfasser des sogenannten Hexenhammers, des Malleus maleficarum, worin die wichtigsten Lehrmeinungen der Scholastik in Hinblick auf das peinliche Verfahren zusammengestellt waren und der Satz ausgesprochen wurde, daß es Ketzerei sei, zu behaupten, es gäbe keine Hexen. Dies Buch brachte den Hexenwahn, indem es alle auf diesem Gebiet denkbaren, vorgestellten und eingebildeten Verbrechen genau bis ins einzelne festlegte, in ein förmliches literarisches System, und schuf damit auch von dieser Seite her eine Grundlage für die Praxis der Verfolgungen. Die Ansichten über die Arten der Hexerei wurden damit sozusagen planmäßig zusammengefaßt, und so ging denn auch von diesem durch und durch ungesunden Werk eine verheerende Wirkung aus; denn nun hatte der Unsinn Methode gewonnen. Die ohnehin schon im Fortschreiten begriffene Bewegung erfuhr erneut eine Stärkung. Vorausgegangen war die Bulle Innocenz’ VIII., die, beginnend mit den Worten ›Summis desiderantes‹ unter Aufzählung vieler Schändlichkeiten den Glauben an Hexen und ihre fleischlichen Bündnisse mit dem Satan im vollen Umfang bejahte. Eine der verhängnisvollsten Auslassungen des Heiligen Stuhls! – Von den Verfassern des Hexenhammers erbeten und in ihr Buch aufgenommen, um freie Bahn zu gewinnen, gab diese Bulle den um sich greifenden Hexenprozessen durch den Stempel der höchsten kirchlichen Stelle autoritativen Halt; ausdrücklich bestätigte sie die Befugnisse der beiden Dominikaner, aufs schärfste gegen die Hexerei in den südlichen und westlichen Kirchenprovinzen einzuschreiten und den weltlichen Arm hierfür in Anspruch zu nehmen.
Der frühere Widerstand gegen die Verfolgungen erlahmte. Denn anfänglich, als die zwei Inquisitoren auftraten, fanden sie in Deutschland noch mancherlei Widerspruch und Gegnerschaft, und zwar nicht nur bei den Laien, sondern auch bei Kirchenfürsten und Geistlichen. Am mutigsten setzte sich Bischof Golfer von Brixen zur Wehr, der den Institoris aus seinem Bistum verwies, als er hier sein trauriges Werk begann, während der alternde, blöd gewordene Erzherzog Sigismund von Tirol lebhaft an die bösen Wesen glaubte. Bereits aber war die Bewegung in vollem Gang, und die Kräfte der Widersacher hatten es schwer, durchzudringen. Während es sich bis tief ins 15. Jahrhundert noch mehr um Einzelverfahren gehandelt hatte, nahmen nunmehr die Hexenverfolgungen den Charakter von ausgesprochenen Epidemien an. Alsbald schoß der Aberglaube nun auch in Gestalt zahlreicher gedruckter Machwerke über die bösen Hexen ins Kraut. Einzelne verständige oder maßvollere Stimmen gingen im Lärm der hoch und minder gelehrten Herren rasch unter. Auch der Humanismus versagte. Unter den Hexengläubigen gebärdete sich Abt Thrithemius mit am verbohrtesten. Den Kaiser glaubte er zur Ausrottung dieser abscheulichen Menschengattung mit Stumpf und Stiel anspornen zu müssen. In seinem ›Antipalus Maleficiorum‹ aber, den er auf Anregung des Markgrafen Joachim von Brandenburg in Eile zusammenschrieb, wetteiferte er mit den Verfassern des von ihm eifrig ausgeschlachteten Hexenhammers an wüstem Aberglauben und ausschweifender Einbildungskraft. Ja, er schien zu hitziger Verfolgung aufzufordern, wenn er behauptete, fast in jedem Dorf sitze ein böses Wesen von dieser oder jener Sorte. Um deren Opfer von ihren angezauberten Leiden zu befreien, verordnete der findige Kopf eigene Hexenbäder, deren Zubereitung er in selbstgefälliger Breite beschrieb, eine mit Kurpfuscherei durchsetzte Häufung von Exorzismen verschiedenster Art: Die ganze Schrift albern und erschreckend zugleich!
Wie sehr die Phantasie der damaligen Menschen von der Hexenvorstellung schon erfüllt war, bestätigt die Beschäftigung der Kunst mit dem Gegenstand. Dürers Kupferstich der Hexe, die auf dem Besenstiel durch die Luft saust, gibt den Typus der Striga wieder. Unheimlicher die Hexen des Hans Baldung Grien, Weiber von Geilheit strotzend, in Teufels Unzucht verstrickt, umbraust von den entfesselten Elementen, von den tierischen Kräften der Natur! Bei Bosch dagegen, im Antoniusaltar, ist die Welt selber zur Beute des Satans und seiner Brut geworden, ist nur ein einziger Hexensabbat, quirlend von seelenlosen Fratzen und widernatürlichen Wesen, aus Grauen und Wollust geboren. Die ganze Erde ist bösartig verzaubert! Auch die leblosen Dinge brüten Unheil und sind vom Odem der Verwesung vergiftet: Alle schönen Träume des mittelalterlichen Menschen von einer göttlichen Ordnung der Dinge scheinen verkehrt in ihren Widersinn!«
Der ›Hexenhammer‹ erlebte bis 1669 28 Auflagen. Die Hexenverfolgungen griffen auf England, Lothringen und andere Länder über. Die unendlich hoch zu schätzenden Jesuiten Tanner und Friedrich Spee, auch viele andere Geistliche und Juristen widersetzten sich dem Hexenwahn. Doch ein einziger Hexenrichter ließ 800 ›Hexen‹ auf die Scheiterhaufen schleppen. Die Zahl der Opfer geht in viele Hunderttausende. Ja, man schätzt, daß ungefähr eine Million Frauen verbrannt wurden. Die Zahl der Todesopfer der Hexenprozesse lag in manchen Gegenden weit über der, die der Dreißigjährige Krieg gefordert hatte. (Kurt Baschwitz »Hexen und Hexenprozesse«, München 1964.) Heute würde man derartige ›Hexen‹ in eine neuropathische Heilanstalt (hoffentlich nicht in eine mit ›Euthanasie‹) bringen. Hexenprozesse, die als Massenerscheinungen in der Zeit der so viel und zu Unrecht geschmähten ›Aufklärung‹ erloschen, gab es vereinzelt auch noch im 18. und 19. Jahrhundert. »Noch 1836 wurde eine vermeintliche Hexe von den Fischern der Halbinsel Hela der Wasserprobe unterworfen und, da sie nicht untersinken wollte, gewaltsam ertränkt.« (Meyers Großes Konversations-Lexikon 1908.)
Soviel über den guten Frater Jakob Sprenger, den höflichen und freundwilligen Briefschreiber. Einige meinen, daß er gewiß nicht ohne bona fides war. Sie setzen allerdings hinzu, daß er grauenhaft dumm gewesen sein muß. Und seinem innersten Wesen nach: doch nur ein Menschenfeind.
Aus einer neuerdings gedruckten Arbeit von Prof. Dr. Martin Sicherl (Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz 1963) geht hervor, daß Reuchlin 1488 an Sprenger die lateinische Übersetzung eines Briefes des Irrlehrers Nestorius (die man bisher verloren geglaubt hat) mit einem für Sprenger mehr als schmeichelhaften Begleitschreiben geschickt hat. In diesem Begleitschreiben wird der literarische Vater der Hexenverbrennungen folgendermaßen apostrophiert: »Nun habe ich aber nicht nur von den einheimischen, sondern auch den ausländischen Kündern Deines Ruhmes vernommen, daß die Bekanntschaft mit Dir und Deine Gegenwart allen erwünscht, angenehm und nutzbringend sei wegen Deines gewinnenden Wesens, Deiner einzigartigen Rechtschaffenheit (propter tuos svavissimos mores, singularem probitatem) usf.« – Es fällt schwer, diesen Brief in das Bild einzureihen, das man sich von dem großen edlen Reuchlin gemacht hat. Aber die Weltgeschichte, auch die Geschichte der Weltliteratur ist eben ein Nebelmeer von Rätseln. – Jeder müßte diesen seltsamen Brief lesen, der in dem Buch von Sicherl ›Zwei Reuchlin-Funde aus der Pariser Nationalbibliothek‹ nun allgemein zugänglich ist.
Zum Hexenwahn: Es muß hier noch angemerkt werden, daß auch das Judentum nicht ganz frei von Dämonologie ist, daß es seine ›sitra achra‹, seine ›andere Seite‹ hat. Und zwar sowohl im Talmud, das ist in den Jahrhundertdiskussionen der Schriftgelehrten, wie in der Kabbala, das ist im freien ›Empfang‹ der tiefen Einblicke einzelner Lehrer. Doch da wie dort ist dem Wirken des Satans und seiner Gehilfen durch den absoluten uneingeschränkten Monotheismus eine klargezeichnete Grenze gesetzt.