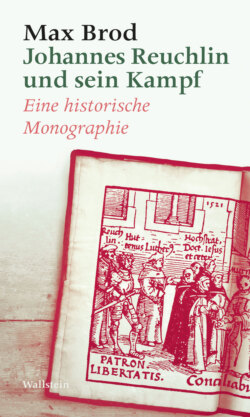Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеDas Maß der Unduldsamkeit war eines Tages voll. Dieses innere Moment darf nicht übersehen werden; wiewohl selbstverständlich auch noch viele äußere Momente hinzutreten mußten (und tatsächlich hinzugetreten sind), die den Überdruß zum Überlaufen brachten. Das ließ lichtere, triebfreundlichere Luft in den Kerker einfließen. Das gute Gewissen der Natürlichkeit regte sich in dem alten, durch asketische Verbote beirrten und verdorbenen, wir würden heute mit Freudscher Terminologie, aber nicht in seinem Sinne sagen: allzu sublimierten Adam. Solche äußere Momente der Umwandlung waren: die Entdeckungsreisen der seefahrenden Völker, der einströmende Reichtum der Neuen Welt und die Erweiterung des Horizonts, die Auffindung antiker Skulpturen und antiker Handschriften, die Erfindung der Buchdruckerkunst, die Eroberung Konstantinopels durch die Türken und die schon vorher angebahnte, nun aber gewaltig verstärkte Überflutung des Westens mit Trägern der griechischen Kultur, ferner das Aufsteigen der Nationalstaaten und des landesfürstlichen Zentralismus, des Beamtentums, des römischen Rechts; kurz eine ganze Kette politischer und wirtschaftlicher Umwälzungen. Alle spielten hier entscheidend mit herein (Jacob Burckhardt ›Die Kultur der Renaissance in Italien‹, Ludwig Geiger ›Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland‹, Huizinga ›Herbst des Mittelalters‹). Die Zwangsgemeinschaft des totalitären Mittelalters zerfiel, aus den Trümmern stieg das souveräne allmächtige Individuum auf und orientierte sich an den Leitbildern der neu entdeckten Antike, in der man (zu Unrecht) die individuelle Komponente weit stärker empfand als den kollektiven Untergrund. Dieser Kollektivgeist hatte, zumindest bis zur skeptischen Spätzeit, das Altertum durchwaltet. Die Wichtigkeit dieses antiken Untergrunds sah man zunächst nicht. Man hatte vom kollektiven Zwang, von der Gewissensangst, den zurückgedrängten Velleitäten und ihren Zersetzungsprodukten einfach genug. Man exzedierte nun freilich in der entgegengesetzten Richtung, man genoß grenzenlos die problematische Freiheit des Freigelassenen. Indessen könnte nur die unendlich schwierige, die richtige Ausgewogenheit der Persönlichkeit gegenüber dem Gemeinwesen, der Freiheit gegenüber den Bindungen ein wirklicher Fortschritt genannt werden. Zurückblickend sehen wir heute, daß die einseitige Freilegung des Individuums, mag sie damals auch als allheilsamer Frühling bejubelt worden sein, in der Folge neben Großem auch durchaus Gemeines und tödlich Verderbliches erzeugt hat. Das »anziehende Verbrechen«, wie schon oben bemerkt.
Wir sind einen weiten und durchaus nicht einwandfreien Weg geschritten, bis zu der schmerzlichen Feststellung, mit der Strindberg eine große Epoche verwerfen konnte: »Es ist schade um die Menschen«, – am Anfang dieses Weges aber mochte das schlimme Ende oder doch die Gefahr eines solchen Endes nicht geahnt werden. Man glaubte, die schmutzige Roheit einer abgelebten Zeit glücklich überwunden zu haben, alles stand in Blüte; verlockend wie Sirenenruf erklangen die berühmten und so oft zitierten Worte Ulrich von Huttens: »O Jahrhundert! O Wissenschaften! Es ist eine Lust zu leben, wenn auch noch nicht, sich zur Ruhe zu setzen, mein Wilibald. Es blühen die Studien, die Geister regen sich: du, nimm den Strick, Barbarei, und mache dich auf Verbannung gefaßt.« So heißt es in dem Brief des stürmischen Ritters (Ulrichi de Hutten ad Bilibaldum Pirckheymer, patricium Norimbergensem, epistola, vitae suae rationem exponens). Allen Bedenken zum Trotz, die manchem wohl von Beginn an aufdämmerten, klang das Schlagwort: »O saecula, o litterae! Juvat vivere!« »Es ist eine Lust zu leben.«
Die harte Wahrheit ergibt sich, daß die zuchtvolle Organisation durch die Kirche kein gutes Ergebnis gehabt hat. Aber auch die Freigeistigkeit, der man sich an Stelle der Unterordnung unter die Kirche hingab, hat bis heute keine endgültig und entscheidend besseren Resultate hervorgebracht. Das ist allem illusionären Fortschrittsglauben entgegenzuhalten, – allerdings nur provisorisch, in Erwartung einer besseren Ordnung. Der leise Hinweis auf meinen Entwurf in dem Buch ›Streitbares Leben‹ (Seite 525 ff.) sei hier gestattet.
Besitzvermerke Reuchlins in: D. Kimchi ›Prophetae priores‹. Inkunabel 1485; und in: D. Kimchi ›Ezechielkommentar‹. Handschrift.
Noch jubelhafter als bei Hutten äußert sich das Hochgefühl der Renaissance in dem derben, doch von Grund aus festlich hellen Rabelais, dem gesündesten ungehemmtesten Lacher jener Zeit. Rabelais ist (was man nie vergessen sollte) ein jüngerer Zeitgenosse Reuchlins, der Dunkelmännerbriefe, des Ritters von Sickingen und Huttens. In seinem ›Gargantua‹ wird das Vitale ins Absurde gekehrt. Der wackere Flaubert hatte seine spitzbübische Freude an den Massen von Wein, Morgensuppen, Rehziemern etc., die der Riese Gargantua vertilgt, – »ganz einfach, das Genie hat seinen wahren Mittelpunkt im Ungeheuren«. »Wie die Pyramiden wachsen diese Bücher (Rabelais, Don Quixote) in dem Maße, als man sie genau betrachtet, und schließlich hat man Angst vor ihnen«. Die scholastische Methode wird von der Sprache aus in Grund und Boden gebohrt. Nachdem der junge Riese Gargantua die Glocken von Notre Dame gestohlen hat, um sie seiner Stute um den Hals zu hängen, sucht ihm ein vom Stadtrat abgeordnetes ›Stück Malheur‹, ein Theologe, die Beute abzuschwatzen, bringt aber nicht viel anderes heraus als die in den üblichen Disputationen vielbenützten Schablonen und Worthülsen: »Omnis glocka glockabilia in glockando glockans glockativo glockare facit glockabiliter glockantes«. Doch auch dieser ungeschlachte und an Unflätigkeiten nicht arme ›Gargantua‹-Roman erweist sich letztlich als Erziehungsroman, ein entfernter Vorläufer des ›Wilhelm Meister‹, sei es auch mit den schärfsten und oft auch übelstriechenden Ironien durchsetzt. Die Schlußkapitel handeln von der Abtei Thélème, die am Loire-Ufer für den völlig aus der Art geschlagenen Bruder Hannes nach seinem Siege als Ehrengabe gebaut wird. Aber der Frater erklärt, er wolle keine Gewalt und Oberhoheit über Mönche besitzen. Es wird also ein »Kloster nach seiner Eingebung« eingerichtet, sehr verschieden von allen andern Abteien, – ein humanistisches Asyl des Frohsinns, in dessen Regel es nur die eine Verfügung gibt: »Fais ce que voudras«. Schroffer (und für die Zukunft gefahrenvoller) konnte das Mittelalter nicht verabschiedet werden. »Tu, was du willst«. – Und der Gründungsbrief? – 1910 haben Engelbert Hegaur und Dr. Owlglass, letzterer aus dem alten ›Simplicissimus‹ bekannt, die beiden Romane des Rabelais, fünf Bände, zu unserem Ergötzen in ein sehr würziges Deutsch übertragen. Es wird über die erwähnte bedeutende Urkunde, dieses welthistorische Klostergründungsstatut erzählt:
»Zum ersten, verordnete Gargantua in Übereinstimmung mit Hannes, dürften keine Mauern ringsum gebaut werden, weil alle andern Klöster durch solche von der Welt abgeschieden seien. – ›Freilich‹, setzte der Mönch hinzu, ›und von Rechts wegen. Denn hinter jeder Mauer kauert wer auf der Lauer und blickt sauer; drum gedeiht dort der Neid und das Verfolgungswesen.‹
Zum zweiten, weil in vielen Klöstern üblich ist, den Ort zu reinigen, den ein Frauenzimmer (ein anständiges und keusches mein’ ich) betreten hat: soll hier jeder Fleck gewischt und gefegt werden, auf dem zufällig ein Mönch oder eine Nonne gestanden.
Weil sonst alles nach Stunden eingeteilt und geregelt sei, ward bestimmt, daß es hier keine Uhr und keinen Stundenweiser geben dürfe; alle Besorgungen sollten nach Zeit und Gelegenheit erledigt werden. ›Denn was ist der größte Zeitverlust?‹ fragte Gargantua. ›Das Stundenzählen. Was hat es für einen Vorteil? Die gröblichste Torheit ist doch, sich nach einem Glockenschlag zu richten, statt nach Bedürfnis und Verstand.‹
Item, weil bis dato bloß schielige, hinkende, bucklige, häßliche, närrische, blöde, lästerliche und anrüchige Frauenzimmer den Schleier genommen hätten, und bloß gichtische, krumme, dumme und zu sonst nichts taugliche Mannsbilder die Tonsur: so wurde dekretiert, die Aufnahme stünde nur hübschen, niedlichen und anmutigen Dirnlein und nur schönen, gesunden und stattlichen Burschen frei.
Item, weil den Weibern der Besuch der Männerklöster und den Männern der Eintritt in Frauenklöster versperrt war – außer wenn es heimlich und verstohlen geschah – so wurde festgelegt, daß kein Mägdlein Schwester werden sollte, es seien denn schon Brüder da, und umgekehrt.
Item, weil sonst Männlein und Weiblein nach dem Noviziat sich für immer und alle Zeit der Klosterschaft verpflichten mußten, wurde bestimmt, daß sie hier nach Belieben ein- und austreten könnten.
Item, weil jeder Ordensangehörige das Gelübde des Gehorsams, der Keuschheit und Armut ablegen mußte, verfügte man, daß hier alle unabhängig sein, reich werden und heiraten dürften.
Das Aufnahmealter wurde für die Nönnlein zwischen dem zehnten und fünfzehnten, für die Fratres zwischen dem zwölften und achtzehnten Lebenslenz festgelegt.«
Zum Erstaunen manierlich geht es in dieser Abtei zu, in der auch »auserwählte Büchereien« ihre Aufstellung finden »und zwar in griechischer, lateinischer, hebräischer, französischer, italienischer und spanischer Sprache, in jedem Stockwerk eine Sprache.« Man beachte, daß die drei hier an erster Stelle genannten Sprachen genau dem Kanon entsprechen, für den Reuchlin sein Leben lang und in Deutschland als erster gekämpft hat, – er, der das ›dreisprachige Wunder‹ genannt wurde. – Dieser Reuchlinsche Kanon ist bei Rabelais um die in Entwicklung begriffenen Volkssprachen erweitert, nach deren einer, der deutschen, Reuchlin nur unter den sonderbarsten Ausreden, aber schließlich doch gegriffen hat, und zwar auf die allertüchtigste Weise.
Zur Erläuterung der Devise »Tu, was du willst« wird gesagt (und man kann diese Sätze bewundern, auch wenn man sie nach der optimistischen Seite hin etwa allzu leichtfertig aufgeplustert finden mag): »Tu, was du willst. Denn wackere, gut erzogene, gesunde und umgängliche Menschen haben von Natur aus einen Hang zum Guten und eine Abneigung gegen das Schlechte: ihre eingeborene Ehre. Knechtschaft und Zwang aber stachelt zu Widerspruch und Auflehnung und ist die Mutter alles Übels.«
Dem humanistischen Leitbild gelten auch in aller Urweltpracht ihrer Schönheit die Verse, die man auf dem großen Tor der Abtei Thélème liest. Und sie erheben sich im Licht ihrer Schönheit zu besonderer Deutlichkeit, ihre Sprache schärft sich zu absoluter Konkretheit, zu äußerster Präzision (in der Übersetzung wäre nur das einem späteren Zeitalter angehörige Wort ›Pietist‹ als Anachronismus zu bemängeln):
»Bleib vor der Türe, Heuchler, Pietist,
Ergrauter Affe, Schmerwanst, Gurgelkropf,
Du Hunne, der die kleinen Kinder frißt,
Waldmenschenurbild mit dem Weichselzopf,
Du Augenschmeißer, abgebrühter Wicht,
Wortdrescher, Blähbauch, kahlgewichster Kopf,
Windbeutel, Lispler, Stänker, Truggesicht,
Scher’ dich zum Kuckuck oder Wiedehopf!
Dein Lügendunst füllt meine Laubengänge,
Du meckerst grell in unsre Festgesänge,
Bleibt draußen, all’ ihr Tintenpharisäer,
Ihr Skribifaxe, Sudler, Lugerfinder,
Ihr feige Seelen, Kleckser, Rechtsverdreher,
Faszikelschmierer, triste Bauernschinder!
Zum Galgen mit euch bluterpichten Wanzen,
An den ihr manchen Braven dekretiert!
Dort mögt ihr wiehernd eure Tänze tanzen.
Hier, hohe Herren, wird nicht prozessiert!
Hier quillt der Freudenborn im Sonnenlicht;
Für euer Handwerk taugt die Sonne nicht.
Ihr aber, edle Herren, tretet ein,
Seid hochwillkommen, Reisige und Reiter!
Hier ist ein Heimatland für groß und klein,
Pflegstatt und Schild für tausend Lebensstreiter.
Kommt her zu mir: ich bin euch Bruder, Freund;
Derselbe Blutsaft rinnt uns durch die Glieder,
Dieselbe klare, warme Sonne scheint
Auf unsre heiter-kühnen Seelen nieder.
Hier ist der bunten Schönheit Adelssitz,
Und durch die Hecken huscht der frohe Witz.
Willkommen, die ihr für die Wahrheit streitet:
Hier ist ein Ort der Zuflucht, ein Asyl.
Hier blüht für euch, die ihr Verfolgung leidet,
Ein stiller Anger und ein Friedensbühl.
Die Lüge reckt ihr siebenfaches Haupt,
Der blinde Haß vergiftet jede Quelle.
So schließet alle, die ihr hofft und glaubt,
Den Bund der Wahrheit und der steten Helle.
Pflegt unser Kleinod, unsern Schatz und Hort,
Von Ewigkeit zu Ewigkeiten fort!
Seid hochwillkommen, schöngemute Frauen,
Bringt holden Sinn und bringt uns Glück herein!
Ihr Wunderblumen wie von Himmelsauen,
Nachsichtig, herzensklug und herzensrein.
In Freiheit grünt der Ehre feinste Blust!
Euch Frauen recht zum innigen Ergetzen
Schuf unser Herr die Gärten voller Lust
Und schmückte sie mit abertausend Schätzen.
So tretet ein! Die höchste Tugend übt,
Wer sich in Liebe einem andern gibt.«
Aus einer etwas früheren Zeit (1500), jedoch aus ähnlicher Stimmung stammt Albrecht Dürers bezaubernder Kupferstich ›Das Meerwunder‹, ein wahres Meisterstück der Gelöstheit und Südlichkeit. Trotz (oder gerade wegen) des kontrastierenden Hintergrunds der mittelalterlich getürmten, verwinkelten Ritterburg. An ihr vorbei zieht ruhig das mythologische Paar, die schöne nackte Frau und der pfiffig-würdige, ein wenig ins Bauernschlaue stilisierte Meergreis mit dem schuppigen Fisch-Unterleib, mit spärlichem, sehr spärlichem Gewand auf eine Riesenmuschel hingelagert. Welch eine Vision der Antike! Ich weiß ihr an einmaliger Größe und Traumhaftigkeit schlechterdings nichts an die Seite zu stellen. Das Wasser des breiten Flusses rauscht auf längs der Riesenmuschel, es geht ans Herz. Langsam, unaufhaltbar ziehen die beiden vorbei – wohin? Aufs offene Meer hinaus mit seinem Archipelagus, eis hala dian, zur heiligen Salzflut? Oder ins ewige zeitlose Nichts? Wie sind sie hergelangt, inmitten banale Wirklichkeit? Am Ufer, in der Ferne, ganz klein, wirft ein dicker Bewaffneter in ohnmächtigem Staunen beide Arme in die Höhe. Er weiß es so wenig wie wir, was der überraschende Anblick bedeuten soll. Vorbei, vorbei. Auf unbegreiflich geglückte Art ist dieses »vorbei, an uns Armen vorbei« zeichnerisch dargestellt, ein Blitz hat eingeschlagen, vorbei, vorbei, das ganze Bild singt geradezu dieses schmerzlich sehnsüchtige, glückselige, begnadete ›vorbei‹, es singt eine wilde Lorelei-Melodie, voll von Süßigkeit und elementhafter Übermacht. Und die Mienen der beiden Hauptfiguren, nicht minder rätselhaft als das berühmte Lächeln der Mona Lisa – die Miene der erschreckten, doch schon halb beruhigten blonden Frau – und die des selbstbewußten, von seinem Beuteglück ein wenig verwirrten oder berauschten See-Fauns mit seinem heidnischen Hirschgeweih, das wie ein Stern zackt, eine Krone. In panischem Schrecken schwimmen einige nackte Frauen ganz fern den Weidegebüschen des Ufers zu. Gehörte auch die blonde Schöne auf der Muschel zu der Schar der Badenden? Ist sie von dem Alten, einem Boten Neptuns, entführt worden? Hart genug hält er ihren runden Oberarm umklammert. Doch sie scheint sich in ihr Schicksal gefunden zu haben. Sie wird, selbst makellos schön, ins Reich der seligen Schönheit gebracht.