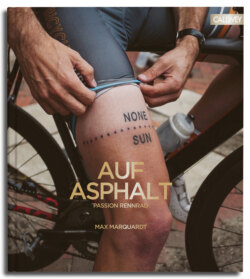Читать книгу Auf Asphalt - Max Marquardt - Страница 10
WAS IST WIRKLICH WICHTIG?
ОглавлениеDie Hände umfassen den filigranen Lenker. Kühle Luft füllt die Lungen. Die Laufräder surren. Eindrücke, Düfte, neue Orte ziehen mit jedem Pedaltritt vorbei. 30, 40, 50 Kilometer. Mal weniger, mal mehr. Mal schneller, mal langsamer. Je nach Gefühl. Ziele, Routen und Pausen selbst wählen. In Bewegung bleiben. Sich in Raum und Zeit orientieren. Bei Wind und Wetter. An die Grenzen gehen, die Härte spüren, die Schönheit auskosten, rare Momente genießen. Jede Ausfahrt ist etwas Besonderes: ob eine schnelle Runde um den Block oder ein monumentaler Alpenpass. Rennradfahren ist Beschleunigung und Entschleunigung. Eine Form des Eskapismus auf schmalen Reifen, nur mit dem Allernötigsten am Leib.
Das Rad fragt nicht. Es fordert. Es macht aus Langschläfern Frühaufsteher, aus Unsportlichen Sportler, aus Rauchern Nichtraucher. Ob sie wollen oder nicht. Wer sich schon mal an einem Sonntag in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett gequält hat, um das Ausschlafen gegen Wadenbrennen und Schnappatmung zu tauschen, wird schweigend zustimmen, mit dem Kopf nicken und sich an die letzte Ausfahrt erinnern: irgendwo dort draußen. Auf rauem Asphalt, in den unzähligen Haarnadelkurven des Stelvios, dem kahlen Gipfel des Mont Ventoux oder den Kopfsteinpflastern der Tremola. Schwitzend, fluchend und überglücklich.
Auch mich hat das Rennrad herausgefordert. Damals, vor einer halben Ewigkeit. Nur zu gerne würde ich hier nun eine heroische Geschichte erzählen, wie ich den Traum des Profi-Rennfahrers oder des verwegenen Abenteurers hegte und mir mühsam in einer düsteren Fabrik das Geld für mein erstes Rennrad zusammenschuftete. Die Wahrheit ist: Ich wollte ein Rennrad, um es mir an die Wand zu hängen, nicht um darauf zu fahren.
Als junger Journalist hatte ich gerade meine erste eigene Wohnung bezogen. Mit Sport hatte ich zu dieser Zeit wenig am Hut. Mit Radfahren schon gar nichts. Menschen, die mit ihren Espresso schlürfenden Freunden stundenlange Dialoge über Fahrräder, irgendwelche Komponenten und ihre bekloppten Ausfahrten führten, empfand ich als egozentrische Zeitgenossen. Mit einer Vier im Schulsport war ich stets den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Ich mied die körperliche Betätigung, wo ich nur konnte, auch nach der Schule noch. Schließlich wollte ich mal Schriftsteller werden und nicht Fahrradfahrer.
Auf der Suche nach Einrichtungsideen für meine Wohnung stieß ich auf Fotos von schicken Lofts, an deren Wänden meist ein stylisches Rennrad hing. So etwas konnte ich mir auch für mein Eigenheim vorstellen. Mit einem schicken Rad über meinem Schreibtisch würde es sich wunderbar arbeiten können. Zwar ähnelte meine Bleibe eher einer Abstellkammer als einem mondänen Loft, aber das war mir egal. Auf Ebay-Kleinanzeigen erspähte ich ein altes Chesini: roter Stahlrahmen, Rahmenschaltung, Ledersattel, Schlauchreifen, 12 Kilogramm.
Ich nahm das Telefon in die Hand, schloss das Geschäft ab und fuhr los, um mir mein neues Deko-Möbel zu holen. Die Sache sollte schnell über die Bühne gehen. Nicht, dass noch jemand Verdacht schöpfen würde und meiner perfiden Absicht der Zweckentfremdung dieses edlen Sportgeräts auf die Schliche käme. Sport? Niemals! Schon beim Aussteigen aus dem Auto wedelte ich dem Besitzer mit den Geldscheinen entgegen. Ob ich das Rad denn nicht testen wolle, entgegnete dieser mir sichtlich verdutzt. Aus Angst, er würde vom Kauf zurücktreten, erwiderte ich zähneknirschend: „Na gut, probiere ich’s halt aus.“ Ich nahm das Rad in Augenschein, rüttelte an allen möglichen unwichtigen Teilen, während mir der Vorbesitzer einen Monolog über Bremsen und Schaltung hielt, setzte mich auf den Sattel und drehte eine Runde. Als ich nach meiner kurzen Ausfahrt wieder vom Rad stieg, war plötzlich alles anders. Was, weiß ich bis heute nicht so genau. Aber: Das Rennrad hing danach keine einzige Sekunde an meiner Wand. Stattdessen fuhr ich direkt nach dem Kauf zum nächstbesten Sportgeschäft, kaufte mir unmögliche Radklamotten, einen Helm, eines dieser Race Caps (das hatte ich mal irgendwo gesehen) und fuhr so viel Rad wie noch nie zuvor in meinem Leben. Nicht weil es Sport war, sondern weil das Rennrad urplötzlich eine seltsame, fast magische Faszination auf mich ausübte, die bis heute geblieben ist. Auf die ersten schweißtreibenden 20 Kilometer folgten viele weitere. Tausende. Ich entdeckte neue Orte, Landschaften, Eindrücke, sammelte Erfahrungen, manche schmerzhaft, die meisten schön. Wie im Wahn sog ich alles auf, was mit Radsport zu tun hatte. Ich schrieb Artikel über Rennräder und Rennradfahrer, nervte meine Journalisten-Freunde mit Rennrad-Geschichten, meine Freundin und meine Eltern sowieso. Jede freie Minute werkelte ich am Rad, meine Wohnung glich inzwischen mehr einer Werkstatt als der mondänen Bleibe, von der ich einst geträumt hatte. Auf das alte Chesini folgten weitere Räder. Moderne Carbon-Schlitten, ein Bahnrad ohne Bremsen, Trainingsräder, Bergräder, Zeiträder. Heute sind es zwölf, und ich muss die Bikes tatsächlich an die Wände hängen. Nicht, weil es stylisch aussieht, sondern weil mir der Platz ausgeht.
Diese Geschichte liegt nun fast 15 Jahre zurück. Heute ist das Rennrad mein Lebensinhalt und -mittelpunkt. Kein Tag vergeht, der nicht in irgendeiner Weise damit verbunden ist. Alles ist darauf ausgerichtet. Alltag, Freundeskreis, mein Beruf. Nach fast zwei Dekaden bin ich mir auch nicht sicher, ob ich jemals wieder ohne Rad in dieser Welt funktionieren könnte.
Inzwischen bin ich derjenige, der stundenlange Dialoge mit seinen Espresso schlürfenden Freunden über Fahrräder, irgendwelche Komponenten und unsere bekloppten Ausfahrten führt. Doch dabei blicke ich immer in leuchtende Augen und spüre die Emotion, die kindliche Begeisterung in ihren Geschichten. Jede davon erzählt von Heldentaten. Von Triumph und Schmerz, von Hungerästen, technischen Defekten, neuen Rädern, Begegnungen, von Freundschaften und unvergesslichen Erlebnissen. Ein Gefühl von Freiheit, das nur dann erlangt wird, wenn man im Sattel sitzt. Doch ist es nur das, was uns am Rennradfahren so sehr fasziniert? Ist diese Freiheit nicht immer temporär? Verfliegt sie nicht genauso schnell wieder wie die vorbeiziehenden Bäume, Felder und Straßen, an die wir uns zurücksehnen, wenn wir in der Tristesse unseres Alltags sehnsüchtig aus dem Fenster schauen?
Seit meinem ersten Tag auf dem Rennrad habe ich stets versucht, hinter das Mysterium der magischen Anziehungskraft zu kommen, von der ich mich seitdem nicht mehr lösen kann. Auf den folgenden Seiten erzählen 15 Radverrückte ihre ganz persönliche Geschichte. Denn genau wie mich hat dieses simple, über 200 Jahre alte Gefährt mit zwei Rädern und einem einfachen Lenker auch sie in ihren Bann gezogen und ihr Leben verändert.
Auf den 15 Pässen, die ich für dieses Buch mitsamt der Kameraausrüstung nach oben gestrampelt bin, habe ich mich gequält, habe gekämpft, gekeucht, geflucht, geschwitzt, hätte das Rad oft am liebsten in hohem Bogen die Böschung hinabgeworfen. Und trotzdem war es eine unvergessliche, intensive und wunderschöne Zeit. Wie immer, wenn ich da draußen auf dem Rad sitze. Rennradfahren ist eine Passion der Widersprüchlichkeiten. Eine Leidenschaft, die viele so sehr in ihren Bann zieht, weil sie immer mit einer Herausforderung verknüpft ist. Eine Herausforderung, die uns in der heutigen Zeit dazu zwingt, aus der watteweichen Komfortzone herauszuschreiten. Raus, wo es ungemütlich, eisig kalt oder glühend heiß sein kann. Wo man sich seinem Gegner stellen muss und es keine Möglichkeit für ein Zurück gibt. Nur du, das Rad und die Elemente. Mal ist es ein steiler Bergpass, mal ein knallhartes Radrennen– oder einfach nur der Sprint zum nächsten Ortsschild. Manchmal ist es aber auch ein erster Pedaltritt dafür, Dinge im Leben zu verändern und das in den Fokus zu setzen, was von Bedeutung ist. Eine Antwort auf die Frage zu finden: Was ist wirklich wichtig?
Ich hoffe, das ist mir mit diesem Buch ein Stück weit gelungen.
Max Marquardt