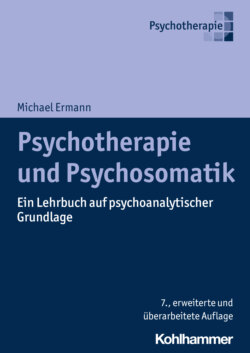Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 199
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.2.1 Das psychodiagnostische Interview
ОглавлениеDie wichtigste Methode der psychodynamischen Diagnostik ist das psychodiagnostische Interview, das sich in verschiedenen Varianten in der psychoanalytischen Praxis entwickelt hat.145 Neben den eingangs erwähnten allgemeinen Aufgaben und Zielen einer jeden Diagnostik hat es die folgenden Aufgaben:
• Klärung des Syndroms: Welches Krankheitsbild besteht aus der deskriptiven Sicht? Handelt es sich um eine einfache oder um eine komplexe Störung im Sinne einer Komorbidität? Besteht eine akute Störung oder eine chronifizierte? Wie lässt sie sich auf der deskriptiven Ebene einordnen (Klassifikation z. B. nach ICD-10)?
• Klärung der Ätiologie: Sind überhaupt psychische Faktoren an der Entstehung einer Störung beteiligt? Wenn ja: Welche pathogenen Faktoren – ungelöste intrapsychische Konflikte, strukturelle Defizite, Traumaerfahrungen – kommen in der Störung zum Tragen?
• Klärung der Psychodynamik: Welche psychodynamischen Prozesse sind wirksam? Insbesondere: Welche Konflikte, Traumatisierungen oder dysfunktionalen Erfahrungen werden als Hintergrund der Störung erkennbar? Wie sind sie entstanden? Wie wirken sie sich aus? Besonders bedeutungsvoll für diese Beurteilung ist die psychodynamische Auswertung der Auslösesituation in Verbindung mit den psychogenetischen Daten der Biografie.
• Klärung der psychischen Struktur: Auf welchem Strukturniveau ist die Störung organisiert? Insbesondere: Handelt es sich vorrangig um eine Konflikt- oder um eine Entwicklungspathologie? Wenn eine Entwicklungspathologie angenommen wird: Welche strukturellen Defizite werden in den auslösenden und symptomverstärkenden Situationen deutlich? Wie äußern sie sich im Leben der Patienten? Welche Ursachen und welche Folgen haben sie z. B. in der Selbstregulation, in Partnerschaften, im beruflichen Kontext?
Das psychodiagnostische Interview schafft damit die Basis für eine psychodynamische Behandlung, in der man versucht, die Hintergründe einer Erkrankung zu verstehen. Darüber hinaus gehört zur psychotherapeutischen Fachdiagnostik die Klärung von Behandlungszielen und der generellen Behandlungsmotivation, die Indikationsstellung für ein geeignetes Behandlungsverfahren und die Prognosestellung.
Das psychodiagnostische Interview geht über die objektive Befund- und Datenerhebung und über die systematische Exploration hinaus und verwendet zwei Beobachtungsebenen als Informationsquelle: die Inhaltsebene und die Beziehungsebene .
• Die Inhaltsebene enthält die objektiven und subjektiven Informationen über Symptome, über den aktuellen Befund, die Vorgeschichte und die Folgen, über die persönliche, die aktuelle familiäre und die soziale Situation, über Lebensereignisse und die Lebensgeschichte, über Beziehungen und Erfahrungen. Sie schließt auch die präverbale Informationen mit ein, die sich als Befund aus dem Erscheinen und den beobachtbaren Eigenschaften ergeben.
• Die Beziehungsebene enthält szenische Informationen, die den Patienten meistens gar nicht bewusst sind. Als »szenisches Verstehen« 146 bezeichnet man die Betrachtung, wie eine Person den anderen in die Interaktion mit einbindet. Das geschieht z. B., wenn ein Patient einer Untersucherin so begegnet, als wäre sie seine Mutter. Solche Szenen entstehen unbewusst und eröffnen den Zugang zu Interaktionsmustern, die in der Psychodynamik eine zentrale Funktion haben.
Das szenische Verstehen ergibt sich aus dem Auftreten und insbesondere aus den Reaktionen, die das Auftreten in der Gegenübertragung auslöst. Darin zeigen sich unbewusste Selbstaspekte und Beziehungsrepräsentanzen. Sie sind ein Schlüssel für die Psychodynamik. Sie lassen sich zumeist auf die Frage zentrieren: Mit welcher Einstellung, mit welchen Hoffnungen, Erwartungen und Ängsten kommt ein Patient in die Untersuchung und wie erlebt er die Situation und den Untersucher? Was sagt sein Auftreten und die Art der Beziehungsmuster, nach denen er die Begegnung gestaltet? Was kann man daraus über seine innere Situation und speziell über die Psychodynamik und seine leitenden Repräsentanzen folgern? Mit welchem impliziten Anliegen kommt er?
Häufig enthält schon die Initialszene einer Begegnung wichtige Hinweise: Verschiebungen von Terminen, Zuspät- oder Zufrühkommen, betonte Sachlichkeit der Begrüßung u. v. a. können auf Ambivalenzen, Befürchtungen oder Hoffnungen hinweisen. Wie solche Szenen zu verstehen sind, erhellt sich dann oft aus der Lebensgeschichte oder dem aktuellen Lebenshintergrund. Auch im Verhalten eines Patienten, aus der Art seines Sprechens und aus dem assoziativen Verlauf des Gespräches können unbewusste Einstellungen erkennbar werden, im Falle des Vergessens z. B. die Ambivalenz gegenüber der Untersuchung.
Eindrucksvoll sind oft Inszenierungen in der Gesprächssituation. Sie können z. B. in der Auslassung einer bedeutsamen Beziehungserfahrung bestehen (»jemand draußen lassen«). Der Patient kann eine zunächst unbewusste, dazu passende Gegenübertragung erzeugen. Der Untersucher kann darin einerseits den im Hier und Jetzt wirksamen Konflikt des Patienten erkennen, andererseits Rückschlüsse auf die früheren Beziehungserfahrungen ziehen, die in solchen Inszenierungen dargestellt werden.