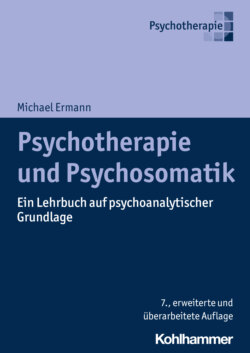Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 215
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.3.4 Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik
ОглавлениеMit der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD)153, die in den 1990er Jahren entstand, liegt ein standardisiertes Manual für die psychoanalytisch orientierte Diagnostik vor. Es erfasst die störungsrelevanten psychodynamischen Merkmale auf fünf Ebenen, den sog. diagnostischen Achsen. Ursprünglich wurde sie als reines diagnostisches Instrument für die Forschung entwickelt. Inzwischen ist sie zu einem Instrument der Therapieplanung und Veränderungsmessung weiterentwickelt worden und wird vor allem als Grundlage für die strukturbezogene Psychotherapie ( Kap. 17.3.4) verwendet.
Die aktuelle Version OPD-2 hält dazu an, auf das gegenwärtige Problem des Patienten als Therapiefokus zu zentrieren und die Behandlung daran zu orientieren. Dabei wird der Unterschied zwischen Konflikt- und Entwicklungs- und Traumapathologie betont und mit der darauf aufbauenden strukturbezogenen Psychotherapie ein spezifischer Ansatz für die Behandlung grundgelegt.154 Indem Veränderungen in den diagnostischen Kategorien messbar werden, können außerdem Behandlungseffekte überprüft werden.
Beispiele für vollständige psychodynamische Diagnosen aus der Praxis
| • Beispiel 1: Reaktive Störung | |
| Syndrom: | Angststörung (ICD-10: F43.22 Angst und depressive Reaktion gemischt), multiforme Somatisierungsstörung (ICD-10: F45.0) |
| Ätiologisch: | Somatopsychische Belastungsreaktion bei Kolonkarzinom |
| Strukturell: | Höheres bis reifes Strukturniveau |
| • Beispiel 2: Posttraumatische Störung | |
| Syndrom: | Posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10: F43.1), dissoziative Störung (ICD-10: F44.0, F44.5), depressive Störung (ICD-10: F32.2 schwere Episode), Zustand nach Suizidversuch (ICD-10: X60) |
| Ätiologisch: | Komplexe posttraumatische Störung nach langdauernder sexueller Missbrauchserfahrung |
| Strukturell: | Niederes Strukturniveau |
| • Beispiel 3: Strukturstörung | |
| Syndrom: | Anorexia nervosa (ICD-10: F50.0), Angststörung (ICD-10: F40.1 soziale Phobie), Borderline-Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.31). DD V. a. posttraumatische Störung |
| Strukturell: | Niederes bis mittleres Strukturniveau |
| • Beispiel 4: Präödipale Störung | |
| Syndrom: | Depressive Störung (ICD-10: F33.1 rezidivierende depressive Störung) |
| Ätiologisch: | Depressiv-narzisstische Persönlichkeit, Versorgungs-Autarkie- und Autonomie-Abhägigkeits-Konflikt |
| Strukturell: | Mittleres Strukturniveau |
| • Beispiel 5: Konfliktstörung | |
| Syndrom: | Alibidinie (ICD-10: F52.0 Mangel an sexuellem Verlangen), depressive Störung (ICD-10: F 32.0: leichte depressive Episode) |
| Ätiologisch: | Zwanghafte Persönlichkeit, Schuldkonflikt bei Lösung aus dem Elternhaus |
| Strukturell: | Mittleres bis höheres Strukturniveau |
| • Beispiel 6: Psychosomatose | |
| Syndrom: | Asthma bronchiale (ICD-10: F54, J45), depressive Störung (ICD-10: F34.1 Dysthymie), narzisstische Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.8) |
| Ätiologisch: | Chronische familiäre Belastungssituation |
| Strukturell: | Niederes Strukturniveau |
Der Vorteil dieses Konzeptes besteht darin, dass die Veränderungsmessung sich tatsächlich auf die störungsrelevanten Aspekte bezieht, die den Behandlungsfokus bilden und verändert werden sollen, und nicht auf beliebige Merkmale.
Die Diagnostik der Ausgangssituation und des Prozesses bzw. des Ergebnisses fußt auf einem klinischen OPD-Interview. In der systematischen Auswertung der Befunde werden die individuellen Merkmale – Symptome, Probleme, Beziehungsmuster, Konflikte, strukturelle Gegebenheiten usw. – den einzelnen Achsen zugewiesen ( Übersicht) und mit statistischen Normwerten verglichen. Dadurch wird das Besondere des Einzelfalls im Vergleich mit dem Durchschnitt erkennbar. Außerdem kann man aufgrund des Vergleichs zwischen Behandlungsbeginn und -ergebnis den therapeutischen Effekt beurteilen. Als Orientierungshilfe enthält das Manual Ankerbeispiele sowie eine genaue Beschreibung der Variablen und Anleitungen für ihre Einschätzung.
Fünf diagnostische Achsen der OPD
• Achse I – Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen
Auf einer Skala von 0 (nicht vorhanden) bis 3 (hoch) wird die Ausprägung von 19 Variablen für den Einzelfall beurteilt. Dazu gehören Schweregrad der Symptomatik, Leidensdruck, Einsichtsfähigkeit in psychodynamische Zusammenhänge, persönliche Ressourcen u. a.
• Achse II – Beziehung
Zur Diagnostik des Beziehungsverhaltens werden das habituelle Beziehungsverhalten und insbesondere die konflikthaften und dysfunktionalen, immer wiederkehrenden Beziehungsmuster beurteilt. Dabei werden konkrete Beziehungsepisoden, das Selbsterleben und das Objekterleben erfasst.
• Achse III –Konflikte
Die OPD beschreibt sieben zeitlich überdauernde Konfliktbereiche ( Kap. 5.3.2), die wiederum wie in Achse I auf Skalen beurteilt werden. Bei der Definition werden entwicklungspsychologische Annahmen vermieden, ohne dass diese damit als irrelevant gelten müssten. Außerdem gibt sie für reaktive Störungen die Möglichkeit vor, die Störung auf konflikthafte äußere Lebensbelastungen zurückzuführen. Schließlich wird zwischen einem aktiven und einem passiven Modus der Konfliktverarbeitung unterschieden und dieser dokumentiert.
• Achse IV –Struktur
Die Struktur wird für die Dimensionen Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Abwehr, Objektwahrnehmung, Kommunikation und Bindung beurteilt. Dabei wird jeweils der Integrationsgrad von 1 (gut integriert) bis 4 (desintegriert) eingestuft.
• Achse V – Syndrom
Sie enthält im Wesentlichen die Einschätzung des klinischen Syndroms nach ICD-10.
Die OPD geht über das traditionelle (auch in diesem Buch vertretene) diagnostische Konzept hinaus. Bei diesem traditionellen Vorgehen werden die subjektive Befindensschilderung des Patienten mit empathischer Einschätzung durch den Untersucher und szenischen Informationen verknüpft und auf der Basis von Expertenwissen zu einem diagnostischen Gesamteindruck integriert. Dabei gehen freilich theoriegeleitete Konzepte mit ein. Das erscheint aber nicht als Nachteil, denn sie werden auch in der anschließenden Behandlung leitend, sofern diese vom Untersucher durchgeführt wird.
Anders ist das Verfahren der OPD. Hier erfolgt die Evaluation in Hinblick auf Achse I bis IV nach standardisierten Vorgaben (Checklisten und Modellsätzen). Achse V übernimmt die Klassifizierung nach ICD-10.
Dieser Ansatz, der ursprünglich für wissenschaftliche Zwecke entwickelt wurde, eignet sich auch für die psychotherapeutische Praxis. Er strukturiert das diagnostische Denken und macht Ergebnisse unabhängig von Theorien kommunizierbar. Die Kurzversionen der einzelnen Achsen tragen den Erfordernissen der Praxis Rechnung, wo man nicht jeden Einzelfall so aufwendig dokumentieren kann, wie das Manual es ursprünglich für Forschungszwecke verlangte. Inzwischen liegt auch für die Verwendung im Psychotherapie-Gutachtenverfahren ein Anwendungsmanual vor.155
Die OPD bedeutet zweifellos einen deutlichen Fortschritt auf dem Weg zu einer Objektivierung von Diagnostik, Therapieplanung und Effizienznachweis in der psychodynamischen Psychotherapie. Ihr Nutzen ergibt sich allerdings nur bei sachgerechter Anwendung. Die Voraussetzung ist eine vertiefte verstehende Erfassung des Einzelfalles, seiner Dynamik und Struktur. Es reicht nicht aus, Befunde (Konflikte und Strukturdefizite) anzunehmen und zu klassifizieren, wenn nicht dargestellt wird und nachvollzogen werden kann, wie diese individuell verankert sind. Es ist erforderlich, dass verstanden wird, wie sie an der Entstehung einer Störung beteiligt sind und welche Folgen sie in Hinblick auf Befinden, Verhalten, Beziehungen und andere Bereiche der Lebensgestaltung haben. Erst auf dieser Grundlage führt die Verständigung über den Einzelfall zu einer Bereicherung. Die bloße Benennung von Konfliktkategorien, Strukturdefiziten und Beziehungsmustern hat als solche für das klinisch-praktische Verständnis wenig Wert, solange diese nicht durch die Darstellung der individuellen Erlebnisinhalte und Funktionsabläufe belegt werden.