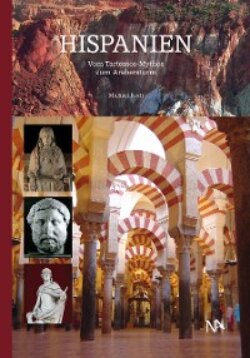Читать книгу Hispanien - Michael Koch - Страница 10
ОглавлениеDer Mythos oder Geschichte vor der Geschichte
„Es heißt, daß in dem Waldgebirge der Tartessier die Titanen gegen die Götter Krieg geführt haben …“
(Iustin. 44,4).
Über dem Beginn der schärfer konturierten „geschichtlichen“ Vorgänge auf der Halbinsel, alle „Vorgeschichte“ einschließend, liegt dunkel und verführerisch der Mythos, jenes meist undurchdringliche Amalgam aus geringem und fernem Wissen, großem Verständnis- und Erklärungsbedarf, aller Art von Projektion, vagem Hörensagen, wichtigtuerischer Spekulation, Unterhaltungsbedürfnis, Angst und tausend weiteren Ingredienzien, mit denen unaufgeklärte, illiterate, naiv-gläubige und zu kritischer Reflexion noch wenig befähigte Gesellschaften sich und anderen halbwegs plausible Anworten auf alle denkbaren Fragen zu geben versuchten, eine Mélange, die gleichzeitig einen bedeutenden Unterhaltungswert besaß.
Welche der frühen Kontakte der Halbinsel mit dem Ostmittelmeerraum zur Mythenbildung geführt haben, lässt sich nicht sagen. Der direkte Beitrag der Phoiniker wird erst mit den frühesten Berührungen phoinikischer Handelsschiffe denkbar, die aus Gründen der inneren Entwicklung der phoinikischen Städte vor Beginn des letzten vorchristlichen Jtds. schwerlich möglich waren. Die legendenhafte Ausschmückung der „Tartessos“-Erfahrungen ist frühen griechischen Kontakten mit dem hispanischen Südwesten zu verdanken, die sich in der griechischen Literatur des 6. Jh. v. Chr. in mannigfaltiger Weise niederschlugen. Im homerischen Werk ist bezeichnenderweise von „Tartessos“ (noch) nicht die Rede.
Versuche, dieses schillernde Gemenge präziser zu historisieren, müssen notwendig scheitern; allenfalls lassen sich hinter den phantastischen Aufblähungen aus immer neuen Erweiterungen, Verformungen, Hinzufügungen antiker Fabulierlust gewisse Tendenzen, Wahrscheinlichkeiten, Hypothesen aufzeigen.
Zweifellos haben ägyptische, kretische, cyprische, phoinikische und griechische (und von anderen, weniger bekannten Trägern unternommene) Handelsfahrten, die sich in der späteren Bronzezeit beträchtlich intensiviert zu haben scheinen, ferner die Begegnung mit fremden Räumen und Völkern und die darauf folgende Kolonisationsbewegung das geografische und ethnologische Wissen der unternehmenden Kulturen beträchtlich erweitert. Sie haben auch die Neigung, vielleicht sogar die Notwendigkeit geweckt, neues „Wissen“ mit altem zu verbinden, neue Erkenntnisse kompatibel zu machen und so eine neue, verständliche und vermittelbare Gesamtkonzeption ihrer jeweiligen Welt zu gewinnen. So erklären sich die meisten Seefahrer-„Berichte“ von Homer bis zu den rationaleren Mitteilungen punischer und griechischer Geografen, deren Informationsstand allerdings von der Glaubwürdigkeit der Gewährsleute im Hinterland der Küsten abhängt. Da es auch um etwas ging, was heute salopp als infotainment bezeichnet wird, tun wir gut daran, Aufblähungen alter und jüngerer Mythenkerne aus den Zeiten „phoinikisch/punischer“ und „griechischer“ Landerkundung im Zuge der frühen überseeischen Kolonisation, also der Erzählungen vom „goldenen Ölbaum“ des Pygmalion in HaGadir (Cádiz), von Geryon, Gargoris, von den weltumspannenden Großtaten des Herakles, dem Hispanienzug des trojanischen Helden Teukros oder den Westreisen des Odysseus zunächst einmal als Unterhaltungstoffe zu behandeln, denen nur punktuell wichtige zeitgenössische geografisch-ethnografische Informationen zu entnehmen sind. Auch die bald bedrohliche Rivalität der Protagonisten der mittelmeerischen Handels-Schifffahrt, Phoiniker und Griechen, führte zu teilweise kuriosen Ergebnissen: So wird beispielsweise der gaditanische Melqart sogleich zum gesamtgriechischen Herakles. Der überwiegende Teil der literarisch, aber auch in der plastischen Kunst bis hin zum Grabturm von Pozomoro überlieferten ‚iberischen‘ Mythen harrt noch der Deutung – Zweifel sind angebracht, ob hier je befriedigende Lösungen erreicht werden können.
Es entspricht der Logik der historischen Abläufe auf der Iberischen Halbinsel, dass die bedeutenderen Fremdkontakte Mythentraditionen und Erklärungsbedürfnisse für Kulturentstehung geschaffen und hinterlassen haben: Neben den genannten phoinikischen, griechischen und – vielleicht – iberischen findet sich eine indoeuropäische möglicherweise im irischen Leabhar Ghabbála („Buch der Invasionen“), von dem sich sogar im großen Geschichtswerk Th. B. Macaulays, The glorious Revolution, eine Nachricht erhalten hat. Dabei handelt es sich um einen den Sagen von den weltumspannenden Reisen und Taten des Herakles ähnlichen märchenhaften Bericht von einem von hispanischen Kelten (Brath, Breoghán, Bile) abstammenden skythischen Krieger namens Golamh, genannt „Mil von Hispanien“, der 3.500 Jahre nach Erschaffung der Welt über Ägypten nach Hispanien kommt und von dort mit seiner Familie und seinem Gefolge nach Irland gelangt, wo er die Herrschaft erringt. Belegt im frühen Mittelalter, werden hier vage historische Reminiszenzen, vermischt mit Erfundenem, gewissermaßen die durchaus wahrscheinlichen hispanisch– irischen Beziehungen der frühbronzezeitlichen Vorzeit, mythisch überhöht. Phänomene, wie das Kloster Britonia im 7. Jh. n. Chr., eine der frühesten hispanischen Klostergründungen überhaupt, bestätigen den fortdauernden Kontakt zwischen den Britischen Inseln und Gallaekien.
Mythischen Charakter besitzen auch etymologische Durchstechereien wie Herodotos Erklärung für den Namen der Pyrenäen (2,33,3). Dass es Mythen gibt, die einheimisch-hispanischen Ursprungs sind, wozu nach Auffassung spanischer Forscher die Gargoris-Geschichte gehört, ist, wiewohl denkbar, einstweilen nicht zu erweisen. Ausgeschlossen ist nicht, dass sich einheimische Mythen hinter nicht-einheimischen interpretationes verbergen. Wahrscheinlicher ist, dass hinter den von dem spätantiken Epitomator Iustinus (aus Pompeius Trogus) überlieferten Erzählungen von Gargoris, der die Bienenzucht erfunden habe, und Habis, dem Begründer des Ackerbaus, hellenistische Kulturentstehungs-Fantasien stehen. In heute kaum noch nachvollziehbarer, jeder Quellenkritik spottender Naivität hat Schulten (19502, 130 ff. und passim) aus alledem und mehr sein Tartessos-Konstrukt gefertigt, mit einer Herrscher-Genealogie, die mit „Sol“ beginnt und mit „Arganthonios“ endet, die etruskischen Ursprungs sei und ganz uniberisch – das alles eher ein Märchen aus dem Orient als seriöse Geschichtsschreibung. Und eben darum so schwer los zu werden!