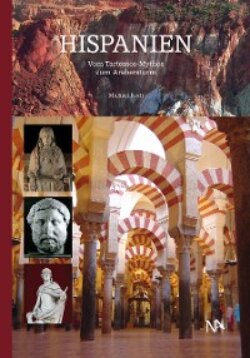Читать книгу Hispanien - Michael Koch - Страница 15
ОглавлениеExkurs 2
Die Iberer
„Die Leiber der Menschen sind auf Entbehrung und Arbeit eingestellt, ihr Geist auf den Tod“
(Iustin. 44, 2,1)
Bevor wir uns dem Großen Krieg und seinen Folgen zuwenden, ist es notwendig, einen Blick auf diejenigen Völkerschaften zu werfen, die mit dem Eintritt Hispaniens in die Geschichte der mittelmeerischen Welt eine Rolle zu spielen beginnen: Die sogenannten Iberer im Osten und Süden der Halbinsel. Dabei ist zunächst daran zu erinnern, dass dies eine Fremdbezeichnung ist: „Iberer“ waren für die frühen Griechen pauschal die Bewohner des Gebietes an den Ufern des großen Flusses Iberos; das Land, welches diese Iberes bewohnten, erhielt bald die Bezeichnung Iberia. Diese wurde mit zunehmender Kenntnis mehr und mehr zur Bezeichnung des gesamten Landes, die mit der Zeit nicht nur bei den Griechen, sondern in der gesamten hellenistischen Welt Anwendung fand. Die Selbstbezeichnungen dieser Ethnien – von den Ausetanern im Nordosten bis zu den Bastetanern im Südosten kennen wir erst aus späteren historischen Zusammenhängen, vielfach auch aus Münzlegenden. Teilweise bleiben sie bis zum Aufgehen der „Iberer“ und ihrer Kultur im Römisch-Hellenistischen gänzlich unbekannt. Die frühen Kolonialmächte subsumierten die iberischen Wohngebiete unter ihre Herrschaftsbezeichnungen: Während die Phoiniker für ihr Interessengebiet lange an der Bezeichnung Tarschisch festhalten und noch Hannibal in seinem Tatenbericht von dessen Bewohnern als Thersitai spricht, haben die späteren Punier eine neue, für seefahrerische Betrachtungsweise typische Bezeichnung gefunden: I Šephanim, „Gestade der Klippdachse“, woraus die Römer Hispania machten. Der Einwohnername Hispani wird in der erhaltenen lateinischen Literatur zuerst in einer Komödie genannt (Plaut. Menaechmi 235, Lindsay). Erst im Laufe des Zweiten Krieges, als Rom in nahen Kontakt mit den Stämmen im Osten und Süden des Landes kommt, gewinnen die vormals pauschal sogenannten ‚iberischen‘ Stämme individuelle Profile. Pierre Moret hat 1996 die bis jetzt bekannten „iberischen“ Fortifikationen im Süden und Osten, wo sie über die Pyrenäen hinaus bis an den Hérault reichen, untersucht. Ihre Zahl beläuft sich ohne die eigentlichen städtischen Siedlungen auf 415, was die in den antiken Quellen vermerkte politische Zersplitterung des Iberertums, das in historischer Zeit zu keiner Staatsbildung fähig scheint, erklären hilft. Gemeinsam ist diesen Ethnien eine einheitliche Schrift, die sich im 5. – 4. Jh. v. Chr. entwickelt zu haben scheint. Ob dieser Schrift eine gemeinsame Sprache zugrunde lag, ist nicht restlos geklärt. Beim heutigen Forschungsstand erweist sich das „Iberische“ mehr als ein komplexes kulturelles Phänomen, manifestiert in Plastik, Toreutik, Keramik, in Architektur und Städtebau, weniger als politisch-gesellschaftlich definierbare Größe.
Diese ‚Iberer‘ sind keine Indoeuropäer, so viel lässt sich sagen – viel mehr aber auch nicht. Ob – und wann? – sie aus Afrika eingewandert sind, ob sie von den Ureinwohnern des Landes – was immer das bedeuten mag – abstammen, bleibt trotz aller Mühen der Wissenschaft eine bis jetzt unbeantwortete Frage. Fest steht: Sie sind da, als Griechen, Phoiniker und schließlich Römer kommen, und es werden Jahrhunderte vergehen, ehe sich ihre Eigenart in der römisch-hellenistischen Akkulturation des Landes verliert – was keineswegs bedeutet, dass diese Eigenart nicht in irgendeiner Form weiterlebte. Auffallend ist freilich, in welchem Maße die kolonisierenden Phoiniker und – in geringerem Maße und auch zeitlich begrenzt – Griechen auf diese Stämme einwirkten: Von den Pyrenäen bis zum südöstlichen Cabo de la Nao, wo der zweite Vertrag zwischen Rom und Karthago (und die änigmatische ora maritima des Avienus) die Grenze ziehen, spürt man Griechisches, während im Süden Punisch-Orientalisches dominiert. Das zeigt sich in Schrift, plastischer Kunst, in Bauweise, kurz, in allen archäologisch erweisbaren Hinterlassenschaften, wobei keinesfalls eindeutig ist, ob eine direkte griechische Einwirkung gegeben war oder punische Vermittlung vorliegt. Eine archäologisch überaus spannende Konvergenzzone zwischen den beiden unterschiedlich akkulturierten Räumen ist in den heutigen Provinzen Albacete, Jaén und Granada erkennbar: Hier ist die eindrucksvolle „iberische“ Großplastik entstanden, für welche Vorbilder im Mittelmeerraum zu suchen sind [Abb. 11a und 11b]; westlich davon, in der punisch dominierten Zone gibt es kaum dergleichen. Hier findet sich neben Einheimischem ein starkes ‚orientalisierendes‘ Element, erkennbar vor allem im kultischen Bereich. Wenn nicht ohnehin genuin phoinikisch, so sind die Ritualgegenstände aus Lebrija oder vom „Carambolo“ diesen jedenfalls sehr eng verwandt.
Der umfangreiche Katalog zu der bedeutenden internationalen Ausstellung „Die Iberer“ von 1998 zeigt sich bemüht, das Iberertum in allen seinen Façetten, vor allem den archäologischen, darzustellen, eine Zusammenfassung, die ihresgleichen sucht. Dort machen die spanischen Gelehrten Lorenzo Abad und Manuel Bendala den Versuch einer Darstellung der „iberischen“ Geschichte „Von Tartessos bis in die römische Zeit“. Man könnte diese Bemühung als gelungen bezeichnen, wenn nicht der „Tartessos“-Bezug für Verwirrung sorgte. Das, was Jahrhunderte nach dem Ende der Bronzezeit grob vereinfacht als „Iberer“ in das Licht der Geschichte tritt, unterscheidet sich von der Bevölkerung des hispanischen Südens und Ostens allein durch die unterschiedlich auf sie einwirkenden Einflussnahmen fremder Kulturen, zunächst Phoiniker, dann Griechen, später Karthager sowie durch Kontakte mit Unteritalien und den nahegelegenen Mittelmeerinseln. Populationswechsel sind im iberischen Raum nicht zu erkennen. Allenfalls ist im Süden und Südwesten seit Beginn des letzten vorchristlichen Jahrtausends ein langsames und uneinheitliches Vordringen indoeuropäischer Elemente zu konstatieren. Das wird uns später beschäftigen.
Abb. 11 a und b Iberischer Reiter aus dem 5. Jh. v. Chr. Los Villares, Hoya de Gonzalo (Albacete). Die Skulptur des unbewaffneten Reiters demonstriert die anmutige Ästhetik des plastischen Schaffens der Iberer auf dem Höhepunkt ihrer Kultur: Griechisch beeinflusst, zeigt sie unverwechselbare iberische Eigenheiten.
„Tartessos“ kann also außen vor bleiben: Was die Bewohner des Südens und Ostens in der Wahrnehmung antiker Quellen und neuzeitlicher Historiker unterscheidet, sind Orientalisierung bei den einen und Mediterranisierung bei den anderen – im 6. und 5. Jh. v. Chr. lässt sich vor allem im Südwesten des Landes eine wachsende Konvergenz beider Kulturräume beobachten, aus der mit der Zeit so etwas wie ein unverwechselbar „iberisches“ Kulturprofil entsteht. Überhaupt erscheinen diese beiden Jahrhunderte als die Blütezeit der als „iberisch“ anzusprechenden Kultur. Es ist eine der kurzen historischen Phasen, in der Osten und Süden des Landes weitgehend selbstbestimmt wirken.
An der südlichen Küste und im Einzugsgebiet des Guadalquivir, aber auch im Binnenland südlich davon findet sich zu Beginn des Zweiten römisch-karthagischen Krieges eine nicht geringe Anzahl städtischer Siedlungen; einige nennen die literarischen Quellen, andere hat die Bodenforschung zutage gefördert. Zwei spanische Archäologen, Arturo Ruiz und Manuel Molinos, haben 1993 in einer Monografie die Siedlungsgeschichte des engeren iberischen Raumes untersucht und dessen vergleichsweise hohe Siedlungsdichte erwiesen. Es ist wahrscheinlich, dass die alten Stammesgebiete und ihre Herrschaftsstrukturen auch während der Phase der orientalisierenden Einflüsse im Großen und Ganzen erhalten geblieben waren. Ihre Fürsten haben ihren halbmythischen Ahnherrn in Arganthonios, wie Herodotos den lokalen/regionalen „chief“ des Tarschisch-Raumes nennt. Aus derartigen chiefdoms muss sich die politische Karte des spätbronzezeitlichen Südens der Halbinsel zusammengesetzt haben, als die Phoiniker das TRT/TRS-Land zu besuchen begannen. Ob sich von den Zimelien, welche solche chiefs in der Frühzeit der phoinikischen Penetration nach Tyros gesandt haben mögen, eine Spur in Ps. 72.10 erhalten hat, steht allerdings dahin (Koch 1984, 60 ff.).
Im Zusammenhang mit dem zweiten Krieg zwischen Rom und Karthago erfahren wir quasi nebenbei, dass einer der mit Karthago verbündeten reguli, Culchas, 28 oppida beherrscht habe, ein anderer, Luxinius, die „stark (befestigten) Städte“ Carmo und Bardo. Sehr spät noch, in caesarischer Zeit, taucht ein einheimischer rex mit Namen Indo mit eigenem Truppenkontingent an der Seite Caesars auf (bell. Hisp. 10). Das kann nur bedeuten, dass Rom die alten Herrschaftsstrukturen tolerierte, solange sie sich nicht als seinen Interessen zuwider laufend erwiesen. Möglicherweise verbirgt sich hinter manchem der ‚romanisierten‘ Personennamen, die im Laufe der ersten 200 Jahre römischer Herrschaft über die Halbinsel begegnen, ein solcher regulus alten Stils.
Mit Culchas erhoben sich im Jahre 197 v. Chr. gegen Rom nur noch 17 oppida. Im Jahre 206 v. Chr. war „Kolichas“, wie Polybios ihn nennt, mit einem Kontingent von 3.000 Fußsoldaten und 300 Reitern zu Scipio übergetreten. Offenbar hatte er früh die Seiten gewechselt und war von den beiden älteren Scipionen in einem Brief an Prusias von Bithynien zusammen mit Masinissa und Nabis genannt worden als Beispiel dafür, dass Rom die Macht dieser Könige erhöht und ihre Herrschaftsgebiete vergrößert habe (Polyb. 21,11). Nun wechselte er erneut die Seiten, was zu einem erheblichen Gebietsverlust führte.
Nach Scipios Sieg und seinen Folgen für die hispanischen Verhältnisse sahen manche der iberischen reguli die Dinge nüchterner. Wie die römischen Provinzgouverneure sie behandelten, wissen wir nicht. Offenbar wurden sie in ihrer Macht eingeschränkt, ob politisch oder wirtschaftlich, ist unklar. In diese Reihe dürfte auch der Stadtherr von Castulo, Hannibals Schwiegervater, gehören. Diese chiefs residierten, soweit wir wissen, in angemessenem Rahmen: Die archäologische Forschung hat in den letzten Jahrzehnten im südiberischen, mehrheitlich ländlichen Raum palastartige Anlagen entdeckt, die als Herrscher-Residenzen angesprochen werden können. Die zuerst entdeckte und am nachhaltigsten erforschte dieser Anlagen – Cancho Roano in der südlichen Extremadura, wohl in das 7. Jh. v. Chr. gehörend und im Einflussgebiet der Orientalisierung liegend – enthält einen Sakralbezirk, der, spanischen Archäologen zufolge, nahelegt, dass, wenn nicht bereits eine frühere, so gewiss die „orientalisierende“ Phase der südiberischen Entwicklung im ersten vorchristlichen Jahrtausend eine sakralmonarchische Tendenz entwickelte. Herrscherliche Manifestationen finden sich auch in sepulkralen Zusammenhängen: Das Grabmal von Pozomoro, welches an das Ende des 6. Jhs. v. Chr. datiert wird und iberische Stilelemente mit ostmittelmeerischen, vielleicht nordsyrischen, vereint, gehört hierhin, aber auch die plastischen Darstellungen vom Grabmonument Cerrillo Blanco bei Porcuna sowie das Grabmal mit der Dama de Baza [s. Abb. 42] oder die Dama de Elche, eigentlich gedacht als Aufbewahrungsort für Leichenbrand.
Auffällig ist, dass sich in den größeren Siedlungen des Südostens und Ostens keinerlei eindeutigen Ansätze zu einer Palast-Architektur gefunden haben. Es besteht Grund zu der Annahme, dass in bestimmten Zonen des „iberischen“ Raums, vor allem im Osten, im 5. und 4. Jh. v. Chr. politische und gesellschaftliche Veränderungen eintraten, die auf eine Abflachung der gesellschaftlichen Pyramide zielten, in deren Gefolge ältere Zeugnisse herrscherlicher Repräsentanz, beispielsweise die Grabtürme und weitere sepulkralen Monumente, zerstört wurden und neue nicht mehr entstanden sind.