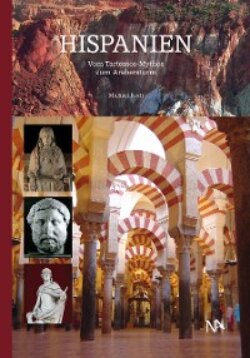Читать книгу Hispanien - Michael Koch - Страница 18
Warum annektierte Rom
die Iberische Halbinsel?
Оглавление„… um nach siegreicher Beendigung des Krieges gegen die Karthager am Ende den Gedanken der Weltherrschaft zu fassen.“ (Polyb. 3,2)
Angesichts der Bedeutung des Engagements der res publica Romana für das weitere Geschick der Iberischen Halbinsel stellt sich die Frage nach den Gründen für deren Annexion. In der Forschung ist dieses Thema oft und kontrovers diskutiert worden; ein Konsens wurde bis heute nicht erreicht. Die Quellen, zumal die den Siegern nahestehenden, haben die Frage nicht beantwortet. Man ist auf einen Indizienbeweis angewiesen, will man behaupten, der siegreiche römische Feldherr Scipio habe nach 209 v. Chr. überhaupt nicht daran gedacht, die römischen Propaganda-Versprechen von Befreiung und Autonomie für die punisch kontrollierten Gebiete einzuhalten und die Halbinsel zu räumen. Natürlich ist das livianische „mein Gefühl sagt mir, Hispanien wird uns gehören“ des späteren Africanus eine rhetorische Ex-post-Bestätigung, doch gibt es genug Hinweise darauf, was Rom spätestens im Jahre 206 v. Chr. wirklich wollte. Wir haben gesehen, dass es die wachsende Macht Karthagos in Hispanien seit Längerem mit zunehmendem Misstrauen verfolgt hatte. Es mag auch sein, dass Matthias Gelzer Recht hatte mit seiner These „Ohne die Eroberungspolitik der Barkiden in Spanien wären die Römer damals nicht nach Spanien gegangen, und ihr Antrieb war [-] die Sorge um die Sicherheit ihrer res publica“ (1963, 34). Gleichwohl ist das höchstens die halbe Wahrheit: Dass Hamilkar und seine Nachfolger in Hispanien Kompensation für die territorialen Verluste Karthagos im ersten Krieg mit Rom und danach suchten, ging Rom nach dem Völkerrecht nichts an. Auch die Einnahme von Saguntum, das zu Zeiten des völkerrechtlich verbindlichen Lutatius-Vertrags im Jahre 241 v. Chr. anscheinend noch nicht mit Rom verbündet war, kann objektiv nicht als Verstoß gegen vertragliche Abmachungen gewertet werden, und in der Zeit des Ebro-Übergangs mit eindeutig militärischer Zielsetzung – dies nun tatsächlich ein Vertragsbruch – hatte Rom bereits Karthago den Krieg erklärt, der nach Hispanien und Afrika getragen werden sollte. Diese strategische Konzeption gab es bereits vor 218 v. Chr., sie entsprang – in Verbindung mit der Annexion Siziliens und Sardiniens – vermutlich der Absicht, Karthago vollständig aus dem westlichen Mittelmeerraum zu verdrängen und auf Afrika festzulegen.
Der Angriff auf Castulo, die bedeutendste Ibererstadt im Südosten und eng mit Karthago verbündet, im Jahre 217 v. Chr. sollte Karthagos Ressourcen treffen. Die Gründung von Italica am Baetis bereits 206 v. Chr., d. h. an der Hauptader des Verkehrs zwischen den Minengebieten des saltus Castulonensis einerseits, am Hauptzugang zu den Rio Tinto-Minen andererseits, die schon im Jahre 212 v. Chr. aus strategischen Gründen vollzogene Teilung des Landes, die frühe Einrichtung von Garnisonen an geostrategisch und ökonomisch zentralen Plätzen, wie beispielsweise Tarraco (Tarragona), „die Schöpfung der Scipionen“, oder die Bestallung von zwei Magistraten für die beanspruchten Herrschaftsräume citerior und ulterior (im diesseitigen und jenseitigen Hispanien) der Halbinsel – dies und mehr macht deutlich: Spätestens 206 v. Chr. waren die Weichen gestellt. Und warum auch nicht? Der große Krieg war noch nicht vorbei, die res publica war pleite, der Krieg keineswegs beendet und die einsetzenden Geldströme aus den neuen Provinzen kamen mehr als gelegen. Ich glaube, dass der österreichisch-amerikanische Althistoriker Ernst Badian irrt, wenn er insinuiert, Rom habe Hispanien eigentlich gar nicht haben wollen, hingegen einräumt, man habe die Kyrenaika „um sofortiger Gewinne willen“ als Provinz eingerichtet (1980 passim, bes. 59). Der Gelehrte sieht hier eine gänzlich neue Außenpolitik. Ich vermag dem nicht zuzustimmen. Das ist keine neue Außenpolitik, sondern ein durch die Eroberung des mittelmeerischen Ostens gewandeltes Szenario sowie veränderte Mentalitäten durch intensivere Berührung mit dem hellenistischen Raum. Warum neben anderem reine Geldnot Rom nicht schon im Jahre 206 v. Chr. genötigt haben soll, Hispanien zu annketieren, ist nicht einzusehen.
Um es mit den Worten des Wirtschaftshistorikers Jaime Vicens Vives zu sagen: „In the concrete case of Hispania, the first Roman conquest was merely an episode in the Punic War. But once Carthage was defeated and expelled from the country by the treaty of 201, the Romans had no intention of abandoning it“ (1969, 57). H. H. Scullard hat das noch nachdrücklicher formuliert: „Wollte Rom Hannibals und Karthagos Macht in Hispanien eliminieren oder wollte es die Zerstörung Karthagos als Großmacht?“ Die Antwort: „Die militärische Planung Roms im Jahre 218 legt letzteres nahe“ (19732, 41).
Natürlich wäre es eine unzulässige Verkürzung der historischen Realität, wollte man Roms Interesse auf den Gewinn von Edelmetallen reduzieren. Neben den aktuellen geostrategischen und Sicherheits-Überlegungen, die für eine Kontrolle der Halbinsel wenigstens auf Zeit sprachen, macht der gesamte Reichtum des großen Landes seine Attraktivität aus, wie vordem für Karthago so jetzt für Rom und später für Piraten, nordafrikanische Räuberhorden, Germanen und muslimische Mauren, von der industriellen Moderne nicht zu reden. Und natürlich wurde dieser Reichtum vergröbert dargestellt; man berücksichtigte nicht, dass er keineswegs überall vorhanden war und dass es auf der Halbinsel Menschen, Gruppen, ganze Stämme gab, die sich aus Edelmetallen rein gar nichts machten (Appian. Iber. 54). Informationen dieser Art wurde in Rom offenbar keine Bedeutung beigemessen.
Man muss den Wissenschaftsgenerationen, die Roms Zugriff auf die Iberische Halbinsel allein unter den Gesichtspunkten von geostrategischem Selbstschutz und zivilisatorischem Sendungsbewusstsein verstanden wissen wollten, zugute halten, dass ihr Blick nicht selten im Übermaß einseitig-romfreundlich gefärbt war. Spaniens frühneuzeitlicher Griff nach Amerika, Englands Inbesitznahme von Indien, die Ausbeutung des Kongo durch Belgien und manch anderes der Art wurden nicht in Parallele gesetzt zu dem, was am Ende des 3. Jhs. v. Chr. die res publica romana veranlasste, die Iberische Halbinsel unter dem staatsrechtlich legitimierten Begriff provincia als Beute des Krieges mit Karthago peu à peu in Besitz zu nehmen. Wirtschaftliche Beweggründe wurden nur selten als wichtige Motive antiker Imperialismen gesehen und Badian konnte sich in seiner Untersuchung zum römischen Imperialismus noch so sehr bemühen zu beweisen, das Senatsregiment der mittleren Republik sei ökonomisch nicht sonderlich interessiert und keinesfalls gewinnorientiert gewesen. Wenn die res publica zusätzliches Geld brauchte, verschaffte sie es sich. Was Badian missversteht: Ob der Senat als Körperschaft gierig war oder nicht, ist ohne Bedeutung, solange die Magistrate vor allem in den westlichen Provinzen notwendige und mehr als die notwendigen Beitreibungen erledigten. Und was die aristokratische Zurückhaltung in oeconomicis betrifft: Spätestens seit dem hannibalischen Krieg ist das eine fromme Lüge: Schon der ältere Cato war durch seine Freigelassenen an Geldgeschäften beteiligt (Plut. Cato maior 21). Plutarch zählt die Einnahmequellen des Triumvirn Crassus auf, darunter vermutlich hispanische Silberminen, und auch der „edle Brutus“, Caesars Mörder, war nebenher Bankier. Man machte – durchweg anonym – Geschäfte oder ließ Geschäfte machen, Beispiele dafür gibt es genug. Jedenfalls darf aus der Tatsache, dass die hispanischen Provinzen zwischen dem numantinischen- und dem Sertorius-Krieg sowie danach kaum das Interesse der zeitgenössischen Geschichtsschreiber finden, nicht geschlossen werden, die Verhältnisse dort hätten sich – etwa im Vergleich mit dem interessanteren Osten – völlig anders dargestellt. Ich finde keine Gründe dafür, anzunehmen, dass sich gierige, korrupte und skrupellose Promagistrate in Hispanien anders verhalten haben sollten als im Osten, nur weil ihnen dort die Umstände ihr Tun erleichterten. Jedenfalls geht es nicht an, aus Mangel an einschlägigen Nachrichten aus den hispanischen Provinzen voreilige Schlüsse zu ziehen. Wenn E. S. Gruen in seinem glänzenden Essay „Material awards and the drive for Empire“ von 1984 auf eine Reihe von Beispielen dafür verweisen kann, dass die offizielle Senatspolitik im 3. – 2. Jh. v. Chr. im Osten in finanzieller Hinsicht durchaus maßvoll angelegt war, so hat er Recht, doch gibt es zum einen reichlich Gegenbeispiele für das Fehlverhalten Einzelner, zum anderen ist der westmittelmeerische Raum bei Gruen nahezu vollständig außer Ansatz geblieben. Gerade dort, im Barbaricum, tritt der Unterschied zwischen der offiziellen Staatsmoral und dem Fehlverhalten Einzelner offen zutage, vor allem, wenn man die Art und Weise betrachtet, in der sich die Prozesse gegen straffällige Gouverneure – beispielsweise gegen Sulpicius Galba Mitte des 2. Jhs. v. Chr. – gestalteten.
Dieser ganze Komplex, der in der aktuellen Forschung noch immer angestrengt diskutiert wird (s. die vorzügliche Übersicht bei W. V. Harris, Current directions in the study of Roman imperialism, passim), kann uns hier nur so weit beschäftigen, als die Iberische Halbinsel tangiert ist. Ich selbst habe mich mit meinen Vorstellungen seinerzeit in Harris’ großer Untersuchung „War and imperialism in republican Rome 327 – 70 BC“ von 1979 weitgehend wiedergefunden. Harris hat seine früheren Einsichten seither eher noch untermauert und verfeinert. Es fehlt allerdings, wenn ich richtig sehe, die Beobachtung, dass Rom in dieser Hinsicht sehr deutlich zwischen Ost und West, zwischen zivilisierten Räumen und Barbarenland unterschied. Hispaniens Mitte, Norden und Westen waren Barbarenland – danach wurde gehandelt.
Es gibt Forschungsmeinungen, wonach der römische Senat, welcher, wie nicht vergessen werden darf, niemals ein geschlossener Block war, mit der Entscheidung, die Halbinsel zu annektieren, lange gezögert habe, doch das hatte er bei der Einrichtung der Provinzen Sizilien und Sardinien auch – und länger – getan. Keine Zeit hingegen ließ sich der siegreiche Feldherr Scipio. Auch Werner Dahlheims raffiniert-gescheites Bemühen, Roms angeblichen contre coeur-Verbleib aus den aktuellen politischen Umständen im Mittelmeerraum zu erklären (1977, 77 ff.), sticht nicht: Schon in den Jahren 206 und 203/2 v. Chr. nach dem Präliminarvertrag mit Hannibal oder spätestens nach dem Sieg bei Zama hätte sich die römische Militärmacht von der Iberischen Halbinsel zurückziehen und deren heterogene, konsens-unwillige Völkerschaften risikolos sich selbst überlassen können, sofern sie dies wirklich gewollt hätte. Tatsächlich aber beeilte sich der Sieger mit der Neugründung, Okkupation und Bündnisbindung von Städten bzw. Stämmen in Hispanien. Bereits die ersten strategischen und diplomatischen Maßnahmen Scipios machen deutlich, wie wenig er beabsichtigte, das „befreite“ Land in den politischen Zustand quo ante, ohne Karthago, zu versetzen. Es ist in unserem Zusammenhang nicht von Belang, ob Scipio das gewissermaßen im Alleingang tat oder ob er sich in Rom rückversichert hatte. In jedem Fall konnte er sich der damals führenden Senatsgruppe sicher sein. Vor seiner Abreise zur Konsulatsbewerbung für 205 v. Chr. nach Rom bestellte er L. Marcius und M. Iunius Silanus zur Verwaltung der provincia ulterior bzw. citerior. In den folgenden Jahren hörte der Senat nicht auf, Propraetoren bzw. Prokonsuln mit entsprechender Befehlsgewalt in das vorgeblich befreite Land zu entsenden, zunächst provisorische Stellen, die ab 197 v. Chr. in reguläre umgewandelt wurden. Es verging einige Zeit darüber, bis man in Rom, wo es in diesen Jahren auch anderes zu tun gab, eine definitive Entscheidung traf und eine brauchbare Form gefunden hatte, mit dem neuen Besitz umzugehen. Die offiziellen Begründungen für den Verbleib, sofern solche überhaupt formuliert wurden, haben stets mit Aufständen, Widersetzlichkeiten oder „Verrat“ zu tun. Das sind fast immer veritable petitiones principii. Dahinter steht, wie sich angesichts der hispanischen Beschwerden des Jahres 171 v. Chr. zeigt, fast niemals etwas anderes, als auf der Seite der Einheimischen das zivile und/oder militärische Einklagen römischer Versprechungen sowie Abgabendruck und Opposition gegenüber einer als Besatzungsmacht auftretenden vorgeblichen „Befreiungsarmee“.
Kaum eine römische Quelle hat das gute Recht dieser Logik akzeptiert: Lediglich Livius, dessen subversive Töne der Forschung nicht immer aufgefallen sind, lässt scheinbar ganz nebenbei den gesunden Menschenverstand in der siegreichen, aber übermäßig lange Zeit auf ihre Besoldung wartenden Armee Scipios zu Wort kommen: „Zuerst“, heißt es im Jahre 206 v. Chr., „gab es nur Gespräche im Geheimen: Wenn es Krieg in der Provinz gebe, wieso denn zwischen friedfertigen Stämmen?“ Und warum, wenn der Krieg gewonnen sei und „die Provinz eingerichtet, warum geht es dann nicht heim nach Italien?“ (28, 24). So konnte man das sehen! Die das angeblich sagten, tragen kuriose Namen: Albius aus Cales und Atrius aus Umbrien: Herr Schwarz und Herr Weiß nicht im Gegensatz zueinander, sondern in Übereinstimmung. Die düpierten Einheimischen dachten und formulierten Ähnliches (Liv. 29,1,22).
Tatsächlich wurde allenthalben mit größter Selbstverständlichkeit der Gewinn des großen und reichen Landes als rechtmäßige Kriegsbeute betrachtet, die es zu verteidigen galt. Vor einigen Jahren hat Badian darüber geklagt, die jüngere Altertumsforschung lege zuviel Gewicht auf sozioökonomische Aspekte der Geschichtsdeutung. Das mag gelegentlich zutreffen, doch wäre die Vernachlässigung dieser Gesichtspunkte ebenso beklagenswert, zumal für den Westen, wo nach römischem Selbstverständnis gegenüber den dort wohnenden ‚Barbaren‘ Verträge, Absprachen, gar menschliche Rücksichten nur beschränkt als bindend oder verpflichtend anzusehen waren und Vertragsbruch jedenfalls nicht als unbedingt strafwürdig galt. Man dachte, wie Badian selbst formuliert, in der Regel gar nicht daran, zugunsten namenloser Barbaren Angehörige der eigenen aristokratischen Schicht strafrechtlich zu belangen. Die Richtigkeit dieser These wird sich vor allem in republikanischer Zeit immer wieder erweisen.
Als die vom „karthagischen Joch“ Befreiten ihre neue Freiheit zu reklamieren beginnen, werden sie, sofern sie nicht klein beigeben, unterworfen: Erst der Nordosten, später der Süden, dann die Mitte und der nördliche Westen. Daraus wurde ein 200 Jahre dauerndes Bemühen, das erst Augustus schlecht und recht abschließen konnte. Bis in spätrepublikanische Zeit verfuhr Rom anderswo ähnlich, wofür Caesars Gallienzugriff beredtes Zeugnis ablegt. Noch Tacitus’ sarkastische Bemerkung „tam diu Germania vincitur, d. h. „so lange schon wird Germanien besiegt“ (Germ. 37,2) macht deutlich, dass sich über Jahrhunderte wenig geändert hatte und vieles sich niemals ändern würde.
Abb. 13 Die Minen von río Tinto (Sevilla) sind von vorgeschichtlicher Zeit bis in die Gegenwart in Gebrauch. Metalle: Kupfer und Silber.
In seinem späten Büchlein „Zöllner und Sünder“ hat Badian wahrscheinlich gemacht, dass das römische System von Steuererhebung und Abgabenpolitik während der mittleren Republik im Großen und Ganzen funktionierte. Wir haben guten Grund zu vermuten, dass die Annexion der Iberischen Halbinsel erheblich dazu beitrug, diesen Zustand zu ändern. Hispanien war nach Sizilien und Sardinien die erste Eroberung, die durch verlässliche Quellen halbwegs befriedigend dokumentiert ist und überdies, alles in allem, die im ökonomischen Sinne reichste Akquisition seit Beginn der römischen Expansion. Mitten im zweiten Krieg mit Karthago war der Kapitalbedarf der res publica gewaltig – welch Wunder also, dass man zugriff. Dass sich im Laufe des 2. Jhs. v. Chr. die gröbsten Scheußlichkeiten in Hispaniens Mitte und Westen jenseits der politisch-militärischen Frontlinie, quasi im Verborgenen des „barbarischen Hinterlandes“, abspielten und lange weitgehend unbeachtet, jedenfalls meist straflos blieben, hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass die Verwaltung der neuen Provinzen tatsächlich grundsätzlich funktionierte. Die Verteilung der Kriegsbeute erfolgte nach dem bewährten Schlüssel; vectigal und alle weiteren Abgabe-Erhebungen dürften normal abgewickelt worden sein, was immer das aus der Sicht der Provinzialen bedeutet haben mag. Über das Wirken früher publicani auf der Halbinsel, denen Cato 195 v. Chr. die Minen zu Pacht und Ausbeutung überlassen haben wird, hören wir in den Quellen fast nichts, was durchaus nicht bedeutet, dass sie keinen Schaden angerichtet hätten. P. A. Brunt (1971, 210) nimmt an, dass die hispanischen Minen zu einem späteren Zeitpunkt „passed into private ownership, and that some of the owners were roman capitalists“, wozu der oben gegebene Hinweis auf Silberminen in Crassus’ Besitz passen würde. [Abb. 13]
Dass sich die Dinge nicht problemlos entwickelten, beweist jener bereits erwähnte Vorgang, den Livius (43,2) aus dem Jahre 171 v. Chr. berichtet: Es seien Gesandte verschiedener populi aus beiden hispanischen Provinzen beim römischen Senat vorstellig geworden, die sich zunächst über die Habgier (avaritia) und Anmaßung (superbia) der römischen Beamten beschwert und dann auf Knien gebeten hätten, nicht zuzulassen, dass sie als Verbündete (socii) Roms schlimmer ausgeplündert und geplagt werden sollten als dessen Feinde. Als Antwort erfand der Senat das sogenannte Rekuperatorenverfahren, wonach die Provinzialen je zwei (römische) patroni (Ombudsleute) wählen sollten, die ihre Sache vor Gericht vertreten würden. Daraufhin kam es zu Verfahren wegen Veruntreuung von Geldern, nicht aber zu Verurteilungen. Ein Angeklagter wurde freigesprochen, zwei entzogen sich der Verurteilung durch freiwilliges Exil. Es gab sogar Gerüchte, so Livius, dass die patroni selbst nicht zulassen wollten, dass gegen nobiles ac potentes Anklage erhoben werde. Auch wird sogleich mitgeteilt, wie der zuständige Praetor verhinderte, dass seine Standesgenossen in allzu große Schwierigkeiten gerieten. Weitere Übergriffe der römischen Verwaltung, wie die Festsetzung der Getreidepreise und anderes mehr kamen zur Sprache: Auch hier erhielten die Hispanier positive Bescheide. Man könnte sagen, dass sich der Senat damals in toto durchaus provinzialenfreundlich und um vernünftige Konfliktlösungen besorgt zeigte, dass aber die aristokratische Verhaltensnorm mit Eigennutz und Mangel an common sense allzu oft den Sieg davon trug.
In praxi galt, was C. Gracchus später als Staatsziel formulierte, dass „die Provinzen des römischen Volkes zum Wohl des römischen Volkes ausgebeutet werden sollten“ (Badian 1997, 80; 135 und passim), nur, dass allzu oft das „römische Volk“ keineswegs der begünstigte Teil war. Harris (2006, 123, Anm. 3) mag Recht damit haben, Valerius Maximus (2,8,4) einen Irrtum vorzuwerfen, nichtsdestoweniger ist die Tatsache, dass Triumphe grundsätzlich „für die Erweiterung des Imperiums“ zugesprochen wurden, aussagekräftig genug.