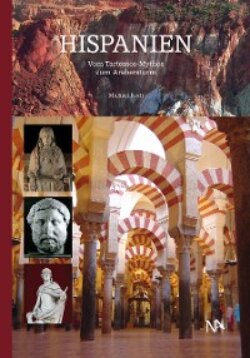Читать книгу Hispanien - Michael Koch - Страница 8
Einleitung
ОглавлениеEine neue – die wievielte? – Behandlung der frühen Geschichte der Iberischen Halbinsel vorzulegen mag überflüssig erscheinen: Tatsächlich gibt es nicht wenige, zum Teil durchaus gelungene Versuche dieser Art. Freilich handelt es sich dabei durchweg um Betrachtungen von Fachgelehrten zu ihren jeweiligen Spezialgebieten oder, wie der fulminante, bilderstürmerische Essay von Américo Castro „La realidad histórica de España“, erstmals 1954 in Mexico erschienen, um Untersuchungen jenseits speziell altertumswissenschaftlicher Methoden und Interessen.
Was angesichts der kaum noch zu überblickenden Masse an Detailforschung vor allem auf der Halbinsel selbst fehlt, ist eine Langzeit-Untersuchung, gewissermassen eine induktiv-diachrone Betrachtung des Altertums der Halbinsel aus einem Guss und, das ist mir besonders wichtig, aus der Perspektive der Halbinsel selbst. Denn nur so ist deutlich zu machen, in welchem Maß Geologie, Geografie, Klima, Immigrationsgeschichte und alle möglichen weiteren Konstanten und Variablen die historisch-kulturelle, wirtschaftliche und politische Entwicklung dieses großen Landes geprägt und bis in die Gegenwart bestimmt haben. [Abb. 1] Von dem viel beschworenen „Geheimnis“ der Halbinsel (El enígma histórico de España) bleibt wenig übrig, wenn man verstanden hat, dass Phänomene wie der notorische, gegenwärtig wieder virulente Partikularismus des Landes, Portugal eingeschlossen, sprachliche und kulturelle Ungleichheiten, die mentalen Differenzen seiner Bewohner und vieles mehr ihre Wurzeln in Gegebenheiten haben, die in der Natur des Raumes und seiner unterschiedlichen Populationen liegen, vor Jahrtausenden geschaffen wurden und danach durch alle historischen Perioden erkennbar bleiben. Der Schriftsteller Orosius, selbst Hispanus, erzählt die hübsche Geschichte von dem „keltiberischen“ Fürsten, der, von Scipio gefragt, was die Stadt Numantia (nahe Soria) so widerstandfähig gemacht habe, antwortete: „einig waren wir unbesiegbar; Uneinigkeit war unser Verderben“. Das ist ein durchgängiges Motiv der Geschichte Hispaniens bis heutezu. Vielleicht war der Aufstand der Hauptstadt Madrid gegen die französische Okkupation vom 2. Mai 1808 und der sich anschließende Unabhängigkeitskrieg gegen die napoleonische Annexion der einzige Moment in der Geschichte der Halbinsel, wo sich alle Spanier ihren Schrei nach Einheit und gemeinsamem Vaterland selbst geglaubt haben. Doch dieser ekstatisch-patriotische Augenblick verging rasch und wiederholte sich, soweit ich sehe, niemals wieder.
Darüber hinaus ist es an der Zeit, angemessen auf den realen (oder vermeintlichen?) Wissenschaftsfortschritt, beispielsweise in der Vergleichenden Sprachwissenschaft, zu reagieren: Keltisch sprechende Personen sind nicht automatisch auch genetisch Kelten, gleiches gilt für den iberischen Bevölkerungsteil. Solche Selbstverständlichkeiten sind keineswegs Allgemeingut. Fortschritte gibt es vor allem im Bereich der Vor- und Frühgeschichte. Seit den Ergebnissen der Elfenbein-Forschung auf der Halbinsel, der Erforschung des kupferzeitlichen Hügelgrabes in Valencina de la Concepción, dem Schiffsfund von Ulu Burun und der Entdeckung mykenischer Luxusgüter in Kivik und manch anderer archäologischer ‚Sensationen‘ muss als sicher gelten, dass bereits mindestens kupferzeitlich sowie selbstverständlich in der Bronzezeit zu Wasser und zu Lande von Osten aus nach Westen und Norden – und zurück – erstaunliche Entfernungen zurückgelegt und gewaltige Räume erschlossen wurden, auch wenn diese Kontakte nicht regelmäßig und nur in größeren Zeitabständen stattfanden. Die historischen Wissenschaften öffnen sich nur zögernd den daraus resultierenden Erkenntnissen, wobei sie sich vielfach auf den lediglich punktuellen Charakter der Belege, auf Laufzeitprobleme und die Undurchsichtigkeit der Vermittlung von Handelsgütern berufen. Diese zum Teil durchaus begründeten Vorbehalte scheinen mir jedoch eher auf die schiere Zufälligkeit der Funde und Quellen abzuheben. Sie sind kein Beleg dafür, dass die Zeitabstände zwischen den Begegnungen immer riesig waren und dass diese Begegnungen jeweils ex novo stattfanden.
Auf jeden Fall war die Welt der Bronzezeit, die am Beginn unserer Darstellung steht, ungleich offener und durchlässiger, als man noch vor wenigen Jahrzehnten für möglich hielt: Von ritzverzierten Stelen, Tafelgeschirr, Sitzmöbeln, Schmuck, Waffen bis zu Bestattungsformen zeigt die europäische Bronzezeit ein komplexes Bild von Kommunikation, Interaktion und kultureller Vergleichbarkeit über weiteste Entfernungen. Auch wenn die Randlage der Iberischen Halbinsel Information zu und Rezeption von bestimmten bronzezeitlichen Phänomenen verzögert haben mag, so nimmt sie doch an allem teil, was die Europäische Bronzezeit – und nicht nur sie – ausmacht.
Mein Interesse, eine solche Arbeit in Angriff zu nehmen, verdankt sich unter anderem einem großen Vorbild: Gerald Brenans mittlerweile klassischer Studie „The Spanish Labyrinth“, zuerst 1943 erschienen und seither vielfach nachgedruckt. Sie ist methodisch und stilistisch den besseren historiografischen Traditionen Englands verpflichtet und nach meiner – vor mehr als 40 Jahren gewonnenen – Überzeugung die sinnvollste Form des Zugangs zur Geschichte der Iberischen Halbinsel. Brenan beschreibt die lange und komplizierte Vorgeschichte des Bürgerkriegs von 1936; tatsächlich handelt es sich um eine komplexe Darstellung der spanischen Geschichte des 19. und 20. Jhs. mitsamt ihren tieferen und tiefsten Wurzeln und Begründungen, die teilweise weit zurückliegen.
Nur so, das hat mich Brenans Arbeit in den späten 1960er-Jahren gelehrt, kann man sich der Geschichte der Iberischen Halbinsel mit Aussicht auf Erfolg nähern, dass man hinter Fakten und Phänomenen, Entwicklungen und Akzidenzen diejenigen unveränderlichen Fixpunkte sucht, die seit tausenden von Jahren die Iberischen Länder und ihre geschichtliche Entwicklung bestimmt haben und durch alle historischen Phasen, die die Halbinsel seit ihrem Eintritt in die „Geschichte“ durchlaufen hat, allen vordergründigen Veränderungen zum Trotz erkennbar geblieben sind. Es sind dies: Geophysik und Geologie im umfassendsten Sinne, vielfache Zuwanderungen von Süden, Norden und Osten (zu Lande und über das Mittelmeer), weniger erkennbar von Westen (und über den Atlantik), und ein sich durch die historischen Phasen erstaunlich ähnliches politisches Kalkül der Nachbarn im Norden und Süden mit den beiden erstgenannten Gegebenheiten. Aber auch ein anderes Phänomen zieht sich durch alle für uns erkennbaren historischen Phasen. Der ältere Plinius hat es auf den Punkt gebracht und einen erstaunlich angemessenen Begriff dafür gefunden: vehementia cordis (Ungestüm des Charakters) (n. h. 37, 203). In der spanisch sprechenden Geschichtsforschung ist dieser Hinweis m. W. nur von J. M. Triviño angemessen gewertet worden – in einem argentinischen Periodikum (1953, 43). Dort sind die meisten antiken Hinweise auf entsprechende Eigenschaften der Hispanier gesammelt; sie ergeben erstaunliche Übereinstimmungen. Gemeint ist mit dem plinianischen mot wohl die immer wieder bei Bewohnern der Halbinsel – Männern wie Frauen – zu beobachtende Bereitschaft, sich ohne Reflexion, raison oder Kalkül und ohne jedwede Rücksicht auf mögliche Folgen einer Sache, ob richtig oder falsch, hinzugeben, von der fides iberica, wie Valerius Maximus (2,6,11;14) sie versteht, und hundert Arten von Selbstaufopferung, dem irrational-mörderischen Hass in älteren und jüngeren Bürgerkriegen, aber vergleichsweise friedfertig auch in der spätmittelalterlichen Mystik, in Literatur und bildender Kunst, im Stierkampf, wohl auch in Tanz und Musik. Es scheine Hispana consuetudo (hispanische Eigenart) zu sein, meinte der ältere Seneca (controv. 1,16), „was immer passiert, so zu leben und auf keine Einrede zu hören.“ Der Geograf Ptolemaios wusste das Gleiche oder glaubte dem Poseidonios: „Die Hispanier sind anarchisch, sie lieben die Freiheit und die Waffen, sie sind kriegerisch, fähig zur Führung, sauber und großherzig.“ (Apotel. 64,13).
Ein weiterer Grund für den vorliegenden Versuch resultiert aus der seit vielen Jahren beobachteten Unfähig- bzw. Unwilligkeit weiter Teile der peninsularen Geschichtsforschung zu tieferer quellenkritischer Reflexion. Ferner kommt er aus meinem Missbehagen an dem vielfach herrschenden alten und neuen Positivismus und der verbreiteten Neigung zu ganzheitlicher Erklärung historischer Vorgänge, die ich – keineswegs als erster – u. a. auf die Nicht-Teilhabe des Landes an der Reformation des 16. Jhs. mit ihren philologischkritischen Errungenschaften und Folgewirkungen sowie auf das Scheitern jedweder Bemühung um „Aufklärung“ im 18. und 19. Jh. zurückführe! So radikal sich iberischer Antiklerikalismus und Liberalismus zuzeiten gerierten: Zäh halten sich Tendenzen zu wenig reflektierter Rezeption von ,Offenbarung durch Autoritäten‘, ganz gleich, ob diese durch anerkannte Universitätslehrer, politische Essayisten oder Kardinäle der römischen Kirche verkörpert werden. Dass die Geschichtsforschung als wissenschaftliche Disziplin auf der Halbinsel erst vor zwei Generationen begründet wurde und dass vordem Alte Geschichte und ihre Schwestern Archäologie, Numismatik, Epigrafik einigen ehrlich bemühten, vielfach der Aristokratie angehörenden ‚Dilettanten‘ sowie Romanciers und Essayisten überlassen waren, liefert weitere Erklärungen für einen altbackenen Positivismus, resultierend aus einem beklagenswerten Defizit an kritisch-reflektierter Erforschung des hispanischen Altertums. Die Tatsache, dass die „Tartessos“-Fiktion des deutschen Althistorikers Adolf Schulten aus dem Jahre 1922, obzwar seit Jahrzehnten widerlegt, zäh ihren Rang in der spanischen Frühgeschichtsforschung behauptet, ist dafür ein markantes Beispiel. Versuche reflektierender Korrektur, wie derjenige von Ricardo Olmos und anderen (Al otro lado del espejo, 1996), bleiben Ausnahmen.
Neuerdings wird auf der Halbinsel vielfach eine ebenso unkritische Übernahme angelsächsischer Erklärungsparameter, speziell im Bereich der Vorgeschichte, betrieben. Dabei handelt es sich einerseits um ein nicht minder erkenntnisgefährdendes Überstülpen häufig unvermittelbarer Fremderklärungen auf Vorgänge und Entwicklungen auf der Iberischen Halbinsel ohne gewissenhafte Prüfung möglicher Kompatibilitäten, andererseits nicht selten um die Anwendung banaler Gemeinplätze auf hochkomplizierte, ausschließlich der Halbinsel vorbehaltene Phänomene. Ähnliche Bedenken sind gegenüber Bemühungen angebracht, auf minimaler Quellenbasis theoretischen Konstruktionen von Staatlichkeit, Gesellschaftsmodellen, Sozialstrukturen und dergleichen, die aus den Sozialwissenschaften entlehnt sind, zu fabrizieren und so den hermeneutisch gänzlich falschen Eindruck zu erwecken, mit ‚modernen‘ Kategorien problemlos zum Verständnis antiker Gegebenheiten zu gelangen. Das führte nicht selten dazu, dass wahrnehmbare Wirklichkeiten den Bedürfnissen theoretischer Modelle angepasst wurden. Umgekehrt ist auch eine wachsende Neigung zu beobachten, den wissenschaftlichen Diskurs durch Rückgriffe auf längst erledigte Fragestellungen einerseits und mangelnde Bereitschaft zur Akzeptanz weithin einvernehmlicher Forschungsergebnisse zu belasten. Zweifellos lebt Wissenschaft von kritischer Dialektik, doch müssen erledigte Schlachten nicht alle zehn Jahre neu geschlagen werden, zumal dann nicht, wenn die ‚Ergebnisse‘ hinter früher gewonnene Erkenntnisse zurückfallen. Arbeiten, die nichts anderes sind als willkürlich zusammenfassende Wiedergaben älterer und neuer Forschungsergebnisse ohne jeden eigenen, gegebenenfalls wertenden, Gedanken, sind Legion. Darüberhinaus gilt es, ein für die Halbinsel nach dem Ende der Diktaturen ebenso charakteristisches wie verblüffend diachrones Phänomen zumindest durchsichtig zu machen: Der in der Geschichte des Landes, Portugal eingeschlossen, früh und durchgehend erkennbare Regionalismus spiegelt sich auch in der Altertumsforschung. So, wie die Universitäten Sevilla, Córdoba und Málaga die Welt andalusisch sehen, so tun das die entsprechenden cátedras in Barcelona und Valencia „iberisch“ bis katalonisch; Santiago de Compostela predigt à la gallega während die kastilischen Institute von Salamanca bis Alcalá de Henares und Valladolid auf den Spuren der Cisneros und Unamuno die Übersicht zu behalten versuchen. Konsequenterweise zählt für Portugal nur Portugal, allenfalls das seit jeher vielfach verwandte Galicia. Solchen Tendenzen muss man nicht begegnen, aber man muss sie kennen und begreifen. Einstweilen hat es den Anschein, als sei die in den 1960er- bis 1980er-Jahren erlebte Forschungs-Kooperation auf Augenhöhe und mit wechselseitigem Respekt verloren gegangen. In bestimmten Bereichen werden auswärtige Beiträge zu zentralen Forschungs-Schwerpunkten nicht mehr zur Kenntnis genommen, geschweige denn zitiert. Ausnahmen werden immer seltener.
Andererseits gibt es Erkenntnis-Erschwernisse objektiver Art, die verständlicherweise die Anwendung immer neuer Erklärungsmodelle in der Hoffnung auf passende Lösungen provozieren.
Zu diesen Erschwernissen gehören Datierung und Interpretation der ältesten literarischen Quellen, die, da nicht selten auf merkwürdigen Wegen überliefert, die Wissenschaft vor nahezu unlösbare Probleme stellen. Zu ihnen gehört beispielsweise die in der Ora maritima des spätantiken Autors Rufius Festus Avienus enthaltene sehr viel ältere punische (oder aus dem Punischen übersetzte griechische) Quelle, aber auch bei klassischen Autoren enthaltene Informationen, etwa die über eine große binnenländische Keltenmigration bei Strabon (3,4,12).
Ein durch kein theoretisches Erklärungsmodell und keine philologische Fein-Analyse zu bewältigendes Problem, ja, ein Grundproblem der Geschichte der Halbinsel überhaupt, stellen neben den teils friedlichen, teils gewaltsamen Invasionen/Penetrationen von außen die immerwährenden Binnenwanderungen dar [Abb. 2]. Über eine potentielle Urbevölkerung auf der Halbinsel wissen wir so gut wie nichts. Nur mit allergrößten Bedenken kann man von ethnischen Blöcken reden, die von Indoeuropäern, nichtindoeuropäischen „Iberern“ und semitischen Einwanderern gebildet wurden: In der indoeuropäischen Zone gibt es in vorrömischer Zeit zahlreiche nicht-indoeuropäische Enklaven, sprachlich/kulturelle Überlagerungen von älteren indoeuropäischen Landnahmen durch jüngere, ebenfalls indoeuropäische, keltisch sprechende Siedlungs-Gebiete in der südiberischen Zone, umgekehrt iberische in den Randgebieten der hispanischen Keltikê. Bis weit in römische Zeit ist die Halbinsel in Teilen Schauplatz immerwährender Transhumanzen, vor allem im Westen des Landes. Zwar versuchte Rom, die bei Beginn der Okkupation vorgefundenen ethnografischen Gegebenheiten zu stabilisieren, doch gelang dies nur mühsam und keineswegs vollständig: Nicht nur der Kimbern-Einfall auf die Iberische Halbinsel Ende des 2. Jhs. v. Chr. (Liv. Per. 67) belegt dauernde Wanderungen von Ost nach West, auch noch in Caesars bellum civile (I, 51) hören wir am Rande des militärisch-politischen Geschehens von der Binnenwanderung einer Stammesgruppe keltischer Provenienz hinter der Front nahe Ilerda, ohne erkennbaren Fremdeinfluss und möglicherweise zum Zwecke neuer Landnahme. Dergleichen muss es zu allen antiken Zeiten gegeben haben und selbstverständlich gehören sowohl die germanischen Einwanderungen der sogenannten Völkerwanderungszeit als auch Tariq ibn Ziyads Invasion von 711 n. Chr. dazu. Es ist also keineswegs immer den Irrtümern antiker Schriftquellen anzulasten, wenn irritierende Informationen sich zu widersprechen scheinen: Eine ethnische Gruppe, die in republikanischer Zeit eine bestimmte Zone bewohnt, kann zu Zeiten der strabonischen, plinianischen oder späterer ‚Landeskunden‘ anderswo, sogar in beträchtlicher Entfernung, angetroffen worden sein. Möglich sind darum allenfalls Momentaufnahmen ethnografischer Festlegungen innerhalb der vorher bezeichneten Blöcke.
Abb. 2 Das antike Hispanien. Ein Versuch, die noch unzureichend erforschte Ethnographie des Landes, wie sie in den antiken Quellen überliefert ist, zu ordnen (nach Almagro Gorbea – Ruiz Zapatero [1992]).
Dass das Bild des römischen Hispanien in der älteren europäischen Geschichtsforschung durch die Romverherrlichung der frühen Kirche, der Renaissance und des Humanismus geprägt ist und Fragen nach dem Eigenwert der unterschiedlichen einheimischen Lebens- und Kulturformen kaum gestellt wurden, entspricht den geisteswissenschaftlichen und ideologischen Traditionen des Landes und Gesamteuropas. J. Linderski hat in seinem Essay „Si vis pacem, para bellum: Concepts of defensiv Imperialism“ aus dem Jahre 1984 am Exempel von Mommsens, Holleaux´ und Tenney Franks Behandlung der Frage, ob es einen ,römischen Imperialismus‘ gegeben habe, deutlich gemacht, unter welchen zeitgebundenen ideologischen Prämissen, Hegels Philosophie eingeschlossen, die drei Gelehrten zu ihrer Vorstellung von Rom gelangt sind, die sich bekanntlich zwischen Bewunderung, Apologie und utopia d’evasione bewegt.
Allerdings: Was aus der Iberischen Halbinsel ohne Rom geworden wäre oder hätte werden können, was Rom – einmal abgesehen von den unbestreitbaren zivilisatorischen Verdiensten während seiner jahrhundertelangen Beherrschung der Halbinsel – unterdrückte, verhinderte oder zerschlug, hat kaum jemand beschäftigt, ebenso wenig sind mentalitätsgeschichtliche Annäherungsversuche bekannt geworden. Dabei ist eine frühe phoinikisch-punische Semitisierung des Landes ebenso denkbar wie seine Teil-Arabisierung im 8. bis 15. Jh. historische Realität wurde. Auch eine weitergehende Iberisierung des Nordens und mittleren Westens lag im Bereich des Möglichen. Stattdessen unterdrückte Rom – weitaus heftiger als vordem Karthago – unbarmherzig alle Versuche zu partikularer Identitätsbehauptung bzw. -gewinnung, ohne freilich dauerhaft – von einem nicht überall gleichermaßen tiefgreifenden Überbau abgesehen – eine profunde politisch-kulturelle Einheitlichkeit zu schaffen. Unverkennbar war die Iberische Halbinsel in der gesamten Antike überwiegend Objekt der Geschichte; wenn nicht alles täuscht, begann sie erst mit der reconquista zumindest zeitweise ihr Subjekt, d. h. Herrin der eigenen Geschichte zu werden.
Eine kulturelle Vereinheitlichung gelang sprachlich und ideologisch in gewissem Umfange für vergleichsweise lange Zeit der römischen Kirche, politisch jedoch später weder den Habsburgern noch den Bourbonen oder auch den autoritären Regimes des 19. und 20. Jhs. Erst in der politischen Gegenwart Spaniens scheint man wenigstens teilweise – wenn auch vielfach widerstrebend – begriffen zu haben, dass die grundsätzlichen mentalen und kulturellen Differenzen der verschiedenen Landesteile nicht dauerhaft ignoriert werden können; Portugal, d. h. ein großer Teil des indoeuropäisch-lusitanischen Raumes, hatte als erster Landesteil die Separation vollzogen. Freilich gibt es auch weiterhin Kräfte, die diese uralte differenzierte historische Prägung nicht wahrhaben wollen, die der politischen Zeitgenossenschaft (wie bereits unter dem Monarchen Felipe II., den Bourbonen und dem Autokraten Franco) nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Erwägungen inopportun erscheint, gleichwohl aber eine unverrückbare Tatsache ist.
Schließlich: Bei allem, was uns rund 200 Jahre Forschungsgeschichte gelehrt haben, ist die Wissens-Landkarte zur Antiken Welt, auch die der Iberischen Halbinsel, voller weißer Flecken. Wir wissen niemals genug über die Welt des Altertums, auch wenn dieses oder jenes Problem mit der Zeit gelöst und manche Fragen beantwortet werden konnten. In gewissen Fällen behelfen wir uns mit Analogien, zuweilen mit Plausibilitäten, um historische Zusammenhänge transparent werden zu lassen. Die eine oder andere Gelehrtenschule übt sich hier in strengerer methodischer Askese, doch muss in Arbeiten wie dieser zumindest ein roter Faden gezogen werden können, um Zusammenhänge überhaupt erkennbar zu machen. Gleichwohl ist der knappe Hinweis „non liquet“ = „die Wahrheit erschließt sich nicht“ in vielen Zusammenhängen die einzig zulässige Aussage.
Es mag den Leser irritieren, dass von Hispanien gesprochen wird: Hispanien meint Spanien und Portugal und entzieht portugiesischen Empfindlichkeiten den Boden, die sich daran entzündeten, dass frühere Generationen, wie schon die Spätantike, allzu oft „Spanien“ für das Ganze nahmen. Dass die handelnden Personen mit vollem Namen und nicht mit den üblichen, teilweise törichten und inkonsequenten Verkürzungen bezeichnet werden, hat etwas mit der Würde der Personen zu tun. Niemand würde den ersten Kaiser als „August“ bezeichnen, aber alle Welt spricht von „Trajan“ oder „Mark Aurel“ Das ist teils törichtes Nachplappern einer vergangenen Mode, teils Sprachfaulheit. Beides erscheint mir unstatthaft. Ebenso wie wir selbst haben Persönlichkeiten der Vergangenheit ein Recht auf ihren Namen. Das gilt auch für Völker! So bequem es wäre, mit dem gängigen Sprachgebrauch von „Westgoten“ und „Ostgoten“ zu reden: In dieser Arbeit heißen sie nach ihrer Selbstbezeichnung Wisigoten und Ostrogoten.
Ich muss auch bekennen, dass es mir unmöglich ist, den Begriff „Heiden“ zu verwenden; wie die Angelsachsen spreche ich deswegen von pagani. So ist der pejorativ-diskriminierende Charakter der Bezeichnung, welche die siegreichen Christen auf alle Menschen anwandten, die andere Glaubensüberzeugungen vertraten, wesentlich deutlicher. Zudem wird klarer erkennbar, dass der zeitweise mörderische Gegensatz: pagani – christiani einer historischen Phase angehört, die vergangen ist oder, wie der hispanische Kaiser Traianus schrieb, „nec nostri saeculi est“, „nicht mehr zeitgemäß“.
Nicht erst, seit mir im Zusammenhang mit meiner Mitarbeit am Bronzezeit-Projekt der Bonner „Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland“ im Jahre 1998/99 bewusst wurde, in welchem Maße politische Kräfte in Brüssel, aber auch anderswo in Europa, sich mühen, dem ökonomisch-politischen Konstrukt „Europäische Union“ eine historische Legitimation zu verschaffen, und sie dafür keine Geschichts-Klitterung zu scheuen scheinen, hege ich Bedenken gegenüber Geschichtsinterpretationen aus politisch-ideologischer Zweckmäßigkeit. Sowenig sich im 3. Jh. v. Chr. die Hirten Lusitaniens für hellenische Fischer interessierten, so wenig hat ein heutiger Hutmacher aus Amalfi oder ein Korbflechter aus Bulgarien mit einem portugiesischen Sichelschmied gemein. Man denkt anders, fühlt anders und handelt anders. Es gab, wie der neue bronzezeitliche Fund im niedersächsischen Gessel (2011) mit Gold aus Zentralasien im Vergleich mit Funden gleicher Zeitstellung auf der Iberischen Halbinsel erneut belegt, in der europäischen Vorgeschichte weltweit kulturelle Interaktion, Migration, Austausch, aber keine europäische Identität. Es gibt sie auch heute – und vermutlich in Zukunft – nicht. Sowenig Rom die immer wieder aufbrechende Zentrifugalität im Westen seines Imperiums – um nur davon zu reden – dauerhaft unterbinden konnte, so wenig gelang die Verschmelzung dem Karolinger-Reich oder Napoleon Bonaparte. Sie wird auch der aktuellen Europhilie nicht gelingen. Die Iberische Halbinsel von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart liefert ein perfektes Modell dafür, auf welchen Grundlagen und bis zu welcher Grenze Gemeinsamkeit gelingen kann und was an vieltausendjährigen Individualismen, Lebensformen, Fühl- und Denkweisen weder zu addieren noch zu amalgamieren und darum nicht verhandelbar ist.
Nach der letzten Durchsicht des Manuskriptes ist mir erschreckend deutlich, was alles noch zu sagen gewesen wäre und wie vieles fehlt. Und was alles ich nicht weiß. Auch ist die Disproportionalität zwischen den mit Quellen reicher gesegneten historischen Phasen und den eher quellenarmen Zeiten erkennbar. Ich hoffe aber deutlich gemacht zu haben, dass die quellenarmen Zeiten auf der Iberischen Halbinsel durchaus nicht als geschichtslose Phasen anzusehen sind.
Allerdings bedeutet der vorgegebene Rahmen nahezu jeden Buches immer auch Beschränkung. Darum ist die vorliegende Studie notwendigerweise (und durchaus beabsichtigt) ein sehr subjektives Buch, welches – befreit von vielfältigen Rücksichten – den durch Jahrzehnte der Beobachtung und Reflexion gewonnenen Blick auf die Iberische Halbinsel im Altertum wiedergibt. Darum auch die Wahl der Essay-Form für die Darstellung: Es ist mein Blick auf die Halbinsel, meine Perzeption ihrer Geschichte, auch meine Demut und mein gelegentliches Unverständnis ihr gegenüber. Und Ausdruck der Dankbarkeit für die Bereicherung meines Lebens durch dieses wunderbare und gleichzeitig furchteinflößende Land. „España me duele“ = „Spanien tut mir weh“, schrieb seinerzeit Miguel de Unamuno aus gegebenem Anlass. Glück und Schmerz, die von diesem Lande ausgehen, haben mich durch mein ganzes Leben begleitet.