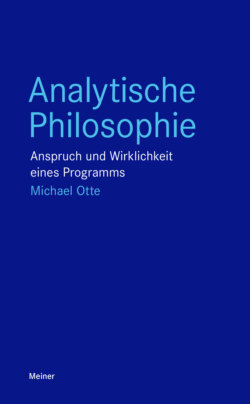Читать книгу Analytische Philosophie - Michael Otte - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.4
ОглавлениеDieses Buch handelt in gewissem Sinne von der Macht der Kontexte über das Denken und so vom kontextuellen Denken. Beispielsweise besitzt weder ein logischer Beweis noch ein Gesetzbuch außerhalb des Kontextes einer formalen Theorie bzw. der Zivilgesellschaft irgendeine Bedeutsamkeit. Logische Gebote gelten nur dann, wenn der Mensch bereit ist, sich auf das Spiel der logischen Argumente zu konzentrieren. Man könnte die analytische Philosophie in ihrer logischen Regelfixiertheit tatsächlich mit dem Rechtswesen vergleichen. Rorty spricht von seinen Kollegen als von »Finanzinspektoren«. Schon im Manifest des Wiener Kreises heißt es: »Die Methode der logischen Analyse ist es, die den neuen Empirismus und Positivismus wesentlich von dem früheren unterscheidet […] Und dann zeigt es sich, dass es eine scharfe Grenze gibt zwischen zwei Arten von Aussagen. Zu der einen gehören die Aussagen, wie sie in der empirischen Wissenschaft gemacht werden. Und nur sie haben eine feste Bedeutung. All die anderen Aussagen sind nur Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls« (Wissenschaftliche Weltauffassung, Der Wiener Kreis, hrsg. von dem Verein Ernst Mach, Wien 1929, S. 305 f.).
Der wissenschaftliche Positivismus betrachtet die Rationalität der Wissenschaften als eine Funktion der Methode, was dann heftige Reaktionen hervorgerufen hat – man denke etwa an die Publikationen von Paul Feyerabend (Against Method, London 1975, 4. Auflage 2010) und all das was darauf gefolgt ist. Feyerabends Verdienst besteht darin, gezeigt zu haben, dass Forschung und Erkenntnis keine Fragen bürokratischer Sprachregelungen, formaler Definitionen und bloßer Methodenvorgaben sein können. Andererseits sieht Feyerabend nicht deutlich, welche Bedeutsamkeit der wissenschaftlichen Theorie beim Ausbilden von Kontexten zuzusprechen ist.
Dabei verstehen wir unter Kontext eine nicht reduzierbare dynamische Einheit von Offenheit und Bestimmtheit. Theorien bilden, in entsprechender Weise aufgefasst, derartige Kontexte. Gregory Bateson hat dies am Beispiel der biologischen Evolution folgendermaßen illustriert: »Die Evolution des Pferdes vom Eohippus aus war nicht eine einseitige Anpassung an das Leben auf grasbewachsenen Ebenen. Gewiss entwickelten sich die Grasebenen ihrerseits pari passu mit der Evolution der Zähne und Hufe der Pferde und anderer Huftiere. Die Grasnarbe war die evolutionäre Antwort der Vegetation auf die Entwicklung des Pferdes. Es ist der Kontext, der sich entwickelt« (G. Bateson, Ökologie des Geistes, Frankfurt 1983, S. 215).
Was die Epistemologie betrifft, ergibt dies nichts anderes als die im vorigen Abschnitt angesprochene Tatsache, dass es das System der menschlichen Tätigkeit ist, welches den Erkenntniskontext abgibt.
Kontextualität ist insbesondere deshalb angesagt, weil die Realität nicht spricht und an sich nicht zum Gegenstand der Erkenntnis gemacht werden kann. Ideen oder Begriffe können nur kontext- und anwendungsbezogen präzisiert werden und gehen doch in diesen Präzisierungen nicht auf. Wenn also die Wirklichkeit und die Darstellung derselben, die Idee oder der Begriff einerseits und seine sprachliche Darstellung oder Definition andererseits, verschieden und zu unterscheiden sind, dann kann man eben die Realität an sich nicht darstellen und man kann auch nicht eine Idee oder einen Begriff definieren. Dies zu sagen ist kein Ausdruck von Resignation. Man kann ganz im Gegenteil behaupten, dass die Inkommensurabilität von Geist und Natur für die Erfindung und Vielfalt unserer darstellenden Mittel verantwortlich ist.
Jede Definition hebt am Begriff bestimmte Aspekte hervor, ist aber ebenso wenig der Begriff selbst, wie die Speisekarte das Menü selbst sein kann. Logik und Mathematik haben das verstanden und haben daher in der Erkenntnis eine Tätigkeit und im Begriff ein Instrument dafür gesehen. Andererseits haben sie eben die Tendenz verstärkt, den Begriff mit seiner Definition oder sprachlich-logischen Bestimmung zu identifizieren, so dass Kant sich veranlasst sah, die Intuition als eine zweite »Grundquelle des Gemüts« zur Begründung der mathematischen und wissenschaftlichen Erkenntnis heranzuziehen. Das ist dann seither vielfach als bloßer Behelf kritisiert worden. Das Zusammenwirken von Begriff und (reiner) Anschauung wird ja nur fruchtbar, wenn man akzeptiert, dass Bedingungen und Bedingtes in jeder Erkenntnis zirkulär verbunden sind, wodurch dann Subjekt und Gegenstand der Erkenntnis sich gegenseitig formen. Mittel und Gegenstände der Erkenntnis sind in einem jeweiligen Moment der Erkenntnistätigkeit zu unterscheiden, aber sie spielen in der Gesamtentwicklung eine durchaus symmetrische Rolle. Daraus ergibt sich eine Komplementarität von operativen und deskriptiven Momenten des Begriffs (vgl. Kapitel III.). Hegel scheint der erste gewesen zu sein, der die Sache so gesehen hat.