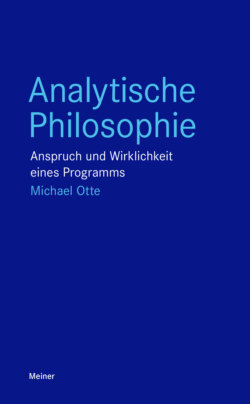Читать книгу Analytische Philosophie - Michael Otte - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.3
ОглавлениеAus dieser Sicht der Dinge heraus, die es auch uns untersagte, etwa Hobbes oder Descartes vor allem als Spezialisten einer von den Wissenschaften getrennten Philosophie zu sehen (vgl. D. Perler, René Descartes, 2. Auflage, München 2006, S. 32 ff.) wird deutlich, dass der Bruch, von dem Rorty spricht, sich erst nach Kant, etwa bei Hegel oder Bolzano, vollzogen hat. Und in den unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs und der Theorie, und damit verbunden des Logischen, ergaben sich dann die Unterschiede zwischen Hegel (1770–1831), Bolzano (1781–1848) oder Peirce (1839–1914), um nur die für uns wichtigsten »Schüler« Kants zu nennen (in gewissem Sinne könnte hier auch noch John Dewey (1859–1952) genannt werden, den Rorty als eine Art philosophischen Ziehvater betrachtet – aber das führte an dieser Stelle zu weit).
So »feindlich« sich die logischen Vorstellungen von Hegel und Bolzano auch gegenüberzustehen scheinen, so ist ihnen doch etwas gemeinsam, was sie von Peirce’ Pragmatismus abhebt: der Ausschluss des Zufalls aus der logischen Vorstellung der Entwicklung des Wissens und der Welt. Das Logische dominiert so stark, dass es der Welt der Dinge nicht gelingt, für Überraschungen zu sorgen. Beide, Hegel wie auch Bolzano, haben das in ihrer Kritik an Kants Mathematikvorstellung geäußert. Man denke etwa an Hegels Charakterisierung der mathematischen Erkenntnis in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes als einer niederen Form, die ihre Vorgehensweisen und Beweise nicht begrifflich-logisch planen kann: »Im mathematischen Erkennen ist die Einsicht ein für die Sache äußerliches Tun; es folgt daraus, dass die wahre Sache dadurch verändert wird. Das Mittel, Konstruktion und Beweis, enthält daher wohl wahre Sätze; aber ebenso sehr muss gesagt werden, dass der Inhalt falsch ist. Das Dreieck wird in dem obigen Beispiele (des Beweises des Satzes des Pythagoras, unsere Einfügung M. O.) zerrissen und seine Teile zu andern Figuren, die die Konstruktion an ihm entstehen lässt, geschlagen. Erst am Ende wird das Dreieck wiederhergestellt, um das es eigentlich zu tun ist, das im Fortgange aus den Augen verloren wurde, und nur in Stücken, die andern Ganzen angehörten, vorkam. […] Was das Erkennen betrifft, so wird vors erste die Notwendigkeit der Konstruktion nicht eingesehen. Sie geht nicht aus dem Begriffe des Theorems hervor, sondern wird geboten, und man hat dieser Vorschrift, gerade diese Linien, deren unendliche andere gezogen werden könnten, zu ziehen, blindlings zu gehorchen, ohne etwas weiter zu wissen, als den guten Glauben zu haben, dass dies zu Führung des Beweises zweckmäßig sein werde. Hintennach zeigt sich denn auch diese Zweckmäßigkeit, die deswegen nur eine äußerliche ist, weil sie sich erst hintennach, beim Beweise, zeigt«.
Hegel kritisiert hier also Kants Auffassung mathematischer Erkenntnis als Tätigkeit, weil damit dem Erkenntnisgegenstand eine Realität zugesprochen wird, die dem Willen und dem Zufall Raum gibt. Alle mathematische Aktivität beginnt mit dem willentlichen Treffen einer Unterscheidung und dem anschließenden Versuch, gegen eine widerständige Realität Relationen zwischen dem Unterschiedenen zu entdecken oder aufzubauen, die sicherlich nicht ohne die Eingebungen von Intuition und Anschauung auskommen können und die schließlich, wenn man Glück hat, sich zu einer allgemeinen Wahrheit verdichten. Kant hatte das gesehen, hatte allerdings einen zu tiefen Graben zwischen dem Begrifflichen und dem in der Anschauung Gegebenen aufgerissen.
»Kant«, sagt Peirce, »saw far more clearly than any predecessor had done the whole philosophical import of this distinction between the intuitive and discursive processes of mind. This was what emancipated him from Leibnizianism, and at the same time turned him against sensationalism. […] But he drew too hard a line between the operations of observation and of ratiocination« (Collected Papers 1.35).
Und was Hegel angeht, so kritisiert er dessen Vorstellung, dass die unmittelbare Anschauung etwas Abstraktes sei (Essential Peirce (EP), vol. II, p. 150), weiter dessen Missachtung des Realen, als etwas Widerständigem: Hegel »has committed the trifling oversight of forgetting that there is a real world with real actions and reactions«. (Peirce, »A Guess at the Riddle«, EP vol. I, pp. 245–279). Ein Grund dafür, so Peirce weiter, bestehe in Hegels relativer Ignoranz gegenüber der Mathematik: »Eine Phänomenologie, die nicht mit reiner Mathematik rechnet, einer Wissenschaft, die kaum in ein Alter der Achtung gekommen war, als Hegel schrieb, wird dieselbe bemitleidenswerte, klumpfüßige Sache sein, die Hegel hervorbrachte« (Peirce, Vorlesungen über Pragmatismus, Hamburg 1991, S. 21; »A phenomenology which does not reckon with pure mathematics […] will be the same pitiful clubfooted affair which Hegel produced«, Collected Papers 5.40).
Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass die reine Mathematik für Peirce keine positive, sondern eine hypothetisch-konditionale Wissenschaft ist und daher paradigmatisch für den Begriff der Theorie schlechthin wird. Nach Peirce soll die Mathematik auch die Grundlage jeder phänomenologischen Untersuchung bilden. Das Wesentliche am menschlichen Denken besteht für die Phänomenologie nach Peirce im Übergang von einer kontinuierlichen und nicht in distinkten Einheiten kategorisierten Realität zu Sprache und zum logischen Denken, welche nach fest umrissenen Kategorien und klaren Unterscheidungen verlangen. Die erste Funktion von Sprache ist oft darin gesehen worden, »to describe the spatio-temporal processes which surround us, and whose topology is transparent in the syntax of the sentences describing them« (R. Thom, 1971, »Modern Mathematics: An Educational and Philosophic Error?«, in: American Scientist, Vol. 59, pp. 695–699, p. 698). Symptomatisch dafür sind die zahllosen räumlichen Metaphern, die unsere Sprache durchwandern – »meine Stimmung ist heute am Tiefpunkt« beispielsweise (vgl. G. Lakoff/M. Johnson, Metaphors We Live By, Chicago 1980).
Wenn dem so ist, dann geht es bei der Analyse und Präzisierung des Diskurses um etwas, was man »diagrammatisches Denken« nennen kann. Und die Mathematik erfüllt hier eine Vermittlerrolle, denn sie basiert auf einem Denken in Diagrammen, die einerseits auf der Analyse beruhen und andererseits konstruktive Entwürfe darstellen, die keine Abbilder, sondern Analogien oder Metaphern sind und deren wesentliche Charakteristik in ihrer Ikonizität und ihrer logischen Funktion besteht. Dies könnte, sagt Peirce (Collected Papers 5.40), als Hegel’sches Denken erscheinen, »were it not for the Secondness, the degree of resistance, which mathematics as diagrammatic reasoning brings to phenomenology« (vgl. ausführlich M. Otte 2011, »Space, Complementarity and ›Diagrammatic Reasoning‹«, Semiotica, vol. 2012, pp. 275–296).
Während Hegel zu exklusiv den Begriff betont und der Mathematik begriffliches Denken abspricht und sie als ein bloß technisch funktionales Unternehmen betrachtet, das in den Anwendungen seine Berechtigung haben mag, aber eben nicht im Bereich der Theorie, versucht Peirce Pragmatismus und theoretisches Interesse zu verbinden. Dies kommt bereits in seiner »pragmatischen Maxime« zum Ausdruck: »Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object« (Collected Papers 5.402).
Es gibt hier die Gefahr eines Missverständnisses, meint Peirce: »The writer (Peirce) was led to the maxim by reflection upon Kant’s Critic of the Pure Reason. Substantially the same way of dealing with ontology seems to have been practised by the Stoics. The writer subsequently saw that the principle might easily be misapplied, so as to sweep away the whole doctrine of incommensurables, and, in fact, the whole Weierstrassian way of regarding the calculus. In 1896 William James published his Will to Believe, and later his Philosophical Conceptions and Practical Results, which pushed this method to such extremes as must tend to give us pause. The doctrine appears to assume that the end of man is action – […] If it be admitted, on the contrary, that action wants an end, and that that end must be something of a general description, then the spirit of the maxim itself, which is that we must look to the upshot of our concepts in order rightly to apprehend them, would direct us towards something different from practical facts, namely, to general ideas, as the true interpreters of our thought.« (Collected Papers 5.2–3).
Im Ziel stimmt Peirce mit Hegel überein. Aber dieses Ziel ist nicht die Realität, von der wir auszugehen haben. Das Wirkliche sind für Hegel der Begriff und somit Begriff und Gegenstand in ihrer sich entwickelnden Einheit, er unterscheidet nicht, wie Peirce sich ausdrückt, zwischen Essenz und Existenz. Dies gilt bereits für die Ästhetik, die »Wissenschaft des Sinnes, des Empfindens« (Hegel). Und man kann tatsächlich jedes Kunstwerk oder jede Theorie als einen sich entfaltenden Begriff verstehen, wobei dann eben Spezifizierung und Verallgemeinerung interagieren und, wie Hegel sagt, die Partikularität des bloß Subjektiven überwunden wird. Aber es ist eben ein Irrtum, dies als einen rein logisch determinierten Prozess aufzufassen, in dem der Zufall keine Rolle spielt.
Raffael von Urbino (1483–1520) beispielsweise galt über viele Jahrhunderte hinweg als der größte Maler aller Zeiten. Wenn Raffael seine malerischen Probleme gelöst hatte, dann konnte er doch nicht sagen, wie er das gemacht hat. Es ist unbestreitbar, dass, ganz gleich, wie bewusst man sich der Aktivität des eigenen Geistes ist, man die Erfahrung macht, die eigene Komplexität nicht voll berücksichtigen zu können, weil dieselbe im Handeln sich weiterentwickelt. Eigentlich meint das nur, dass der Zufall durch die Interaktion mit dem Gegenstand ins Spiel kommt. Dass sich der Mensch in seiner Tätigkeit weiterentwickelt, liegt an der Widerständigkeit des Gegenstands, der objektiven Realität, wenn man so will. Es liegt hier etwas Paradoxes zu Grunde, insofern Raffael für etwas bewundert wird, was eigentlich maschinenhaft und natürlich erscheint, es jedoch gerade nicht ist, und somit etwas verlangt, was wir Intuition nennen.
Hegel wie Peirce vertreten eine Logik, die die fundamentale Tatsache einer sich entwickelnden Realität berücksichtigen will, aber ihre Vorstellungen davon differieren und an dieser Differenz orientiert sich alles weitere Nachdenken.
»Internal anancasm, or logical groping, which advances upon a predestined line without being able to foresee whither it is to be carried nor to steer its course, this is the rule of development of philosophy. Hegel first made the world understand this; and he seems to make logic not merely the subjective goal and monitor of thought, which was all it had been ambitioning before, but to be the very mainspring of thinking, and not merely individual thinking but of discussion, of the history of the development of thought, of all history, of all development (Collected Papers 6.287–90).
Zur Erläuterung des Terminus »anancasm« sei darauf verwiesen, dass Peirce drei Typen der Evolution oder Entwicklung kennt: »Evolution by fortuitous variation, evolution by mechanical necessity, and evolution by creative love. We may term them tychastic evolution, anancastic evolution, or anancasm, and agapastic evolution […] All three modes of evolution are composed of the same general elements. […] Just so, tychasm and anancasm are degenerate forms of agapasm« (Collected Papers 6.302–303).
Durch den Terminus agapasm will Peirce seine Überzeugung – die er übrigens mit Hegel und Marx teilte – ausdrücken, dass die Evolution gerichtet ist, einen Fortschritt im Sinne einer Ausbreitung des Bedeutungsvollen und Vernünftigen mit sich bringt.
Nun zeigt schon ein Blick auf die Biologie der sexuellen Reproduktion, dass es nicht die »Essenzen« oder Gesetze sind, die die Evolution vorantreiben, sondern eher die Zufälligkeiten der individuellen Existenz und die Tendenzen, die sich daran anknüpfen, so dass Peirce recht hat, wenn er betont, dass eine Evolutionstheorie nicht nur die Entwicklung des Einzelnen, sondern ebenso das Entstehen der Gesetze erklären muss. Peirce meint, »the only possible way of accounting for the laws of nature […] is to suppose them results of evolution. This supposes them not to be absolute, not to be obeyed precisely. It makes an element of indeterminacy, spontaneity or absolute chance in nature« (Collected Papers 6.13).
Weiter: »Chance is indeterminacy, is freedom. But the action of freedom issues in the strictest rule of law« (Peirce, Writings 4, 547 ff., vgl. auch Collected Papers 1.175 und 1.405). Und E. Mayr, den viele den »Darwin des 20. Jahrunderts« genannt haben, schreibt: »Darwin’s basic insight was that the living world consists not of invariable essences, but of highly variable populations. And it is the change of populations of organisms that is designated as evolution« (E. Mayr, What Evolution is, N.Y. 2001, chapter 5).
Die Vermittlung von Zufall und Gesetzmäßigkeit bezeichnet Peirce, wie gesehen, als agapasm, ein Terminus, der eher der kulturellen denn der biologischen Entwicklung zugehörig scheint. Entsprechend gibt es Peirce zufolge drei Grundkategorien, durch die sich jedwede Entwicklung in welchem Bereich und auf welchem Niveau auch immer analysieren und beschreiben lässt, drei Kategorien, die eben wegen dieser Allgemeinheit und Universalität nicht definiert werden können, sondern die nur kontextbezogen spezifizierbar sind. Peirce nennt sie Erstheit, Zweitheit und Drittheit.
Aus einer dynamischen Perspektive heraus, die den schieren Lebenswillen oder Erkenntniswillen des Individuums als Voraussetzung aller Entwicklung im Auge hat, könnte man auch sagen, Wille ist Erstheit, Widerstand Zweitheit und Vermittlung oder Repräsentation, d. h. Verallgemeinerung ist Drittheit! Oder: »Mind is First, Matter is Second, Evolution is Third« (Peirce, Collected Papers 6.34). Oder ein anderes Beispiel, welches die Entwicklung von Bedeutung nachzeichnet, in Peirces eigenen Worten wiedergegeben: »Chance is First, Law is Second, the tendency to take Habits is Third« (Collected Papers 6.34). Und wenn wir uns einmal in den linguistischen Kontext begeben, repräsentiert das Prädikat in einem Satz Erstheit, das Subjekt Zweitheit und der Satz selbst, verstanden als ein komplexes Symbol, Drittheit. Drittheit ist die Interpretation, während der Referent oder das bezeichnete Objekt Zweitheit und die Idee, unter der es dargestellt wird, Erstheit repräsentiert.
Man könnte auch sagen, es ist die Kontinuität hier das Dritte, weil die Ausbildung von Gewohnheiten auf einem Ähnlichkeitsgefühl und d. h. auf einem Prinzip der Kontinuität beruht. Eine Gewohnheit, insofern sie allgemein wirksam werden soll, muss in einem Zeichen vergegenwärtigt sein. Jedes Denken und alle Kommunikation sind an Zeichen gebunden. Umgekehrt begründet der untrennbare Zusammenhang von Ding und Zeichen, des Einzelnen und des Allgemeinen, die Bedeutung des Prinzips der Kontinuität. Da sich jedoch keine Verallgemeinerung rein mechanisch und mit Notwendigkeit vollzieht, erscheint der Prozess der Verallgemeinerung nicht mit Notwendigkeit und sind unsere wissenschaftlichen Induktionen niemals sicher. Und was dabei herauskommt, ist eine Art Möglichkeitsraum, dem eine Form abgelesen werden muss. Keine Messdatenreihe gibt die Formel der interpolierenden Kurve oder Gesetzmäßigkeit genau an. Erst als Kepler Brahes Daten zur Bahn des Mars ansah, kam ihm die Idee der Ellipsenform, weil der Mars die vom Kreis am stärksten abweichende Bahn durchläuft. Dabei war seine Auswahl nicht überwältigend groß, hatte man doch nur Kreise oder Kegelschnitte als Kandidaten zur Interpolation der Daten zur Verfügung.
In seinen »Notes on Scientific Philosophy« von 1905 hat Peirce betont, dass das Streben nach absolut exakter Erkenntis mit dem Kontinuitätsprinzip unvereinbar sei, »for where there is continuity, the exact ascertainment of real quantities is too obviously impossible. No sane man can dream that the ratio of the circumference to the diameter could be exactly ascertained by measurement« (Collected Papers 1.172). Dies entspricht exakt der Haltung des Aristoteles in seiner Opposition gegen die im Namen Platos verfolgte Mathematisierung der Natur (vgl. Koyre 1943).
Das Prinzip der Kontinuität sei, so Peirce weiter, »the idea of fallibilism objectified« (Collected Papers 1.171). Kontinuität, sagt Peirce, »is the very idea the mathematicians and physicists had been chiefly engaged in following out for three centuries« (Collected Papers 1.41) und es ist »the leading conception of science« (Collected Papers 1.62), schon deshalb, weil Verallgemeinerung das führende Ziel jeden wissenschaftlichen Nachdenkens darstellt.
Peirce hat dementsprechend, an Aristoteles anschließend, seine Philosophie auch Synechismus genannt. Synechismus, als metaphysische Theorie, impliziert die Vorstellung, dass das Universum als ein kontinuierliches Ganzes, ohne völlig getrennte und exakt bestimmte Teile, zu verstehen ist (vgl. Abschnitt I.12). Peirce sieht sich in seinem Synechismus Hegels Philosophie verwandt, moniert jedoch, dass Hegel den Bezug zwischen Mathematik und Kontinuität ignoriert habe. Was Hegel fehlt, wie insbesondere aus seiner Kritik der Mathematik in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes zu entnehmen ist, ist das Element des Zufalls.
Aus einer genetischen Perspektive heraus betrachtet ist der Zufall sogar das Erste und die Kontinuität das Fernere, während für Hegel die Kontinuität absolut und unweigerlich gegeben ist. Man müsste hier genauer werden und sehen, dass der Raum und das Kontinuum sowohl ein Erstes wie auch ein Drittes sein können. Der Raum ist einerseits eine Homogenität, die unsere Entscheidungen dem Zufall überlässt, weil sich kein weiterer Anhaltspunkt, keine Differenz und kein objektives Motiv als »zureichender Grund« anbietet, und er ist andererseits ein Drittes, welches unser Handeln und die gegenständliche Welt in ungefähren Einklang bringt.
Hegel nennt das Erste, wie oben zitiert, den Raum als »das Dasein, worin der Begriff seine Unterschiede einschreibt, als in ein leeres, totes Element«, während ihm die Kontinuität zur Wirklichkeit wird, in der dieses »tote Element« aufgehoben und verschwunden ist. Peirce betont dagegen die Permanenz und simultane Wirksamkeit aller drei Elemente. So kann Peirce dann sagen: »Meine Philosophie wiederbelebt Hegel, wenn auch in seltsamer Verkleidung« (Collected Papers 1.42). Noch verwandter fühlt er sich allerdings Schellings Naturphilosophie, so dass er an anderer Stelle sagen kann, seine Philosophie sei »Schellingism transformed in the light of modern physics« (Collected Papers 6.415).