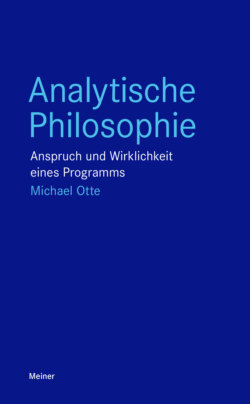Читать книгу Analytische Philosophie - Michael Otte - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.12
ОглавлениеDie Philosophie hatte sich seit ihrem platonischen Ursprung dem Problem der Wahrheit verschrieben. Die Philosophie Platons entsprang schließlich einem Skandal, nämlich Sokrates’ Verurteilung und Tod im Jahre 399 v. Chr. Sokrates war offensichtlich ein tugendhafter und weiser Mann gewesen, wie konnte das den Menschen in Athen verborgen geblieben sein? Und wie wären sie dahin zu bringen gewesen, die Wahrheit zu erkennen oder zu akzeptieren? Reichen dafür Logik und Konsistenzprinzip aus?
»Das klassische Griechenland, insbesondere Athen, stellt den paradigmatischen Fall einer Gesellschaft und Kultur dar, in der wir den äußerst folgenreichen Übergang von der Stammesgesellschaft zur Polis, von der Familie zu öffentlichen Institutionen, vom Partikularismus zum Universalismus in Wissenschaft und Philosophie beobachten können« (Nelson 1986, S. 83).
Und Jakob Burckhardt schreibt in der Einleitung zu seiner Vorlesung Griechische Kulturgeschichte, das Leben in Athen sei im Grunde eine »beständige Crisis mit beständigem Terrorismus« gewesen. Aus dieser völligen Anspannung ergebe sich der Wert dieser Polis als historisches Paradigma. Es handele sich um »eine Stätte wo die Erkenntnis reichlicher strömt als sonst, um einen Schlüssel, der hernach auch noch andere Türen öffnet, um eine Existenz, wo sich das Menschliche vielseitiger äußert«.
Den damit verbundenen Instabilitäten versucht der Platonismus zu begegnen, indem er den Gesetzen und Ideen Realität zuschreibt. Platons Reich der ewigen Formen und Ideen sieht sich dann permanent mit einer chaotischen und widerständigen Materie und den Instabilitäten des fluktuierenden menschlichen Bewusstseins konfrontiert. Das ist heute so aktuell wie eh und je.
Es sind also gesellschaftliche und politische Fragen gewesen, die bei Plato dazu geführt haben, eine Philosophie der Wahrheit zu entwickeln und dem subjektiven Idealismus und Relativismus der Sophisten seine objektiv-idealistische Philosophie entgegenzusetzen. Die Philosophen des Wiener Kreises und der analytischen Tradition haben sich gegen Idealismus und Romantik gewendet. Sie haben sich, aufgrund einer unhistorischen Platoninterpretation, allerdings eher auf der Seite der Sophisten gesehen.
Im Manifest des Wiener Kreises von 1929 wird der Ausspruch des vielleicht berühmtesten aller Sophisten, des Protagoras: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge« zitiert. In Philosophie und Wissenschaft führt das zur Austreibung der Ideen. Dazu heißt es im selben Text: »In der Wissenschaft gibt es keine Tiefen; überall ist Oberfläche. […] Alles ist dem Menschen zugänglich; und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Hier zeigt sich die Verwandtschaft mit den Sophisten, nicht mit den Platonikern« (Wissenschaftliche Weltaufauffassung. Wiener Kreis, hg. vom Verein Ernst Mach, Wien 1929, S. 305).
Hier wird das im obigen Marx-Zitat angesprochene Problem ganz deutlich. Sind die logischen Positivisten denn nicht direkt aus der »Bluturenge« in die »vollständige Entleerung« gefallen!? In der Tat, denn das Einschrumpfen der Wahrheitsmöglichkeiten auf Gegenstände, die mit intersubjektiver, zwanghafter Gewissheit festgestellt werden können, führt zur Subjektivierung der Zwecke und des Sinns. Dem stehen dann der nur formale Zusammenhang und die technokratische Organisation unverbunden zur Seite. Allerdings muss einem solchen Denken ein gemeinsamer sozialer Sinn und Zweck erst noch additiv angefügt werden, denn die Allgemeinheit der Ideen dient nicht nur der Erkenntnis und Theorieentwicklung, sondern verbindet uns schließlich auch mit der natürlichen und sozialen Welt.
»Der Mensch ist das Maß aller Dinge«. »Welcher Mensch?«, fragte schon Sokrates, um darauf hinzuweisen, dass ein derartiger Relativismus inkonsistent ist. Und der hypertrophe übertriebene Individualismus führt zur Herrschaft der »political correctness«. Alles soll logisch-technisch sein und »in der Wissenschaft gibt es keine Tiefen; überall ist Oberfläche«.
Dieser Verweis auf die verschwindende Tiefe charakterisiert den formalen Diskurs von Logik und Mathematik. Wenn ich P sage, dann meint das eben P! Churchman nennt dieses Verschwinden jeder »Tiefe« das »Prinzip der minimalen Runde« (the minimum loop principle). Es gleicht Hilberts Unmittelbarkeitsthese formaler Systeme: »Am Anfang ist das Zeichen« (D. Hilbert, Hilbertiana, Darmstadt 1964, S. 18), wobei mit Zeichen hier das indexikalische Zeichen, das x vom x, gemeint ist. »P ist wahr« meint dann eben »P ist wahr«. So als wiederholte der Logiker das, was bereits gesagt worden ist, immer und immer wieder: »›P ist wahr‹ ist wirklich wahr, wirklich wahr, wirklich wahr … usw.« Kurz, als wären Logik und Mathematik, wie die logischen Empiristen geglaubt haben, nichts als eine einzige Tautologie.
Churchman fragt: »Was stimmt damit nicht? Es wird lediglich ausgesagt, dass eine Behauptung ihre eigene Wahrheit reflektiert, ein wunderschöner Weg, die prosaischsten Dinge zu sagen, die uns einfallen. Was kann die Ausgeglichenheit logischer Perfektion stören? Nun ein Kreter kann es. Dieser Kreter – nennen wir ihn Epimenides – sagt, alle Kreter seien Lügner« (C.W. Churchman, Philosophie des Managements, Freiburg 1973, S. 126).
Und so etwas führt unweigerlich in den Abgrund der Paradoxie. Wenn wir dem Kreter nicht verbieten über sein eigenes Sprechen zu sprechen, enden wir in einem Paradox.
Das Problem der Paradoxien bringt dann das Prinzip der maximalen Runde ins Spiel. »Das Prinzip ist fantastisch. Es besagt, dass Selbstreflexion nur möglich ist, wenn man nach der längsten möglichen Reise zu sich selbst zurückkehrt. […] Das Prinzip der maximalen Runde wurde durch die Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts passend ausgedrückt: Die Notwendigkeit, in das Modell der Natur alles hineinzunehmen, was relevant erscheint […] Das Prinzip beruht auf einer monistischen Philosophie. […] Das Prinzip ist auch teleologisch. Damit der Geist sich selbst erkennt, muss er auch das Schicksal aller Geister wie aller Materien kennen. In der Tat ist dieses Prinzip geradewegs von Plato auf uns gekommen« (Churchman, a. a. O. S. 131 f.).
Die analytische Philosophie wird vor allem durch ihren Kampf gegen jedwede metaphysische Neigung zusammengehalten und sie grenzt sich scharf von der Phänomenologie und der dialektischen Philosophie mit ihren hermeneutischen Verfahrensweisen ab. Die phänomenologische Analyse, schreibt einer der Begründer des »Wiener Kreises«, Moritz Schlick, »führt umso mehr ins Uferlose, je strenger sie durchgeführt wird« (M. Schlick, Allgemeine Erkenntnislehre, 2. Auflage, Berlin 1925, S. 21).
Das ist wahr, denn niemals kann man die Analyse bis zu vorgeblich ersten Anfängen und absoluten Grundlagen vorantreiben. Im Begriff andererseits nichts als eine bloße instrumentelle Funktion zu sehen oder ein Zeichen, das nach formalen Regeln zu manipulieren ist, heißt ins andere Extrem eines positivistischen Operationalismus zu verfallen.
»Es gibt überhaupt keine Allgemeinvorstellungen […] Dieser Satz ist zuerst mit aller Schärfe von Berkeley ausgesprochen und seitdem zu einem bleibenden Besitz der Philosophie geworden. […] Es gibt gestreng genommen überhaupt keine Begriffe, wohl aber gibt es eine begriffliche Funktion […] Die erkenntnistheoretische Bedeutung der begrifflichen Funktion besteht im Bezeichnen. Begriffe sind Zeichen, denen aber nicht notwendig ein Gegenstand entspricht und deren Wirklichkeit in ihrer mentalen Funktion zu suchen ist« (M. Schlick, a. a. O., S. 19 ff.).
Konsequenterweise müsste man dann auch sagen, es gäbe keine Fakten, auch sie sind bloße Instrumente oder Funktionen (vgl. die obige Diskussion). Also kommen wir in die Lage, dass Dinge und Zeichen, Einzelnes und Allgemeines usw. alles in sich zusammenfällt. Schlick ist zu einer solchen Auffassung durch die Betrachtung von Hilberts »Grundlagen der Geometrie« (1899) gelangt. Er schreibt: »Als die Mathematiker zu der Einsicht gelangt waren, dass die elementarsten geometrischen Begriffe, wie etwa der des Punktes oder der Geraden, nicht eigentlich definierbar sind, das heißt in noch einfachere Begriffe auflösbar, beruhigten sie sich zuerst dabei, weil die Bedeutung dieser Begriffe in der Anschauung mit so großer Deutlichkeit gegeben war, dass es schien, als könne die Gültigkeit der geometrischen Axiome aus ihr ohne weiteres mit vollkommener Sicherheit abgelesen werden. Der neueren Mathematik aber genügte der Hinweis auf die Anschauung nicht« (M. Schlick 1925, S. 49 ff.).
Um also einerseits dem infiniten Regress, in den der Versuch des erschöpfenden Definierens notwendigerweise führt, zu entgehen und andererseits die Unsicherheit zu vermeiden, die in der anschaulichen Begründung der Geometrie zu liegen schien, beschritten nun, wie Schlick schreibt, »die Mathematiker einen Weg, der für die Erkenntnistheorie von höchster Bedeutung ist. Nachdem manche Vorarbeit geleistet war, hat es David Hilbert unternommen, die Geometrie auf einem Fundament aufzubauen, dessen absolute Sicherheit nirgends durch Berufung auf die Anschauung gefährdet wird« (a. a. O., S. 50).
Schlick beschreibt diese Errungenschaft als eine Besinnung auf die »reale begriffliche Funktion im Rahmen der wissenschaftlichen Denkarbeit«. Da die begriffliche Funktion aber, so Schlick weiter, im Schließen besteht, werden von den begrifflichen Eigenschaften keine anderen gebraucht als die, »dass gewisse Urteile von ihnen gelten (z. B. von den Grundbegriffen der Geometrie die Axiome)« (a. a. O., S. 51). Wir hatten diese Form des Sinns in formalen Kontexten bereits oben am Beispiel des Aufkommens der symbolischen Algebra angesprochen (vgl. I.2.).
Die Frage, die sich hier nun stellt, ist, wie man das mathematische Schließen versteht. Für Peirce oder Kant beruht mathematisches Schließen auf der Konstruktion und Modifikation von Diagrammen, und dadurch kommt ein bildliches und intuitives Element in die Mathematik. Und da alle Erkenntnis auf Anschauung und Wahrnehmung beruht, besitzt auch die Mathematik einen Inhalt, selbst wenn derselbe nur idealer Natur ist.
Im sogenannten klassischen Zeitalter (Foucault), d. h. in der Periode von Descartes bis auf Kant, bedeutete die Natur zu verstehen, sie darzustellen, nicht mehr sie zu interpretieren oder zu entziffern. Und das Ordnen mit Hilfe der Zeichen bewirkt »die Konstitution allen empirischen Wissens als Wissensgebiete der Identität und des Unterschieds« (M. Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt 1974, S. 91). Kants »kopernikanische Wende der Epistemologie« hat das ausgedrückt und hat das Gegenständliche zu einer Konsequenz der Objektivität des Subjektiven gemacht. Im 19. Jahrhundert sollte dann auch die Mathematik begrifflich werden, anstatt weiter zugleich anschaulich und rechnerisch zu sein, und wir treten ein in ein Zeitalter der reinen und analytischen Mathematik.
Der Begriff des Analytischen, wie er in Prädikaten wie »analytische Philosophie« oder in Behauptungen wie »die Mathematik ist eine rein analytische Wissenschaft« auftritt, hat es zunächst weniger mit Analyse im klassischen Sinne oder mit einer analytischen Methode zu tun, sondern eher mit dem, was analysiert werden soll, mit dem Theoretischen nämlich. Es ist Kant gewesen, der diese neue Auffassung der Unterscheidung des Analytischen und Synthetischen in den Blickpunkt gerückt hat. Das Revolutionäre daran war eine neue Begriffsauffassung und eine damit verbundene Verselbstständigung von Sinn und Bedeutung gegeneinander. Aus der Analyse der damit verbundenen Probleme ist, lange bevor Frege die Unterscheidung von Sinn und Bedeutung unter Logikern populär gemacht hat, die neue Logik und die analytische Philosophie hervorgegangen (Bolzanos monumentale »Wissenschaftslehre« bedeutete hier einen sehr wichtigen Schritt (vgl. Kapitel IV.)!).