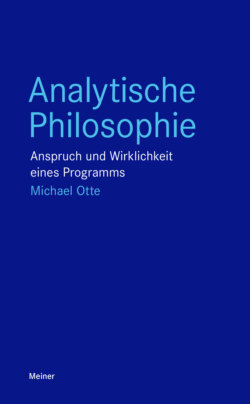Читать книгу Analytische Philosophie - Michael Otte - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.2
ОглавлениеRichard Rorty, aus der Schule der analytischen Philosophie hervorgegangen, ein Romantiker, der nach eigenem Bekunden den Stammvater der modernen Logik und einen der Urheber der analytischen Philosophie, Gottlob Frege, weder versteht noch verstehen will, gilt vielen als der wichtigste Vertreter der amerikanischen Gegenwartsphilosophie überhaupt und »Der Spiegel der Natur« ist Richard Rortys berühmtestes Werk. Darin hat Rorty den Entwicklungsgang seiner eigenen Disziplin seit dem 17. Jahrhundert kritisiert und folgendermaßen skizziert: »Die Überlegung, es gäbe eine autonome Disziplin namens Philosophie, die sich von Wissenschaft und Religion unterscheide und über beide zu Gericht sitze, ist ganz neuen Ursprungs. […] Im Rückblick sehen wir, dass Descartes und Hobbes mit der ›modernen Philosophie‹ begonnen hatten« (R. Rorty, Der Spiegel der Natur, Frankfurt 1984, S. 149).
Die Protagonisten der Philosophie des 17. Jahrhunderts selbst verstanden sich allerdings in enger Verbindung zu den neuen Wissenschaften und deren Entwicklung. Sie wollten »zum Aufblühen der Forschung in den Gebieten der Mathematik und der Mechanik« beitragen. »Erst mit Kant bürgerte sich unsere moderne Unterscheidung von Philosophie und Wissenschaft ein« (Rorty, a. a. O., S. 150). Rorty schreibt die Abgrenzung der Philosophie von den Wissenschaften Kants Konzentration auf die Erkenntnistheorie zu. Tatsächlich hatte Kant die Philosophie einerseits und Mathematik und exakte Naturwissenschaft andererseits durch ihre Erkenntnisweisen strikt unterschieden. Kant schreibt:
»Die philosophische Erkenntnis ist die Vernunfterkenntnis aus Begriffen, die mathematische aus der Konstruktion der Begriffe. […] In dieser Form besteht also der wesentliche Unterschied dieser beiden Arten der Vernunfterkenntnis, und beruht nicht auf dem Unterschied ihrer Materie, oder Gegenstände. Diejenigen, welche Philosophie von Mathematik dadurch zu unterscheiden vermeinten, dass sie von jener sagten, sie habe bloß die Qualität, diese aber nur die Quantität zum Objekt, haben die Wirkung für die Ursache genommen. Die Form der mathematischen Erkenntnis ist die Ursache, dass diese lediglich auf Quanta gehen kann. Denn nur der Begriff von Größen lässt sich konstruieren, d. i. a priori in der Anschauung darlegen« (KdrV B 742).
Deutlicher noch als in Kants an Newton angelehnten Vorstellungen exakter Wissenschaft zeigt sich das Problem des Begrifflichen (der Bedeutung) in der neuen symbolischen Algebra. Jacob Klein beginnt seine grundlegende, in Beziehung zu Husserls Krisis der europäischen Wissenschaften (1936) entstandene historische Studie Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra mit den folgenden Worten: »Für die Konstitution der modernen mathematischen Naturwissenschaft ist die Schöpfung der mathematischen Formelsprache von entscheidender Bedeutung gewesen. Sieht man in dieser symbolischen Darstellung ein bloßes Hilfsmittel, dessen sich die Naturerkenntnis bedient, um ihre Einsichten in möglichst einfacher und genauer Weise auszudrücken, so verkennt man wohl den Sinn dieser Symbolik als auch die spezifischen Methoden der naturwissenschaftlichen Disziplinen überhaupt« (J. Klein 1934/1936, »Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra«, in: Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Band 3, Heft 1 und 2, S. 18).
Wenn wir uns fragen, was Klein meint, ist es sinnvoll, sich Foucaults Charakterisierung der Zeit der wissenschaftlichen Revolution als einen Übergang vom Zeitalter der Interpretation zu dem der Zeichen und Darstellungen zu vergegenwärtigen, denn sowohl Kants Epistemologie wie auch die analytische Philosophie haben ihren Ursprung in dem kategorialen Unterschied zwischen Zeichen (Universalien) und Einzeldingen. Foucault schreibt: »An der Schwelle des klassischen Zeitalters hört das Zeichen auf, eine Gestalt der Welt zu sein, und es ist nicht länger mit dem verbunden, was es durch die festen und geheimnisvollen Bänder der Ähnlichkeit und der Affinität markiert« (»Au seuil de l’Age classique le signe cesse d’être une figure du monde; et il cesse d’être lie à ce qu’il marque par les liens solides et secrets de la ressemblance ou de l’affinité«) (M. Foucault, Les Mots es les Choses, Paris 1966, Kapitel III; Die Ordnung der Dinge, Frankfurt 1974, S. 92).
Und Quine drückt dieselbe Entwicklung aus, indem er sagt: »Für Aristoteles hatten die Dinge ein Wesen, doch nur sprachliche Formen haben Bedeutungen. Bedeutung ist das, wozu das Wesen wird, wenn es vom Referenzobjekt losgemacht und dem Wort verbunden wird.« (W. V. O. Quine, »Zwei Dogmen des Empirismus«, in: ders., Von einem logischen Standpunkt, Frankfurt 1979, S. 29). Vor der wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts bedeutete eine Sache zu kennen ihr Wesen zu kennen, seither geht es darum, eine angemessene mathematische oder sprachliche Form zu finden.
Jedes Zeichen und jede Darstellung besteht offensichtlich aus mindestens drei Elementen: den konkreten Zeichen, ihren Bedeutungen (ihrem Sinn) und ihren referentiellen Bezügen, ihren Gegenständen. Seit Aristoteles’ De Interpretatione und dem darin präsentierten berühmten semiotischen Dreieck, in dem die Worte einerseits mit den Dingen und andererseits mit deren Bildern oder Ideen in der Seele verbunden werden, gibt es zahllose unterschiedliche Neuauflagen dieses Bedeutungsdreiecks (vgl. U. Eco, Da Arvore ao Labirinto, Rio de Janeiro 2013; C. K. Ogden/I. A. Richards, The Meaning of Meaning, Cambridge 1923). Und was Jacob Klein meint und Foucault oder Quine andeuten, läuft auf eine Verschiebung von der mehr oder minder engen Beziehung zwischen Bedeutung (Idee) und Gegenstand, oder dem Gegenstand und seinem Wesen, zu einer neuen Bindung der Bedeutung an das Zeichen, an den Zeichenausdruck hinaus.
Im Mittelalter und in der Renaissance basierte die Erziehung auf dem Trivium (Logik, Grammatik und Rhetorik), das wiederum auf dem Werk des Aristoteles beruhte. Abaelards aus dem Studium von Aristoteles und anderen Quellen hervorgegangene Schrift Sic et non (ca. 1121) legt den Grundstein für eine Hochblüte der mittelalterlichen Philosophie und Logik, den wesentlichen Instrumenten für die Auslegung der Heiligen Schrift. Aristoteles wird tatsächlich meist als der große Vertreter einer Logik angesehen, die auf der Annahme der Möglichkeit klarer Divisionen und strenger Klassifizierungen beruht (und Abaelard ist unter allen mittelalterlichen Philosophen derjenige, der die »Sensibilität der heutigen analytischen Philosophen am meisten anspricht« (J. E. Brower/K. Guilfoy, The Cambridge Companion to Abelard, Cambridge 2004, p. 2).
»But this is only half the story about Aristotle; and it is questionable whether it is the more important half. For it is equally true that he first suggested the limitations and dangers of classification, and the non-conformity of nature to those sharp divisions which are so indispensable for language […]« (Lovejoy, The Great Chain of Being, Harvard 1964, p. 58).
Seitdem erleben wir die Bedeutung dieser Dualität oder Komplementarität zwischen dem Prinzip der Identität, das die Logik beherrscht, und dem Prinzip der Kontinuität, das für die Analyse und Erforschung der Natur so bedeutsam ist. Seit dem 16./17. Jahrhundert hat sie sich zu einer Dichotomie gesteigert, weil eben die Naturerforschung mit mathematischen Mitteln nun in den Vordergrund rückte. Dies geschah jedoch im Geiste Platons. Leibniz, dessen Werk, wie Foucault schreibt, im Zentrum des Geistes des neuen Zeitalters stehe, verstand sich als ein Beförderer der Philosophie Platons. Und eben dasselbe wird Galileo nachgesagt. Galilei redete vom Großen Buch der Natur, das in geometrischen Figuren geschrieben sei, was die Text-Metapher schon entwertet; denn es ergibt sich, dass die Entzifferung dieses Buches, wegen seines mathematischen Charakters, sehr spezielle Kenntnisse und Abrichtungen erfordert. Galilei betont die Differenz zwischen Natur und Text insbesondere in seinem Brief an B. Castelli vom Dezember 1613, in dem er darauf hinweist, dass das Buch der Natur nicht, wie die Heilige Schrift, auf das Fassungsvermögen der Menschen Rücksicht zu nehmen braucht.
Die Bedeutung, der Begriff oder die Idee ist nicht mehr in erster Linie ein Bild des Gegenstandes, sondern seine Quelle. Mathematisierung bedeutet Platonismus; die mathematischen Gegenstände haben schließlich kein empirisches Dasein und keinen phänomenalen Charakter. »It is obvious that for the disciples of Galileo just as for his contemporaries and elders mathematicism means Platonism« (A. Koyre 1943, »Galileo and Plato«, in: Journal of the History of Ideas, Vol. 4, pp. 400–428, p. 424).
Hinzu tritt die operative Wendung der Mathematik durch die symbolische Algebra. Die Bedeutung einer algebraischen Gleichung liegt im Rechnen und in den transformierten Gleichungen und die eines Systems formaler Axiome in dessen logischen Konsequenzen. Dass es um den Sinn der mathematischen Zeichen ging, zeigt sich auch in der Konzentration auf die Eigenschaften der Operationen unabhängig von den Eigenschaften der Objekte, auf die diese angewandt wurden. Beispielsweise transferierte Descartes in seiner sogenannten »analytischen« Geometrie die arithmetische Struktur auf das Operieren mit geometrischen Segmenten.
Die klassische aristotelische Logik war andererseits eine Logik des Begriffs und des Satzes, und der Begriff war nichts anderes als eine Art Bild der Substanz und der Satz ein Bild des Sachverhalts, während die Mathematik zunehmend von den Vorstellungen der Relation und der Funktion oder der funktionalen Beziehung bestimmt wurde. Ernst Cassirer hat, von Kant ausgehend, in seinem philosophischen Resümee der Wissenschaftsgeschichte Substanzbegriff und Funktionsbegriff (Berlin 1910) die Entwicklung des Begriffs als das eigentlich Neue und Revolutionäre hervorgehoben. Die klassische Logik, so Cassirer, »bleibt an den Gesichtspunkt der Substanz und somit an die Grundform des Urteils der Prädikation gebunden, während das lebendige wissenschaftliche Denken immer deutlicher auf den Funktionsbegriff als seinen eigentlichen systematischen Mittelpunkt hinzielt« (Cassirer 1910, S. 7; vgl. Kapitel V).
Kants Betonung der Differenz zwischen philosophischer und mathematischer Methode ist also nichts anderes als ein Ausdruck dieser Dichotomie im klassischen Rationalitätstypus. Der entscheidende Punkt an Kant ist die Betonung des aktiv-tätigen Charakters der Erkenntnis, und damit verbunden die Behauptung einer prinzipiellen und kategorialen Differenz zwischen Theorie und Realität. Noch bei Galilei und Descartes oder Leibniz scheint hier nur ein gradueller Unterschied, eine Differenz in der Klarheit und Deutlichkeit gegeben zu sein. Bis zum 16./17. Jahrhundert beruhte das Denken auf einem aus Instinkt und Tradition geborenen Gefühl für Kontinuitäten und Ähnlichkeiten, und die Begriffe standen in keiner oder in nur gradueller Differenz zu den Dingen.
Der Leibniz’sche Begriff ist darauf angelegt, die Substanzen nach den, wie Foucault sagt, »degres le plus faibles« (M. Foucault, Les Mots Et Les Choses, Paris 1966, p. 67) zu vergleichen und zu ordnen – denn, wie Leibniz sagt: natura non facit saltus –, während die Mathematik und insbesondere der algebraische Kalkül auf dem Prinzip von Identität und Differenz aufgebaut sein muss. Das gibt Deutlichkeit und Sicherheit und führt dazu, die Kontinuitäten zu etwas Idealem oder Geistigem zu machen, von dem man nichts-destotrotz wenig deutliche Vorstellungen entwickeln konnte – wer wollte schon mit »infinitesimalen« Größen etwas zu tun haben. So standen sich im Rahmen von Leibniz’ Philosophie das Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren und das Kontinuitätsprinzip als die beiden Grundprinzipien ziemlich unvermittelt gegenüber (M. Gueroult, Raum, Zeit, Kontinuität und Principium indiscernibilium, Studia Leibnitiana, Sonderheft 1, 1963), und sie mussten durch Gottes Fähigkeiten zur unendlichen Analyse miteinander in Einklang gebracht werden.
»Leibniz making proof a matter of ontology not methodology, asserts that all true propositions have an a priori proof, although in general human beings cannot make those proofs, because of the infinity of the analysis required« (I. Hacking, »Leibniz and Descartes: Proof and Eternal Truths«, in: T. Honderich (ed.), Philosophy Through its Past, Harmondsworth 1984, pp. 207–224, p. 221).
So konnte es nur der philosophische Nominalismus sein, der den Begriffen, Ideen und Kontinuitäten eine bloß ideale oder sogar eine bloß mentale Realität zubilligte, der hier schließlich vorangehen und weiterhelfen konnte. Schließlich erschien diese Differenz zwischen dem Distinkten und Kontinuierlichen in Kants »zwei Grundquellen des Gemüts«, Begriff und Anschauung, aufgehoben. Und das mathematische Denken sollte sich, anders als die Logik, bei der »der Verstand es mit nichts weiter, als sich selbst und seiner Form zu tun hat« (KdrV B VIII), aus beiden Quellen speisen.
Mit der industriellen Revolution und der Verwandlung des Wissens in ein gesellschaftliches Datum interessierte die Erkenntnistheorie und der ganze »context of discovery«, dem sie angehört, nicht mehr und er wurde zur Seite geschoben, zugunsten einer Konzentration auf den »context of justification«. Und hier dominierten dann Probleme der Logik und der Wissenschaftstheorie, und Kants Verweis auf die Intuition oder Anschauung als einer essentiellen Quelle der Erkenntnis erschien als obsolet. Entgegen Rortys Vorstellungen war es also gerade nicht die Erkenntnistheorie, die zur Ausweitung des philosophischen Denkens in der Nachfolge Kants geführt hat, sondern die Ausweitung und Transformation des Logischen (J. MacFarlane 2002, »Frege, Kant, and the Logic of Logicism«, in: The Philosophical Review, vol. 111, pp. 25–61).