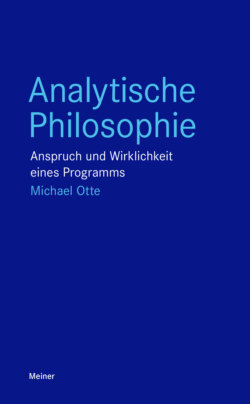Читать книгу Analytische Philosophie - Michael Otte - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.6
ОглавлениеEs ist die Philosophie, d. h. die Weltanschauung oder das Paradigma, welches den Unterschied macht, nicht allein die Methode. Wenn etwa Monets Morgenansicht von Le Havre (1872) als Ursprung des Impressionismus angesehen wird, dann muss so etwas wie die Idee des impressionistischen Stils im philosophischen Denken vorbereitet sein. Zugleich existiert der Stil natürlich nicht unabhängig von der Gesamtheit der Werke.
Thomas Kuhns Buch »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« (1962) ist das sicherlich berühmteste wissenschaftsphilosophische Werk der letzten fünfzig Jahre, und obwohl darin der wissenschaftliche Instrumentalismus einen sehr prägnanten Ausdruck gefunden hat, muss man doch sehen, dass die Dualität von Paradigma und instrumenteller Begriffsauffassung zusammen seine Grundlage bilden. Kuhns Werk kann einerseits vielleicht am ehesten als wissenschaftsphilosophischer Ausdruck der durch den zweiten Weltkrieg verursachten Umwälzungen in den theoretischen Wissenschaften verstanden werden, die sich nicht zuletzt im Erscheinen neuer Anwendungsgebiete wie der Kybernetik, der Informationstheorie, der Spieltheorie, der Operations Research und der Systemanalyse zeigten.
Andererseits beschreibt Thomas Kuhn selbst (in der Einleitung zu The Essential Tension, Chicago 1977), wie er, als er 1947 daran ging, eine Einführung in die Geschichte der Physik ausgehend von Aristoteles’ Werk zu geben, ganz plötzlich verstanden hatte, dass die Wissenschaftler der verschiedenen historischen Epochen in radikal unterschiedlichen »Welten« lebten, so dass es sinnlos wird, Aristoteles aus der Sicht von heute oder der des 17. Jahrhundert zu kritisieren. Daraus hat Thomas Kuhn die Einsicht gewonnen, dass sich alle Erkenntnis innerhalb einer Welt und als Teil einer Weltsicht, eines Paradigmas entwickelt.
Die wichtigsten bzw. naheliegendsten und effektivsten Kontexte oder Paradigmen stellen Theorien selbst dar, und dies hat ja gerade den Aufschwung der analytischen Philosophie produziert. Ein formallogischer Beweis funktioniert nur als Teil eines formaltheoretischen Systems. Daher hatte Bolzano zwischen Beweisen, die »objektive Begründungen« sind, und solchen, die bloße subjektive »Gewissmachungen« darstellen, unterschieden (Wissenschaftslehre § 525).
Den vielleicht deutlichsten Ausdruck dieser Entwicklung bezüglich der Mathematik und der Logik ergibt die sich langsam herausstellende Bedeutsamkeit sogenannter »Unmöglichkeitsbeweise«. Bevor man daran ging, ein mathematisches Problem zu lösen, fragte man sich, ob es mit den vorgegebenen Mitteln überhaupt lösbar war. So wie man, bevor man ein Gebrauchsgut industriell produziert, sich der Mittel dafür vergegenwärtigt, ebenso beginnt die mathematische Reflexion sich zu fragen, was nötig und Voraussetzung dafür ist, um ein bestimmtes Resultat zu erzielen. Es ist ein Merkmal der modernen Mathematik, Probleme zu lösen bzw. ihre Unlösbarkeit zu zeigen, indem man einen gesamten theoretischen Kontext zum Gegenstand nimmt. Mathematik transformiert sich, wie eingangs gesagt, zur Meta-Mathematik.
Die Entwicklung ging langsam voran, von den algebraischen und geometrischen Unmöglichkeitsbeweisen von N. Abel (1821) und P. L. Wantzel (1836) zu Anfang des 19. Jahrhunderts zu den berühmten Unvollständigkeits-Theoremen Gödels etwa 100 Jahre danach. Die Argumentation im Beweis von Gödel beruht schließlich genau darauf, dass die Mathematik als Meta-Mathematik reflexiv auf sich selbst angewendet wird. Alle Unmöglichkeitsbeweise operieren mit einer Formalisierung, welche die Form selbst wiederum zum Gegenstand von Analyse und Reflexion macht.
Das vielleicht wichtigste Problem besteht also darin, nicht die Speisekarte mit dem Cordon bleu zu verwechseln. »Dies ist keine Pfeife«, schrieb René Magritte 1928 unter sein Bild einer Pfeife. Bilder, Kunstwerke, Theorien sind zunächst einmal Formen, sind Realitäten sui generis. Die Theorie ist nicht die Wirklichkeit, die Landkarte ist nicht die Landschaft, die Speisekarte ersetzt nicht das Mahl und eine Zeichnung des toten Marat im Bade ist nichts als ein paar Graphitstäubchen auf weißem Papier, so eindrücklich das auch sein mag. Andrerseits verletzt das Konzept des Wissens als Meta-Wissen diese Regeln gerade.
Dahinter steckt dann ein philosophisches Problem, weil Kontexte zu respektieren sind und kategoriale Bestimmungen eingehalten werden müssen – das Bild der Pfeife ist keine Pfeife (Magritte) – und andererseits nicht eingehalten werden können, insofern das Subjekt selbst ein Teil des fraglichen Kontextes ist. Selbst Russells typentheoretische Verbote der Logik können nicht allgemein verbindlich sein, ja sie können gar nicht konstatiert werden, ohne dass man sie verletzt, weil sie widersprüchliche Anforderungen implizieren. Weil wir Wesen sind, die sich durch ihre eigene Tätigkeit fortentwickeln, muss die Typenregel verletzt werden. Wir haben schließlich keinen expliziten Plan unserer Geschichte zur Verfügung und finden unsere Begriffe nicht einfach vor. Weil wir aber der Fortentwicklung nicht entrinnen können und doch unsere menschliche Subjektivität erhalten müssen, muss die Typenregel formuliert und respektiert werden, andernfalls wären wir bloße kontingente Produkte der Entwicklung. Wir denken in Begriffen, und Begriffe sind von einem anderen logischen Typus als die Dinge, auf die sie referieren.
Wie Bateson sagt: »It would be bad natural history to expect the mental processes and communicative habits of mammals to conform to the logician’s ideal. Indeed, if human thought and communication always conformed to the ideal, Russell would not, in fact, could not have formulated the ideal« (G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind, Chicago 1972, p. 178).
Paradoxerweise haben sowohl Vertreter wie Kritiker der analytischen Philosophie, wie etwa Richard Rorty, genau letzteres geglaubt und haben den Reduktionismus des Subjekts auf eine Art »Maschine« ins Feld geführt, um den Sinn jedweder ersten Philosophie zu negieren und der totalen Kontingenz das Wort zu reden. Das ist lehrreich!
Nun sind tatsächlich Instrumentalismus und Realismus kaum zu unterscheiden, solange man am Erkenntnisfortschritt arbeitet und die Realität eben nicht als ein statisches Außen, sondern selbst als Vermittlung von Geist und Materie versteht. Dennoch bleiben die einen eher an subjektiven Zielen und epistemologischen Beziehungen interessiert und die anderen an objektiven Sachverhalten und deren Erklärungen, bzw. Wahrheiten (D. Deutsch, The Beginning of Infinity, N.Y. 2011, Kapitel I.). Und die jeweiligen Gewichtungen verschieben sich von Disziplin zu Disziplin. Die Physiker, beispielsweise, sind eher Realisten, die Chemiker oder Ökonomen eher Instrumentalisten. Wiederum ist die Beziehung oder Dualität von Instrumentalismus und Realismus das Interessantere gegenüber den Polaritäten.