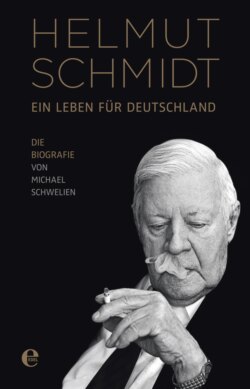Читать книгу Helmut Schmidt - Ein Leben für Deutschland - Michael Schwelien - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nachruf
ОглавлениеMan will es immer noch nicht glauben. Helmut Schmidt ist tot.
Man sieht den Altkanzler noch vor sich: die zuletzt schlohweißen Haare, die ewige Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand, der Rauch, der aus seinem Mund quillt und wie ein Herbstnebel an seinem Kopf empor steigt.
Zuletzt war diese Hand ohne Ringe.
Noch im Jahr 2010 trug er seinen Ehering am Ringfinger der Linken, auf dem Zeigefinger steckte der Ehering seiner vor ihm – am 21. Oktober 2010 – verstorbenen, geliebten Frau Hannelore Schmidt, genannt Loki. Das erste Mal hatten sie sich geküsst, als sie 15 Jahre alt war, also 1934. Da war Hitler schon an der Macht. Und die beiden gingen noch zur Schule in Hamburg.
Ein letztes gemeinsames Interview hatten sie im März 2009 gegeben. Da waren sie schon 66 Jahre verheiratet und 80 Jahre ein Paar. Sie wirkte in dem Interview weitaus quirliger als er. Es ging um ihre Beziehung. Sie redete viel, er nickte nur, stützte sich auf seinen Stock, stimmte ihr jedoch öfters mit kräftigem »Ja« zu – und rauchte.
Bis sie sagte: »Ich möchte, dass wir beide gemeinsam davongehen.«
Worauf er widersprach: »Das hast du nicht zu bestimmen!«
Sie streichelte ihm zärtlich über die linke Hand, erzählte, wie sie dereinst andere Schüler verteidigt hatte, nur ihn nicht. Das hätte er nicht nötig gehabt, denn, so sagte sie, »der hatte, Gott sei Dank, schon so lange ich erinnere, ein ›bewegliches Mundwerk‹, der konnte sich also mit Worten verteidigen.«
Sie ging dann doch ein gutes Jahr später alleine »davon«, also viereinhalb Jahre vor ihm. So eng waren die beiden, dass man schon damals, 2010, befürchten musste, er werde ihr alsbald folgen, ebenfalls »davongehen«. Das hat er dann auch selber so gesagt. Er fühlte sich einsam ohne Loki, so einsam, dass er selber glaubte, er müsse auch bald sterben.
Dass er dennoch einige Jahre weiterlebte, hätte er der Tatsache zu verdanken gehabt, dass er in seiner ehemaligen Sekretärin Ruth Loah – er war zu diesem Zeitpunkt 92-jährig, sie fast 80 Jahre alt – eine neue »Lebensgefährtin« gefunden hatte, worauf er beide Eheringe, den seiner Frau und den eigenen, ablegte.
Als diese Ruth Loah, die weiterhin in einem Altersheim an der Elbe wohnen blieb, nun am 9. November 2015 zu ihm ans Krankenbett in seinem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn eilte, als auch seine 67-jährige Tochter Susanne Schmidt aus London zu ihm gekommen war, als sein Leibarzt Heiner Greten meinte, »die Lage ist außerordentlich prekär«, da wusste man wohl: Das Ende war nah.
Glauben wollte man es gleichwohl nicht. Zwar hatte der Arzt von Helmut Schmidt auf die Frage, ob sich der Altkanzler noch erholen werde, gesagt: »Nein, das glaube ich leider nicht.« Und Professor Greten musste auch bestätigen, dass Helmut Schmidt schon zu diesem Zeitpunkt nur noch sehr selten bei Bewusstsein war, dass sich seit Sonnabend, 7. November 2015 sein Zustand »kontinuierlich und dramatisch verschlechtert«, dass Schmidt in den folgenden Tagen »bewusste Phasen« nur noch »ab und zu« erlebt hätte.
Aber glauben, dass er nun auch »davongehen« musste, das wollte man einfach nicht.
Der Arzt Heiner Greten hatte gesagt, eigentlich müsste Schmidt ins Krankenhaus verlegt werden. Aber: »Allerdings ist es sein Wunsch und der seiner Familie, dass er daheim bleibt, in seinem vertrauten Umfeld.« Der Herzspezialist hatte überdies betont, er sei in Absprache mit Schmidts Tochter Susanne befugt, Auskunft zu geben, ohne die ärztliche Schweigepflicht zu verletzen: »Die Familie akzeptiert das große Interesse der Öffentlichkeit am Wohle Helmut Schmidts und freut sich über die Anteilnahme der Hamburger.« Er glaubte auch selber nicht, dass am Ende eine Versorgung im Krankenhaus besser gewesen wäre. Ein ruhiger Tod, daheim also, im Kreise seiner Lieben.
Und doch sah man Deutschlands beliebtesten Politiker weiterhin vor sich. Hörte man ihn, wie es seine Art war, leise seufzen, hört man dann seine geschliffenen Kommentare zu allem und jedem, vernahm man, was er bis zuletzt »noch zu sagen« hatte, nämlich: zu China, zum Atomausstieg, zum Ukraine-Konflikt, zur Eurokrise, zu Pegida. Er hatte zu allem eine Meinung – und gab diese auch zum Besten, wiewohl ihm das immer schwerer gefallen ist.
Und so hört man ihm auch über seinen Tod hinaus zu. Viele glauben ihn zu kennen. Und doch kannte niemand ihn richtig, außer vielleicht seine Frau Loki, seine Tochter Susanne und seine »Lebensgefährtin« Ruth Loah. Denn Schmidt, der bis ins beinahe biblische Alter von 96 Jahren sein »bewegliches Mundwerk« beibehielt, schwieg beharrlich, wenn es um sein Privatlebeben oder um seine Gedanken außerhalb der Politik ging.
Er wollte nämlich kein »Vorbild«, er wollte lediglich ein vorbildlicher Politiker sein.
Und das, so konnte man schon vor seinem Tode sagen, und so sahen es Millionen Deutsche und viele im Ausland, das war er wirklich: ein vorbildlicher Politiker – für Deutschland und die Welt.
Bis zuletzt genoss Helmut Schmidt eine geradezu übermenschliche körperliche Konstitution. Über das Altern sagte er, es sei unvermeidlich, von Krankheiten befallen zu werden, »wünschenswert« sei jedoch »die Schmerzfreiheit«.
Im Gespräch mit mir brach es einmal aus ihm heraus. Auf seine unvergleichlich direkte Art sagte er: »Glauben Sie ja nicht, das irgendetwas am Altwerden schön ist, es ist nur scheiße !«
Zwar benötigte er seit Jahren einen Rollstuhl. Aber er war bis fast zuletzt noch recht kräftig – trotz seiner ständigen Zigarettenqualmerei.
Hätte er nicht ein Leben lang geraucht, hätte er wahrscheinlich sogar noch ein paar Jahre länger leben können. Er starb am Ende auch an den Folgen des die Lungen und das Herz schädigenden Nikotins, das überall im Körper Metastasen sowie Krebsgeschwüre erzeugt und womöglich sogar die Infektion, die ihn zuletzt befiel.
Ohne es zu wollen, war er zum Vorbild, ja zur Ikone aller Raucher geworden.
»Schauen Sie doch mal, der Schmidt raucht doch auch wie ein Schlot, und jetzt ist er – ja, wie alt genau eigentlich? – 95 Jahre doch bestimmt schon geworden.«
Solche Worte hörte man von jedem zweiten Raucher. Ihnen diente die Sucht des Ex-Kanzlers als Legitimation und zur Verharmlosung ihrer eigenen Sucht. So wie jeder Raucher einen entfernten Onkel hat, der »zwei Schachteln am Tag qualmte und trotzdem über 95 Jahre alt geworden ist«, so hat die Gemeinschaft der Nikotin-Junkies ihren vorbildlich rauchenden Ex-Bundeskanzler.
Dieser war zwar längst aus der Politik ausgeschieden. Aber er war immer noch schlagfertig und auf allen Themengebieten bewandert – und hatte immer eine Kippe in der Hand.
»Der darf sich sogar bei Günther Jauch in der Talkshow eine anstecken«, wusste jeder, »für den Schmidt werden extra Aschenbecher aufgestellt und die feuerpolizeilichen Vorschriften außer Kraft gesetzt.«
So ganz stimmte das freilich auch nicht. Zwar wurden bei vielen TV-Auftritten von Helmut Schmidt Sonderregelungen getroffen und die feuerpolizeilichen Vorschriften wurden ausnahmsweise mal nicht ganz so streng genommen. Einmal, nach einer Veranstaltung im Hamburger Winterhuder Fährhaus, wurde er aber, da er rauchte und damit gegen ein Gesetz verstieß – »nicht meine Absicht« –, von einer Nichtraucherinitiative wegen Körperverletzung angezeigt.
Schmidt wähnte sich indes auch hier völlig schuldlos: »Die Theaterleitung hatte mir ein Tischchen vor den Stuhl gestellt mit einem Aschenbecher und einer Tasse Kaffee. Natürlich habe ich davon Gebrauch gemacht, meine Frau auch, wir haben uns überhaupt nichts dabei gedacht.« Juristisch geschickt unterschied er in diesem Fall zwischen einem bewussten Gesetzesbruch und einer fahrlässigen Handlung, indem er spitzfindig hinzufügte: »Und daraus haben andere einen bewussten Verstoß gegen das Gesetz gemacht.« Im Übrigen gelte auch für ihn: »Dem Gesetz muss man gehorchen!« Über die Strafanzeige indes »haben wir gelacht«.
Was könnte man sich mehr wünschen als einen Politiker, der einen durch sein Vorbild von der Schuld an seinem Laster freispricht?
Schmidt selber kokettierte mit seiner Sucht. Als er mit 15 Jahren anfing, gab es »diese Hysterie noch nicht«. Zu mir sagte er jedes Mal, wenn ich verzweifelt versuchte, den Qualm mit der Hand wegzuwedeln, den er mir ins Gesicht blies:
»Wissen Sie, was mein Arzt gesagt hat? Der hat gesagt, ich sollte lieber nicht auf die Doktores hören, die mir raten, das Rauchen jetzt noch einzustellen. Meine Blutbahnen sind jetzt schon derart vom Rauch zubetoniert, dass sie kollabieren würden und ich sterben müsste, wenn ich jetzt damit aufhören würde.«
Natürlich hat das kein Arzt so gesagt. Gute Kardiologen – zufällig wurde ich von denselben behandelt wie Helmut Schmidt – verabscheuen normalerweise rauchende Patienten. Wenn sie nicht durch ihren hypokratischen Eid zur Behandlung eines jeden Kranken verpflichtet wären, würden sie die Raucher am liebsten einfach sterben lassen.
»Es macht doch einem Behandler keinen Spaß«, hat ein Arzt mir gegenüber einmal gestöhnt, »da gibt man sich alle Mühe und operiert unter den schwierigsten Umständen, nur um sehen zu müssen, wie der Patient, kaum haben wir ihn wieder einigermaßen hergestellt, zur Krankenhaustür hinausrollt und in der Eiseskälte, möglichst noch im Regen sich mit zittrigen Händen eine Zigarette in den Mund steckt. Rauchen – das ist Selbstmord auf Raten.«
Solch eine einfache Wahrheit wollte aber Schmidt, wenn es um die Sucht ging, einfach nicht akzeptieren. An anderer Stelle behauptete er öffentlich allen Ernstes: »Ich bin seit vielen Jahren nicht mehr erkältet gewesen, vielleicht liegt das ja am Nikotin.«
Das Wort »Vorbildfunktion« gehörte nicht zum Vokabular des Helmut Schmidt. Obwohl er sich in vielerlei Hinsicht vorbildlich verhielt und vorbildliches Verhalten auch von anderen erwartete, hätte er es sich verbeten, wegen seines schlechten Vorbilds als Kettenraucher kritisiert zu werden.
Darauf angesprochen sagte er selber: »Ich bin kein öffentliches Vorbild – Politiker sollen auf ihrem Felde Vorbilder sein, aber nicht auf sämtlichen Feldern menschlichen Lebens. Das ist zu viel verlangt.«
Im Gegenteil, er trieb den Raucherkult geradezu auf die Spitze.
»Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt«, nannte Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo seine leicht dahinplätschernden Kurzinterviews mit dem Bundeskanzler a. D., der als Herausgeber der großen Wochenzeitung so etwas wie Lorenzos unmittelbarer Vorgesetzter war.
Die Interviews – Evelyn Roll nannte sie in der Süddeutschen Zeitung »diese kleinen, wunderbaren, eitlen, subversiven, überraschenden, oft politisch und zeithistorisch bemerkenswerten und sehr unterhaltsamen Interviews« – waren zunächst auf den bunten Seiten der Zeit in der Rubrik »Leben« und im Zeitmagazin erschienen. Sie wurden später in einem Buch zusammengefasst. Es wurde ein Bestseller.
Auf der rückwärtigen Umschlagseite ist ein Bild abgedruckt. Es zeigt Schmidt mit seiner ewigen Menthol-Zigarette in der Linken und einen heiter fragenden di Lorenzo ihm gegenüber, der sich an dem Rauch nicht zu stören scheint.
In Wirklichkeit ließ der militante Anti-Raucher di Lorenzo immer sofort nach dem Fünf-Minuten-Interview sein Büro, in dem auch das erwähnte Foto aufgenommen worden ist, lange lüften. Die Fenster wurden aufgerissen, trotz des lauten Verkehrs auf der Straße Speersort, an der das Pressehaus mit den Büros der Zeit steht, worüber sich der schwerhörige Schmidt stets beschwerte. Giovanni di Lorenzo wankte hernach mit tränenden Augen in die nächste Konferenz und hielt sich dabei verzweifelt an einer Tasse revitalisierenden Gesundheitstees fest.
So verlogen kann Authentizität sein.