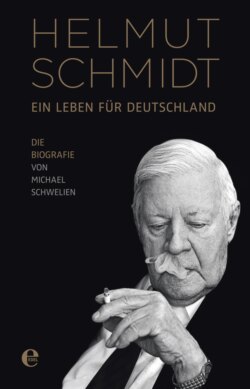Читать книгу Helmut Schmidt - Ein Leben für Deutschland - Michael Schwelien - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Bild vom Elder Statesman
ОглавлениеHelmut Schmidt wusste von der Macht der Bilder. Er war sich schon als junger Politiker bewusst, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Und auch lange nachdem er aus der aktiven Politik ausgeschieden war, achtete er auf sein Image. Er polierte sehr bewusst sein Bild vom Elder Statesman auf. Diesen Begriff, mit dem er sich auch selber bezeichnete, hatte er aus der amerikanischen Praxis, dass Politiker, auch noch lange nachdem sie aus dem Amt geschieden sind, ihren Nachfolgern – gefragt und ungefragt – Rat geben. In den Vereinigten Staaten ist diese Form des Begleitens der aktuellen Regierungspolitik für Ex-Präsidenten zu einem festen Brauch geworden. Bei schwierigen Entscheidungen wie auch bei großen Krisen versammelt andererseits der amtierende Präsident gerne einen oder mehrere seiner Vorgänger um sich und gibt seine jeweilige Entscheidung oder Erklärung im Beisein dieser Elder Statesmen ab. Das erzeugt den Eindruck von geballter Expertise und – gesetzt den Fall, dass der Elder Statesman einer anderen Partei angehört als der Amtsinhaber – von Überparteilichkeit, die als notwendig propagiert wird, um gemeinsam aus einer Krise herauszukommen.
So wusste Schmidt – und sagte es selber auch –, dass er mit seinen großen Artikeln in der Zeit als Elder Statesman auftrat und somit etwas zum Wohlergehen der Republik beisteuerte. Er gehörte sogar einem Club der Ehemaligen an. Der frühere japanische Premierminister Takeo Fukuda hatte diesen Club 1983 gegründet, zufälligerweise ungefähr ein Jahr nachdem Schmidt aus dem Amt des Bundeskanzlers ausgeschieden war. Dem Club gehörten ehemalige Staatschefs an, so zum Beispiel die Franzosen Jacques Chirac und Giscard d’Estaing. Gern gesehen war dort auch Henry Kissinger, der jüdische Deutschamerikaner, der unter dem umstrittenen Präsidenten Richard Nixon US-Außenminister war und noch lange Zeit danach die Außenpolitik der Vereinigten Staaten prägte. Dabei war Kissinger niemals Staatschef. Zu den Treffen des Clubs der Ehemaligen wurde er dennoch geladen, als »Special Guest«, wie Helmut Schmidt sagte. Es spricht für den Pragmatiker Helmut Schmidt, der ein Jahrzehnt lang Vorsitzender dieses Clubs war, den enorm einflussreichen Kissinger genauso mit an Bord geholt zu haben wie zahlreiche ehemalige kommunistische Staats- und Regierungschefs. Über die Existenz seines exklusiven Clubs hat der ehemalige deutsche Kanzler indes nie viel Aufhebens gemacht. Die Öffentlichkeit erfuhr von diesem (nicht eingetragenen) Verein, der einmal im Jahr an jeweils einem anderen Ort zusammenkommt, aus einem Artikel einer jungen New York Times-Redakteurin über das Treffen in Stockholm im Sommer 2008. Bei diesem Treffen waren zum ersten Mal junge Teilnehmer im Alter zwischen zwanzig und dreißig Jahren dabei. Die amerikanische Journalistin fühlte sich in »ein anderes Zeitalter« versetzt und verspürte einen »Hauch von Kaltem Krieg«, was Helmut Schmidt aber nicht so gespürt haben will.
Der Club, das wusste Schmidt natürlich genau, hatte keinerlei Gestaltungsmacht. Von ihm gingen, wie der deutsche Ex-Kanzler es ausdrückte, nur »Denkanstöße« aus. Aber genau das war es, was Schmidt und die anderen wollten: Als Elder Statesmen mit Denkanstößen auf die öffentliche Meinung und damit auch auf die aktuelle Politik Einfluss nehmen.
So hat der Bundeskanzler außer Dienst stets auch seine Rolle bei der Zeit gesehen. Als Herausgeber der angesehenen und einstmals auch einflussreichen Wochenzeitung konnte er jederzeit Denkanstöße geben. Dass er damit auch sich selber im Gespräch hielt, war ihm voll bewusst. Zwar behauptete der Chefredakteur der Zeit, Giovanni di Lorenzo, die Redaktion wünsche sich »so viel Schmidt im Blatt wie möglich«. Aber das stimmte nicht ganz.
Ich gehörte zu denjenigen, die meinten, ein Elder Statesman dürfe sich nicht zu häufig zu Wort melden. Er sollte nur bei sehr bedeutenden Anlässen gewissermaßen mit der Faust auf den Tisch schlagen und sprechen: »Nun kann ich nicht mehr schweigen, ich muss hierzu etwas sagen!« Mit den Denkanstößen, so fürchtete ich und sagte das auch Schmidt, verhielte es sich wie mit einer weißen Fahne im Krieg: Hisst man sie einmal, dann stellt der Feind sein Feuer ein, hisst man sie alle Nase lang, dann wird sie zerschossen.
Aber davon wollte Schmidt nichts wissen. In der Konferenz des Politik-Ressorts an jedem Freitag, in der auch über die Leitartikel auf der ersten Seite entschieden wird, verhielt er sich wie ein ehrgeiziger Jungredakteur. Zwar drängte er sich nicht direkt auf. Aber er beeinflusste das Gespräch – während er sich unablässig aus der Blechdose mit den Keksen, die auf dem Konferenztisch stand, bediente – doch so, dass es bei der Beantwortung der Frage »Und wer schreibt uns das?« unweigerlich in seine Richtung ging. Manchmal war es ein Eiertanz. Wer schreibt kommende Woche den »Leiter«: Marion Gräfin Dönhoff oder Helmut Schmidt? Keiner von beiden hätte da je die Hand gehoben oder gar »Ich!« gesagt. Doch machten sie einander große Komplimente, tauschten Argumente aus, setzten sich selber ins rechte Licht, zogen taktisch ihre Meinung zurück, erröteten sogar – es wirkte wie ein Schlagabtausch zweier versierter Florettfechter –, bis schließlich einem der »Zuschlag« erteilt wurde, welcher dann – ganz gleich ob von ihr oder von ihm – wie immer gerne angenommen wurde.
Bemerkenswert war, dass er unbedingt auch den Nachruf auf den CDU-Politiker und einstmaligen Bundesfinanzminister und Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Gerhard Stoltenberg, schreiben wollte. Dieser sei sein »Freund« gewesen, ein »anständiger Mensch« (das höchste Lob aus dem Munde Schmidts, der so gut wie nie jemanden lobte). Der Nachruf geriet Schmidt wie ein Auszug aus dem Munzinger-Archiv, dem Vorläufer von Wikipedia vor dem Internet-Zeitalter.
Ich hatte die undankbare Aufgabe, als Mitglied des Politik-Ressorts diesen Nachruf zu redigieren, und musste mit Schmidt über seinen Beitrag sprechen, kurz vor unseren regelmäßigen Interviews für dieses Buch. Wenn Stoltenberg doch sein Freund gewesen sei, so fragte ich den Autor Schmidt, warum enthalte denn sein Nachruf kein einziges persönliches Wort? So hätte ihn auch jeder Jungredakteur auf der Basis von etwas Archivmaterial schreiben können. Schmidt sah sich seinen Text einen Moment lang lustlos an. Dann übergab er ihn seiner Assistentin, sie möge ihn doch bitte neu schreiben. Womit bewiesen war: Einen solchen Archivtext hätte jeder schreiben können; Schmidt drängte es nur, mal wieder im Blatt zu sein, auch wenn es keine großen Ereignisse zu kommentieren gab, die des Erfahrungsreichtums und der Tiefenschärfe eines Elder Statesman bedurft hätten.
Obwohl mein Büro bei der Zeit nur eine Etage unter dem von Schmidt und sogar im selben Flügel lag, musste ich ihm einen Hauspostbrief schreiben, um einen Interviewtermin zu erhalten. Er verlangte – aus alter Gewohnheit – immer ein Akte. Das hatte ich bereits Jahre zuvor erfahren. Beim Zeitmagazin, dessen Chef ich Mitte der Achtzigerjahre war, wollten wir ein Sonderheft über die »Tigerstaaten« Südostasiens herausbringen. Ich plante dafür den langjährigen Ministerpräsidenten der Inselrepublik Singapur zu interviewen. Da dieser kaum Interviews gab, aber, wie ich wusste, ein alter Freund von Schmidt war, bat ich Letzteren um Hilfe. Ich schickte also eine Hauspost auf einem der dafür üblichen dünnen blauen Briefbögen an den Herausgeber Helmut Schmidt, worin ich ihn bat, einen Kontakt für mich zu dem asiatischen Politiker herzustellen. Was dann geschah, ist unvergesslich: Ich wurde von Schmidts damaliger Sekretärin Ruth Loah in den sechsten Stock gerufen. Ruth Loah war schon in den Fünfzigerjahren Schmidts Mitarbeiterin gewesen. Sie hatte den ehrgeizigen Jungpolitiker Schmidt 1955 kennengelernt und sein Wahlkreisbüro geleitet. Sie war seine Sekretärin während der Sturmflut. Sie wurde eine »Weggefährtin«, die in Schmidts gleichnamigem Buch von 1998 Erwähnung fand. Sie habe zur Familie gehört, war von anderen Weggefährten zu hören. Das Ehepaar Schmidt und das Ehepaar Loah hätten viel zusammen unternommen. Nach dem Treffen, von dem jetzt die Rede sein wird, hat Ruth Loah den Schmidts auch in deren Privatarchiv geholfen. Und zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Loki, als Schmidt sehr unter der Einsamkeit litt, sollte Ruth Loah – inzwischen selber auch verwitwet – seine neue »Lebensgefährtin« werden.
Aber erst noch einmal zurück in die Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Ich saß also Schmidt gegenüber. Er rauchte, trank Kaffee und las Zeitung. Er blickte kaum auf. Als er es schließlich tat, schien es so, als sei er überrascht, mich zu sehen. Er fragte mich beiläufig, was ich für ein Anliegen habe. Ich hätte fast angefangen zu stottern, wusste aber, dass dies nicht gut ankam, gab mir einen Ruck und wiederholte, was ich geschrieben hatte, sagte also, dass ich seine Hilfe erbäte, um »für ein Interview mit Lee Kuan Yew einen Kontakt herzustellen«.
»Akte«, donnerte er darauf zu meinem Erstaunen in das Vorzimmer, »Ruth, Akte!«
»Das ist doch gar nicht nötig«, warf ich ein, »es geht mir nur darum, dass Sie mir helfen, in Kontakt mit Lee Kuan Yew für ein Interview für unser geplantes Asien-Heft zu treten.«
»Akte, Ruth, die Akte!«
Sie brachte nun meinen kurzen Brief auf dem dünnen blauen Papier. Dieser steckte in einer Klarsichthülle aus Plastik.
Helmut Schmidt war zufrieden. Er las, ignorierte mich, fragte schließlich wohlwollend, wer ich denn sei.
Nachdem ich mich nochmals als Michael Schwelien, Leiter des Zeitmagazins, der Lee Kuan Yew interviewen wollte, vorgestellt hatte, blickte Helmut Schmidt von der »Akte« auf.
»Sie müssen nicht glauben, Lee sei ein Demokrat im herkömmlichen Sinn«, sagte er mit schneidiger Stimme, um murmelnd, fast wie zu sich selber fortzufahren: »Ist ja auch eine verrückte Idee der Amerikaner, überall ihre Vorstellung von Demokratie durchsetzen zu wollen.«
Dann hob er die Stimme wieder: »Aber Sie tun gut daran, ihn zu befragen. Er ist, was die politische Analyse angeht, durchaus auf dem Niveau von Henry Kissinger – und fast auf meinem.«
Derart bestätigt, rief er wieder ins Vorzimmer: »Ruth, Diktat!«
Sie kam mit ihrem Stenoblock und er diktierte ihr ohne weitere Umschweife, nur gelegentlich in die »Akte« schauend, wohl um noch einmal meinen Namen zu erfahren. Ich habe seine Worte bis heute – dreißig Jahre später – so gut in Erinnerung, dass ich sie hier aus dem Gedächtnis wiedergeben kann.
Er diktierte auf Englisch, das er fließend und akzentfrei sprach:
»Dear Harry, as you may know I have left active politics and joined the staff of a newspaper an inch to the left of the center.«
Die politische Standortbeschreibung für die Zeit – an inch to the left of the center – hatte er in ähnlicher Form auch stets für sich selber gewählt. Es passt dazu, dass oft auch von Anhängern der Union anerkennend gesagt wurde, Schmidt sei ein hervorragender Politiker, er sei »aber leider in der falschen Partei«. Dazu bemerkte er nur, dass er überzeugter Sozialdemokrat sei und politisch »einen Zentimeter links von der Mitte« stehe.
Er fuhr fort: »One of our young reporters« – Blick auf mich: »Wie war noch einmal Ihr Name?« – Blick in die »Akte«, murmelnd, »ja, stimmt« – Blick auf Frau Loah, eine Kettenraucherin wie er, die gleichzeitig stenografieren und an ihrer Zigarette ziehen konnte:
»One of our young reporters, a Michael Schwelien, would like to interview you in the near future, and I would be very much obliged if you could receive him.«
Der Brief endete mit der zum Ausdruck gebrachten Hoffnung, man würde sich bald einmal wieder auf »eine Runde Golf« in Singapur treffen. Damit waren Frau Loah und ich entlassen. Und der Herausgeber konnte sich wieder der Lektüre des Blattes an inch to the left off the center, widmen.
Ich wurde in Singapur alsbald tatsächlich von Lee Kuan Yew empfangen und äußerst zuvorkommend behandelt. Normalerweise muss ein Reporter im Ausland, wo seine Zeitung keinen großen Einfluss hat, auch bei subalternen Chargen lange und beharrlich um Termine betteln. In Singapur aber wurde ich von allen, die Rang und Namen hatten, dank des Entrees von Schmidt mit Gesprächsangeboten geradezu überschüttet. Ich konnte mich vor Einladungen zu dem beliebten alkoholischen Drink Singapur Sling in der Bar des berühmten Kolonialhotels The Raffles kaum noch retten und musste der Telefonzentrale sagen, sie möge doch bitte keine Anrufe mehr zu mir durchstellen.
Nach dem Interview mit dem Premierminister, der, wie Schmidt gesagt hatte, sich nicht als »Demokrat im herkömmlichen Sinne«, sondern vielmehr als ein beständig wiedergewählter Potentat erwies, nahm das Interesse an dem Reporter aus Deutschland noch weiter zu, der doch eigenartigerweise einen so guten Draht zum Premier hatte. Lee hatte das Interview nämlich vorab der örtlichen Zeitung Straits Times zum Abdruck gegeben. Und in solchen Schwellenländern, welche die Demokratie »im herkömmlichen Sinn« nicht sonderlich schätzen, gilt ein Journalist mit Zugang zu den Mächtigen selber auch als mächtig.
Überdies hatte ich eine interessante Erfahrung nebenbei machen können, die auch ein bezeichnendes Licht auf Helmut Schmidt zurückwarf. Dieser hat bekanntlich mit dem von ihm entscheidend mitherbeigeführten NATO-Doppelbeschluss wie mit anderen politischen Plänen eine größere Rolle der Bundesrepublik in der Welt immer wieder eingefordert. Und nun kam es zu einem Spiel über Bande. Ohne von mir danach gefragt worden zu sein, belehrte mich Lee Kuan Yew, Deutschland sollte doch eine seinem Gewicht gemäße größere Rolle in der Weltpolitik spielen – »auch militärisch«.
Auf Englisch belehrte ich zurück: »Sir, our constitution does not allow us to act militarily out of area.« Das Grundgesetz, das streng genommen keine Verfassung ist, erlaubt bekanntlich keine Einsätze der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebiets, und innerhalb desselbigen auch nur, wenn es zum Bündnisfall kommt, wenn also ein NATO-Mitglied angegriffen werden und uns um Hilfe bitten würde.
Darauf der Premier, wie gesagt »kein Demokrat im herkömmlichen Sinn«: »Then you must change your constitution!«
So einfach ist das also in der Gedankenwelt der Weltenlenker: Ändert doch euer Grundgesetz, wenn es gerade nicht passt.
Ich hatte mir das Zitat dick unterstrichen. Anderntags sah ich in der Straits Times, dass ein diplomatisch versierter Reporter oder ein schlauer Berater des singapurischen Premiers mit der Umstellung von einigen wenigen Buchstaben das Zitat poliert hatte. In der englischsprachigen Zeitung stand nicht etwa, die Deutschen sollten doch einfach ihre Verfassung ändern, dort stand, sie sollten schlicht ihren Beitrag leisten: »Then you must make your contribution«, anstelle von, »then you must change your constitution«.
Und so konnte später auch Schmidt, nur scheinbar überrascht, feststellen: »Sehen Sie, unsere Freunde überall auf der Welt verlangen von uns Deutschen, dass wir uns stärker in der Weltpolitik engagieren.«
Hier aber geht es um die Bedeutung von Akten für einen Mann, der auch nach 25 Jahren bei der Zeit noch sagte, er sei kein bisschen Journalist geworden, weil er immer noch »gründlich arbeite«.
Als ich ihn also um regelmäßige Interviewtermine für eine Biografie bat, schrieb ich ihm einen langen Brief. Ich legte meine kritische Biografie über Joschka Fischer bei, die ich 1999 geschrieben hatte. Das muss bei ihm gezogen haben.
»Der Fischer«, bemerkte Schmidt, als er mich zum ersten Mal zu einem Interview für mein Buch über ihn selber empfing, »der Fischer, der ist doch kein Politiker, der ist allenfalls ein Halbpolitiker – habe ich immer schon gesagt.« (Was ihn später – im Dezember 2013 – aber nicht daran hindern sollte, sich mit dem »Halbpolitiker« Fischer zu einem Streitgespräch zu treffen und sich mit dem einstmaligen Revoluzzer so gut zu verstehen, dass aus dem Gespräch ein gemeinsames, noch 2013 erschienenes Buch wurde: Helmut Schmidt: Mein Europa – Mit einem Gespräch mit Joschka Fischer [wobei Schmidts Forderung: »Europa braucht einen Putsch!« sich eher wie eine Anbiederung an den vormaligen Frankfurter Revoluzzer anhört].)
Aber im Jahr 2002 war Fischer für Schmidt nur ein »Halbpolitiker« – und meine Kritik an Fischers schnellen Wandlungen waren für Schmidt offensichtlich Grund genug, mich zu empfangen. Diese »Akte« hatte ihn überzeugt.
Wie es um Schmidts Gesundheit, genauer: wie es um sein Gedächtnis zu dieser Zeit – er war da schon 84 Jahre alt – bestellt war, zeigte sich ebenfalls sehr schnell.
»Ich kannte doch Ihren Vater«, sagte er, »war ein guter Mann – was macht er jetzt?«
Ich erklärte, dass mein Vater, der Journalist Hans-Joachim Schwelien, bereits im April 1978 verstorben war.
Worauf Helmut Schmidt, sichtlich berührt, brummte: »Schade. Viel zu jung gestorben! War ein guter Mann, Ihr Vater. Hat mir in Washington, wo er Korrespondent war und wo ich als junger Außenpolitiker, noch ganz grün hinter den Ohren, hinkam, die Fallstellen im politischen Terrain gezeigt. Haben Sie ein Foto von ihm für mich?«
Ich fand ein Foto, auf dem beide zusammen – Helmut Schmidt und mein Vater – zu sehen sind. Ich gab es ihm bei unserem zweiten Interviewtermin, am Montag eine Woche später.
Und siehe da, beim dritten Termin sagte Helmut Schmidt: »Ich kannte doch Ihren Vater, war ein guter Mann – was macht er jetzt?« Und genau wie zwei Wochen zuvor bat er mich um ein Foto, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass mein Vater vor Jahren verstorben war.
Wenn Schmidt aber weit in die Vergangenheit zurückging, funktionierte sein Gedächtnis bestens. Er konnte sich an sehr lange zurückliegende, sogar an unwichtige Einzelheiten erinnern, wie etwa, wo die Kellner beim Essen während eines Gipfeltreffens in Guadaloupe mit Giscard d’Estaing, James Callaghan und Jimmy Carter standen, was sie servierten und was ihm, Schmidt, schmeckte und was nicht.
Mit Lob ging er, wie gesagt, äußerst zurückhaltend um. So schrieb er mir auf ein Zeit-Dossier, das ich Anfang 2004 nach dem Terroranschlag mit 191 Todesopfern und über 1800 Verletzten am Madrider Atocha-Bahnhof geschrieben hatte, einen dürren Zweizeiler:
»Lieber Herr Schwelien, Ihr Dossier-Stück über die Sehnsucht der Muslime nach Al-Andalus habe ich von A bis Z gelesen, und es hat sich gelohnt.«
So war ich verständlicherweise aufgeregt, als ich aus seinem Vorzimmer nach Vollendung meines Buchs, aber noch vor dessen Erscheinen, Anfragen aus Schmidts Vorzimmer erhielt, wann dieser denn wohl »sein Exemplar« bekäme. Hatte ich vielleicht etwas falsch verstanden? War mir möglicherweise ein Fehler unterlaufen.
Vor Beginn meiner regelmäßigen Interviews mit Helmut Schmidt hatte ich zuerst einmal seine Vertrauten befragt. Zuallerst Theo Sommer, den langjährigen Chefredakteur der Zeit, der einstmals auch Leiter des Planungsstabs von Schmidt im Bundesverteidigungsministerium gewesen war. Dann auch Klaus Bölling, den ehemaligen Kollegen meines Vaters und ARD-Korrespondenten, der von 1974 bis 1982 – mit einer kurzen Unterbrechung von Februar 1981 bis Mai 1982 – der Regierungssprecher von Helmut Schmidt war. Beide, Sommer und Bölling, überraschten mich, indem sie mich bedrängten, ja, fast nötigten, ich sollte doch etwas über die Affären von Helmut Schmidt schreiben. Dieser sei gar nicht der treue Mann, den die Boulevardpresse als leuchtendes Beispiel für eine lange, gute Ehe aufs Schild gehoben hatte. »Er war schlimmer als Willy Brandt«, sagte Theo Sommer, »wie oft mussten wir nach Hamburg telefonieren und behaupten, wir steckten noch irgendwo im Verkehr fest?« Bölling, selber ein ausgemachter Filou, erinnerte an die vielen Male, an denen »wir da wieder wegen irgend so einer Lehrerin stundenlang auf den Chef warten mussten«.
Ich erklärte beiden, dass ich vorhätte, eine politische Biografie zu schreiben, dass ich natürlich auch den »privaten Schmidt« kennenlernen und der Öffentlichkeit vorstellen wollte, dass ich aber nicht daran dachte, ihn durch Enthüllungen bloßzustellen. Sollte ich auf irgendwelche Affären stoßen, dann würde ich sie nur erwähnen, wenn sie Auswirkungen auf die politische Laufbahn Schmidts gehabt hätten. Dass dies genau so kommen sollte, konnte ich zu diesem frühen Zeitpunkt nicht ahnen.
So gab ich Theo Sommer – er war immerhin mein direkter Chef, mit ihm hatte ich so manchen Strauß auszufechten gehabt – und Klaus Bölling – er war ein guter Freund meines Vaters, und er nannte meine Tante Gitta Bauer seine »große Liebe, die mich aber leider nicht erhört hat« – so gab ich diesen beiden Schmidt-Vertrauten ziemlich deutlich zu verstehen: Schmidts Affären, so er denn welche gehabt haben sollte, interessieren mich nicht; wenn sie Derartiges würden lesen wollen, dann sollten sie es bitte schön doch selber schreiben.
Sorgte jetzt aber womöglich doch meine Schilderung der Affäre mit der »schönen Helga«, wegen der Schmidt nicht Oberbürgermeister von Hamburg, damit aber letztendlich doch Bundeskanzler geworden war, für helle Aufregung? War dies der Grund für die ungehaltenen Anfragen aus seinem Büro? Schmidts damalige Sekretärin, Rosemarie Niemeier, rief regelmäßig an, um mitzuteilen: »Herr Schmidt ist ziemlich ungehalten, weil er das Buch noch nicht zu sehen bekommen hat!«
Nun, wenn er es noch nicht zu sehen bekommen hatte, dann konnte ihm auch nichts daran missfallen haben. Ich war vorübergehend beruhigt. Denn ich wusste auch: Schmidt konnte sehr schroff sein, aber er war nie ungerecht, er urteilte nicht ohne genaue Kenntnis der Sachlage oder, wenn man so will, ohne genaues Studium der »Akte«.
Frau Niemeier, auch sie – natürlich – eine Kettenraucherin, überdies politisch doch eher den Grünen als der SPD zugeneigt, hatte einige Jahre zuvor für mich als Sekretärin gearbeitet. Ich mochte sie, und ich glaube, sie mochte mich auch. So fragte ich sie rundheraus nach dem Grund für Schmidts Ungehaltenheit.
»Ach wissen Sie, er ist doch nur eifersüchtig auf seine Frau«, überraschte Rosemarie Niemeier mich zwischen zwei Zügen an ihrer filterlosen Zigarette, »sie kennt nämlich Ihr Buch bereits, er aber kennt es noch nicht.« Wie das? Die Erklärung war einfach.
Loki Schmidt brachte zur gleichen Zeit ein eigenes Buch im selben Verlag heraus, und zwar gesammelte Interviews mit dem biederen Zeit-Redakteur Dieter Buhl: Hannelore Schmidt erzählt aus ihrem Leben. Und so muss ihr wohl bei einem Besuch im Verlag ein Vorabexemplar oder ein Korrekturexemplar meiner Biografie über ihren Mann in die Hände gefallen sein.
Als ich endlich ein druckfrisches Buch zugesandt bekam, brachte ich dieses natürlich sofort »hoch« in den sechsten Stock, wo Helmut Schmidt in einer Ecke, in den Büros des verstorbenen Gründers und langjährigen Alleineigentümers der Zeit, Gerd Bucerius, residierte.
Wenn man von Rosemarie Niemeier zu ihrem Chef gerufen wurde, hieß es stets militärisch knapp: »Können Sie mal hochkommen zu Helmut Schmidt?« Das Fragezeichen wurde von ihr nicht mitgesprochen, nicht einmal für einen Chefredakteur. Das »Können Sie mal hochkommen?« war ein Befehl.
So war ich überrascht und ein wenig irritiert, als Frau Niemeier einige Tage nachdem ich mein Buch über Schmidt »hochgebracht« hatte, am Telefon mit liebreizender Stimme säuselte: »Hätten Sie einmal ein paar Minuten Zeit für Herrn Schmidt?«
Kein Zweifel: Dies war eine echte Frage. Vom Tonfall her war zu erkennen, dass ich auch straflos hätte ablehnen können.
»Hätten Sie einmal ein paar Minuten Zeit für Herrn Schmidt?« – Natürlich hatte ich das. Es war immer noch eine Ehre, von dem großen Politiker empfangen zu werden.
An diesem Tag lief er zu großer Form auf. Er saß an seinem Schreibtisch, auf dem neben seiner obligatorischen Kaffeetasse (manchmal war sie schlicht mit Baileys Cream Whisky gefüllt) und dem Aschenbecher mit der qualmenden Reyno-Menthol-Zigarette aufgeschlagen mein Buch lag. Schmidt tat so, als lese er interessiert darin. Er blickte auf: »Ich lese gerade, was Sie über mich auf dem Gipfel in Guadaloupe geschrieben haben – interessant!« Das sollte wohl so etwas wie ein Kompliment sein. In der Politik-Konferenz hatte er – das war mir zu Ohren gekommen – gesagt, das Buch »von diesem, wie heißt der junge Mann doch noch mal? Ähm, das Buch von diesem Schwelien hat man aber schnell gelesen.«
Seine jetzt auch anwesende Assistentin Birgit Krüger-Penski – wie üblich gekleidet in knappen Shorts über blickdichten Strumpfhosen – fläzte sich auf einem Sofa, streckte ihre langen Beine aus und bedeutete ihm (oder mir? – das war nicht ganz klar):
»Aber nur eine halbe Stunde!«
So war aus den »paar Minuten für Herrn Schmidt« schon eine halbe Stunde geworden. Aus der halben Stunde wurde dann eine ganze Stunde, aus der ganzen Stunde wurden zwei Stunden. Frau Krüger-Penski schüttelte bereits nach der ersten Stunde mehrmals ungehalten den Kopf mit den langen braunen Haaren, die sie wie stets offen trug.
Schmidt ließ sich davon nicht bremsen. Es war ihm deutlich anzumerken, dass er etwas sagen wollte, aber damit nicht einfach herausrückte. Er begann von seinen Krankheiten zu erzählen, fragte mich, ob ich wüsste, dass er in seiner Zeit als Kanzler immer wieder unter Ohnmachtsanfällen gelitten hatte. »Ich fiel in den unpassendsten Momenten in Bewusstlosigkeit«, bekannte er, »und vergaß dabei oft meine vorbereitete Rede.« Einmal sei dies ganz besonders peinlich gewesen.
Der mächtige sowjetische Staats- und Regierungschef Leonid Breschnew sei zu Besuch gekommen. Dies sei zu den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges gewesen. Da Breschnew »gerne einen hob« und dann auch mit den »Staatskarossen von Mercedes auf dem Petersberg herumkutschierte«, hätte er, Schmidt, den richtigen Moment abpassen müssen, an dem der Russe noch nüchtern war. Kurz vor der Begrüßung im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg in Königwinter »bin ich dann wieder mal in Ohnmacht gefallen, und als ich wieder wach wurde, hatte ich meinen Redetext vergessen. Komplett vergessen. Der war aber sehr wichtig. Ich wollte nämlich dem Russen die Leviten lesen, ohne dabei die diplomatischen Anstandsregeln zu verletzen.«
Die Ursache für diese Ohnmachten sei nie festgestellt worden. Er, Schmidt, sei aber überzeugt, dass sie auf den Stress im Kanzleramt zurückzuführen gewesen sei. Seit dem Ausscheiden aus dem Amt habe er keine Ohnmachtsanfälle mehr gehabt. Schmidt war sich sicher, dass er zu diesem Zeitpunkt – Herbst 2003 – bereits tot gewesen wäre, wenn er noch länger im Amt geblieben wäre.
Er fragte mich, wie alt ich sei und woran mein Vater gestorben sei. Als ich ihm sagte, dass mein Vater einem Herzinfarkt erlegen und ich knapp sechzig Jahre alt sei, riet er mir allen Ernstes zu einer prophylaktischen Bypassoperation: »Herzkrankheiten sind vererblich. Lassen Sie sich jetzt operieren, da Sie noch jung sind; wenn Sie erst einmal in mein Alter kommen, wird das viel schwieriger.« Er nannte mir den Namen seines Arztes im ganz in der Nähe gelegenen Krankenhaus St. Georg: »Gehen Sie zu dem, er ist der Beste!«
Ich hielt den Gedanken, mich vorbeugend am Herzen operieren zu lassen, für abwegig, wollte aber nicht widersprechen (und konnte auch nicht ahnen, dass es fünf Jahre nach diesem endlos langen Gespräch mit Schmidt genau so kommen würde). Frau Krüger-Penski schaute in immer kürzeren Abständen auf die Uhr. Und nach gut zwei Stunden hielt auch ich es für angebracht, zu gehen. Ich stand auf, entschuldigte mich mit Arbeit für die anstehende, aktuelle Ausgabe der Zeit und wollte zur Tür hinaus, da stand auch Helmut Schmidt auf – und kam nun endlich mit dem heraus, was er offenkundig schon die ganze Zeit über hatte sagen wollen: »Einen Moment noch, ich wollte Sie noch etwas fragen«, sagte er plötzlich mit fester Stimme; nun war es Frau Krüger-Penski, die kurz davor schien, in Ohnmacht zu fallen, und ihre Augen furchterregend verdrehte, »woher haben Sie die Geschichte von der, wie haben Sie sie doch genannt, von der, äh, ›schönen Helga‹, woher wussten Sie das?«
Das war es also, was ihn beschäftigte. Ich hatte kurz den einen bekannt gewordenen Seitensprung erwähnt, bei dem Helmut Schmidt 1961 in flagranti von einem Polizisten in einem heftig schaukelnden Volkswagen auf dem Parkplatz des Hamburger Volksparkstadions erwischt worden war. Die Berichterstattung darüber kostete ihn, wie gesagt, fünf Jahre später den Vorsitz der Hamburger SPD, welcher nahezu automatisch zum Posten des Ersten Bürgermeisters in der SPD-Hochburg Hamburg geführt hätte. Somit musste Schmidt sich wieder dem »Zuchtmeister« der SPD-Bundestagsfraktion, Herbert Wehner, in Bonn unterordnen, wurde dessen Vize, half die damalige Große Koalition von Union und Sozialdemokraten auf Kurs zu halten und wurde schließlich der Nachfolger von Willy Brandt nach dessen Abdankung. Somit war der Seitensprung folgenreich für Schmidts politischen Werdegang, deshalb hatte ich ihn erwähnt, während ich mich gleichzeitig dem Ansinnen der Lüstlinge Sommer und Bölling widersetzt hatte, auch »all die unzähligen anderen Affären« endlich einmal aufzudecken.
Auf die Einzelheiten hatte mich die Archivarin im »Helmut-und-Loki-Schmidt-Archiv«, das in dem Bungalow der Schmidts in Hamburg-Langenhorn untergebracht war, geradezu mit der Nase gestoßen. Diese Archivarin war Heike Lemke. Sie arbeitete außerdem noch für Loki Schmidt, der sie so etwas wie eine persönliche Assistentin und Sekretärin war. (Später erfuhr ich, dass Frau Lemke auf der einen Seite und die Damen Krüger-Penski und Niemeier auf der anderen Seite einander überhaupt nicht grün waren.)
Im Nachhinein erscheint es mir, dass das Lüften dieses wohlbehüteten Geheimnisses, das den Mythos von der ewigen ehelichen Treue zerstörte, weil mindestens einer – er, Helmut Schmidt – nachweislich einen Seitensprung begangen hat, ein Racheakt der betrogenen Gattin – von Loki Schmidt – war.
Sie hatte sich nämlich während der Gespräche, die ich mit ihr parallel zu denen mit ihrem Mann führte, mehrfach über das mangelnde eheliche Interesse ihres Gatten beschwert.
Und es war die ihr loyale Archivarin Heike Lemke, die mich, wie gesagt, auf die Fährte der »schönen Helga« gesetzt hatte. Bei meinen Recherchen im Archiv der Schmidts hatte Frau Lemke mir mehrmals zugeraunt, ich solle sie doch nach den Ordnern aus den Jahren 1961 und 1966 fragen. In diesen fand ich dann die Zeitungsausschnitte, die Briefe des empörten, gehörnten Gatten der »Helga« und der schadenfrohen Parteifreunde Willy Brandt und Herbert Wehner.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass es gar nicht so einfach war, in dieses Archiv zu kommen. Obwohl Helmut Schmidt ausdrücklich meinen Interview-Wünschen zugestimmt hatte, musste erst noch seine ausdrückliche Zustimmung zur Forschung in seinem Privatarchiv – und zwar unter genauer Bezeichnung des Themas – eingeholt werden. Schmidt hielt geheim, was er geheim halten wollte. So war mir auf einen Fingerzeig Schmidts sogar im Archiv der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung der Zugang zu irgendwelchen, sicher unbedeutenden, für ihn aber unvorteilhaften Dokumenten über die SPD im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss hin verwehrt worden. Bei meinem Antrag zur Recherche im Privatarchiv hatte ich eingetragen: »Rücktritt von Bürgermeister Paul Nevermann 1965« und »Parteitage des SPD-Landesverbands Hamburg 1961 bis 1966«. Das schien Schmidt wohl unproblematisch gewesen zu sein. Die Archivarin Heike Lemke allein wusste, welcher Sprengstoff sich in den entsprechenden Ordnern verbarg – und schob sie mir im vollen Bewusstsein ihrer Brisanz zu.
So beantwortete ich Schmidts Frage am Ende der »paar Minuten«, woher ich den von der »schönen Helga« wusste, lakonisch: »Doch aus Ihrem Archiv, Herr Schmidt.«
Seine ebenfalls lakonisch klingende Antwort war ein veritables Eingeständnis: »Dann muss ich ja in Zukunft da noch besser aufpassen.«
So war ich nach den »paar Minuten für Herrn Schmidt« entlassen – mit dem beruhigenden Gefühl, dass mir beim Abfassen seiner Biografie doch keine schwerwiegenden Fehler unterlaufen waren.