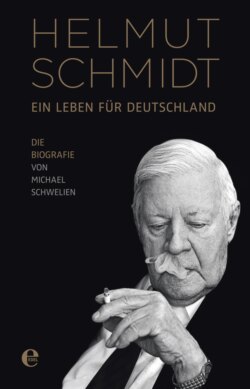Читать книгу Helmut Schmidt - Ein Leben für Deutschland - Michael Schwelien - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bewunderung des Jugendlichen, Skepsis des Studenten
ОглавлениеIch habe ihn das erste Mal von Angesicht zu Angesicht Ende der Sechzigerjahre erlebt. Schmidt war damals Fraktionsvorsitzender der SPD und begann sich auf die Außen- und Sicherheitspolitik zu konzentrieren. Denn er sollte bald darauf, Ende Oktober 1969, Verteidigungsminister im ersten, von Willy Brandt geführten SPD/FDP-Kabinett werden. Mit der Fraktionsspitze reiste Schmidt im Juli 1969 nach Washington, einen Monat später nach Moskau. Mein Vater, Joachim Schwelien, war damals Korrespondent für den ARD-Hörfunk in der amerikanischen Hauptstadt. Schmidt besuchte ihn dort. Ein solcher Besuch war damals nichts Ungewöhnliches, das Verhältnis zwischen Politikern und Journalisten viel enger als heute. Und es galt zu jener Zeit noch ein Ehrenkodex, wonach das Persönliche nicht »enthüllt« wurde, das Vertrauliche auch vertraulich blieb. Schmidt kam, um sich bei einem Korrespondenten zu informieren, der schon zehn Jahre am Platz war.
Meine Geschwister und ich durften bei solchen Anlässen Getränke reichen, bei gutem Wetter den Grill im Garten bedienen. Und wir durften zuhören (aber natürlich nicht mitreden). Schmidt, das fiel sofort auf, war von einem anderen Kaliber als seine Politikerkollegen. Er musste sich nicht wirklich informieren, er war schon informiert. Dennoch hörte er aufmerksam zu. Andererseits war er dem Genuss abhold. Damals galt ein T-Bone-Steak von einem amerikanischen Barbecue für einen Deutschen noch als etwas Besonderes. Und mein Bruder und ich hatten viel Spaß daran, Besuchern extra starke Drinks mit Gin oder Bourbon zu mixen. Schmidt aß nicht viel. Und aus alkoholischen Getränken machte er sich auch nichts.
Später, zur Zeit seiner Kanzlerschaft, stand ich seiner Politik skeptisch bis ablehnend gegenüber. Meine Sympathie galt Willy Brandt, mein Herz schlug noch ein bisschen links von dessen SPD. Als Schmidt ihn ablöste, fand ich das bedauerlich, glaubte, dass es nun aus sei mit den Emotionen in der Politik. Ich war kein »richtiger« Achtundsechziger, zu jung und außerdem in den USA aufgewachsen.
15 Jahre nach diesem Gespräch mit meinem Vater sollte ich ihm bei der Zeit wiederbegegnen. Anlässlich einer neuerlichen Philippika Schmidts gegen die Achtundsechziger fällte er im Zorn auch über mich ein schnelles Urteil: »Und Sie, Herr Schwelien, Sie sind ein Yuppie.« Das traf damals nicht und trifft auch heute nicht zu, da hatte er sich schlicht geirrt. Jahre später aber, und das ging wohl vielen meiner Generation so, musste ich ihm in wesentlich bedeutenderen Fragen recht geben, vor allem seiner Politik zur Sicherung des Friedens. Heute finde ich das Erstaunlichste an Schmidt die Weitsicht und das Durchstehvermögen.
Helmut Schmidt hat mir für dieses Buch viele Stunden Zeit geschenkt. Ich suchte ihn zumeist montags in seinem Büro im Hamburger Pressehaus auf. Für ihn waren die Gespräche manchmal mühselig. Sein Gedächtnis verließ ihn nicht, wohl aber sein Gehör, das sich seit seinem Hörsturz im Jahr 1999 dramatisch verschlechtert hatte. Er, der Musikliebhaber, ging schon seit einiger Zeit nicht mehr zu Konzerten, weil er die Musik kaum noch genießen konnte. Und wenn wir an einem kleinen Konferenztisch vor der meist offenen Balkontür Platz nahmen, ermunterte er mich erst einmal: »Sie müssen mir ins Ohr schreien, sonst kann ich Sie nicht verstehen.« Er drehte an seinem Hörgerät, zündete sich eine Zigarette an, trank einen Schluck Kaffee, griff ein Stichwort auf – und redete. Helmut Schmidt hat in der Zeit vor seinem schweren Herzinfarkt Ende August 2002 niemandem so viel Zeit für Interviews gewährt wie mir, wofür ich ihm herzlich danke.
Er hat mir überdies den Zugang zum Archiv in seinem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn gestattet. Und – dies vielleicht noch wichtiger zum Verständnis seiner Person als etwa die unzähligen Begegnungen mit ihm in beinahe zwanzig Jahren bei der Zeit – Loki Schmidt hat mich mehrmals in ihrem Büro empfangen. Sie servierte selbst gebackenen Kuchen, war bestens vorbereitet und hatte sichtlich Spaß, die weißen Flecken auszumalen, die ihr Mann nolens volens in seinem Selbstbildnis freilässt.