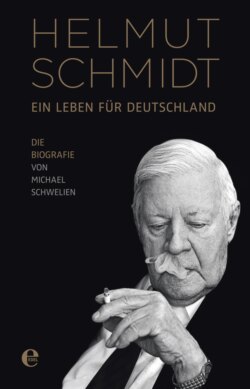Читать книгу Helmut Schmidt - Ein Leben für Deutschland - Michael Schwelien - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Ich will es von Schmidt wissen«
ОглавлениеWie der ehemalige Bundeskanzler wieder in seine Heimatstadt Hamburg kam. Die Familiengeschichte. Seine Kindheit und Jugend. Seine Jugendfeundin Loki. Abitur in der Nazizeit
Hamburg im Herbst 1984, kurz vor der Präsidentschaftswahl in Amerika, die Ronald Reagan zum zweiten Mal gewinnen sollte. Die Redaktionsleiterkonferenz der Zeit, nach dem bevorzugt gereichten Imbiss in der Redaktion auch als »Käsekonferenz« bekannt, fand wie immer freitags um 14 Uhr im Büro des Chefredakteurs Theo Sommer statt.
An diesem Tag wirkte Gerd Bucerius, der Eigentümer des Blattes, besonders nervös. Bucerius galt als weitsichtiger Verleger, der DIE Zeit lange mit Einnahmen aus erfolgreicheren Geschäften, wie zum Beispiel dem Verkauf der Illustrierten Stern, subventionierte, bis sie endlich Gewinn abwarf. Und er war auch der geborene Journalist, neugierig, hatte zu allem eine – oft sehr schnell gebildete – Meinung und ein feines Gespür dafür, welche Themen die Leser interessierten.
Die Konferenz hatte gerade begonnen, als sich Helmut Schmidt noch schnell ein Päckchen seiner geliebten Menthol-Zigaretten und eine Dose Schnupftabak bringen ließ. Bucerius, von allen, auch von Schmidt, Buc genannt, musste sich gedulden. Er beugte sich vor, hielt sich mit den Händen an den Lehnen seines Sessels fest. Kaum war die dicke, schalldichte Tür wieder geschlossen, da schoss es auch schon aus ihm heraus: »Ich will wissen, was passiert nach der Wahl mit dem Dollar?«
Fragende Gesichter in der Runde. Aber dann ging den meisten ein Licht auf: Der Verleger sorgte sich um eine private Investition, nicht um die Beurteilung des Wechselkurses im Blatt.
Der Dollar stand damals auf 2,85 DM. Und Ronald Reagan hatte zu erkennen gegeben, dass er die Steuern weiter niedrig zu halten und zugleich die Rüstungsausgaben zu steigern gedachte, was wiederum in den Vereinigten Staaten einen höheren Bedarf an ausländischem Kapital nach sich ziehen würde. Die meisten Ökonomen glaubten, dass der – objektiv überbewertete – Dollar weiterhin hoch im Kurs bliebe.
Nach einer peinlichen Pause ergriff der Leiter des Wirtschaftsressorts, Michael Jungblut, das Wort: »Der Dollar bleibt hoch, keine Angst.«
Bucerius beachtete ihn gar nicht. Er lehnte sich noch weiter vor und rief mit seiner hohen Stimme: »Ich will es von Schmidt wissen!«
Helmut Schmidt hat sich nie die Mühe gemacht, Langeweile durch vermeintlich aufmerksames Dreinblicken zu kaschieren. Er bringt es fertig, in großen wie in kleinen Runden die Augen zu schließen und vor sich hin zu dösen. Aber er hat die einzigartige Gabe, sofort wieder auf »präsent« schalten zu können, wenn er angesprochen wird.
Der vormalige Bundeskanzler, jetzt Herausgeber der Zeit, hatte sich als Einziger nicht von der allgemeinen Nervosität anstecken lassen. Er trug eine dunkle, mit einem Hamburg-Wappen dekorierte Krawatte, ein bequemes braunes Jackett und eine schwarze Hose. Gerade hatte er eine Zigarette ausgedrückt, eine Prise geschnupft und sich tief in den Sessel sinken lassen.
Nun richtete er sich ächzend auf, taxierte mit seinen Blicken die Runde und sprach mit seiner außergewöhnlich präzisen, kraftvollen, nur ein ganz klein wenig hamburgisch nasalen Stimme: »Ich sage euch, nach der Wahl in Amerika bricht das ganze Kunstgeldwesen zusammen.«
Das saß! Als hätte er mit der Faust auf den Tisch geschlagen.
Schmidt fuhr mit einer Frage fort: »Wer hier am Tisch, das will ich mal wissen, hat eine Kreditkarte?«
Wie Schüler, die bei einem Streich ertappt wurden, kramten etliche leitende Redakteure in ihren Portemonnaies und zogen ihre Kreditkarten heraus.
»Seht ihr, ihr macht es alle mit. Ich habe das nicht nötig. Und ihr werdet sehen, das ganze Kunstgeldwesen bricht zusammen.«
Ganz so dramatisch hatte Schmidt es zwar nicht gemeint. Aber das Leistungsbilanzdefizit der USA bereitete ihm stets große Sorge, Jahre vor dieser Konferenz und Jahre danach. Es ist sein ceterum censeo »In den USA liegt die Sparquote bei null, die amerikanische Volkswirtschaft finanziert sich zu einem großen Teil mit den Ersparnissen anderer Völker – das ist schlimm.«
Ende des Jahres 1984, Anfang 1985 sah es zunächst so aus, als würde Michael Jungblut und nicht Helmut Schmidt recht behalten. Der Dollarkurs stieg noch weiter an, erreichte am 26. Februar 1985 den höchsten Stand seit vielen Jahren, nämlich 3,47 DM. Doch dann kam der Zusammenbruch des, wie Schmidt es genannt hatte, »Kunstgeldwesens«: Die USA rutschten in eine Rezession, die bis Mitte der Neunzigerjahre anhielt und die Reagans Vizepräsidenten und Nachfolger, George Bush, die Wiederwahl kostete, obwohl er als Sieger des ersten Golfkriegs hohes Ansehen genoss und sein junger Herausforderer Bill Clinton zu Beginn des Wahlkampfes 1992 kaum bekannt war. Die Flaute in Amerika hielt länger als zehn Jahre an. Am 19. April 1995 fiel der Dollar auf 1,36 DM – der historische Tiefststand.
Helmut Schmidt hat sich selten von kurzfristigen Stimmungsschwankungen irritieren lassen. Er dachte in großen Zeiträumen, und dies nicht erst nach seiner Zeit als Bundeskanzler. Später, als die New Economy Reichtum für alle in kürzester Zeit versprach, als Analysten einen ewigen Boom voraussagten, warnte er in ähnlich drastischen Worten vor solchen »Schönrednern«. Er sah die Wirtschaft als eine Abfolge von Zyklen, mit Abschwüngen und Aufschwüngen. Und auch zu Beginn des neuen Jahrtausends hat er immer wieder »Ruhe bewahren« gesagt, als alle um ihn herum ängstlich um den Euro bangten.
Auf jener Konferenz im Herbst 1984 war indes etwas anderes zusammengebrochen: Gerd Bucerius’ Traum von einem schönen Anlagegeschäft. »Was sagen Sie da«, fragte er Schmidt, obwohl er ihn genau verstanden hatte, »was sagen Sie da?«
Aber Bucerius, einst CDU-Abgeordneter, von der Überzeugung her aber eher ein marktwirtschaftlich orientierter Liberaler, hatte den Sozialdemokraten eben deshalb zur Zeit geholt, weil er es von Schmidt wissen wollte – keineswegs nur, wie der Dollar stand, sondern wie es überhaupt um Politik und Wirtschaft bestellt war. Und auch wie er, Bucerius, der damals bereits 78-Jährige, seinen Nachlass regeln sollte.
Dieses »Ich will es von Schmidt wissen« war weit mehr als nur eine nervöse Aufforderung. Es war Gerd Bucerius’ Ausdruck höchster Achtung. Er kam von einem Mann, der trotz großer wirtschaftlicher Erfolge durchaus auch unter seiner Verantwortung litt, der aber stets bereit war, diese Verantwortung zu schultern. Und es war eine Art Willkommensgruß von einem Hanseaten zum anderen.
Der Eintritt in die Zeit-Redaktion bedeutete für Schmidt, dass Hamburg wieder zu seinem Lebensmittelpunkt wurde. Noch Jahre später sagte er mit für ihn höchst ungewöhnlicher Emphase in einer Talkshow: »Ich bin mit Leib und Seele ein Hamburger, ein hanseatischer Hamburger überdies.«
In Hamburg wurde Helmut Schmidt geboren, am 23. Dezember 1918, sechs Wochen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und zwar im Stadtteil Barmbek.
Loki Schmidt, seine Ehefrau, hat immer wieder gesagt: »Bonn ist der Arbeitsplatz – Hamburg ist Zuhause.« Das Reihenhaus in Langenhorn hatten die Schmidts nie aufgegeben. Nach vielen Umzügen in der Nachkriegszeit und dem Pendeln nach Bonn, nach den Jahren im Kanzlerbungalow wünschten sich die beiden einen festen, vertrauten Ort, den sie nicht mehr verlassen müssten.
Für Helmut Schmidt wurde dann 1983 das Pressehaus am Speersort der Arbeitsplatz. Das massive siebenstöckige Backsteingebäude im Zentrum Hamburgs hat eine bewegte Geschichte. Hier spielte sich auch die Spiegel-Affäre ab, losgetreten von Schmidts langjährigem Widersacher Franz Josef Strauß. Als Schmidt einzog, war Die Zeit die Publikation, die den größten Teil des Gebäudes beanspruchte – die vier oberen Etagen. Der Ex-Kanzler bekam ein Büro im sechsten Stock. Bis dorthin fahren die Fahrstühle. Die siebte Etage ist nur über eine separate Treppe zu erreichen. Deswegen war der Empfang im sechsten Stock untergebracht, ein offener Tresen. Aus Sicherheitsgründen musste umgebaut werden. Gottlob ist aber nie etwas wirklich Schlimmes passiert. Eines Tages jedoch wurde die Redaktion in Schrecken versetzt. Ein geistig verwirrter junger Mann hatte sich bei den Empfangsdamen als Sohn von Helmut Schmidt ausgegeben, er wolle seinen Vater sehen. Er wurde abgewiesen, kam aber nach kurzer Zeit zurück – mit einem Kanister Benzin. Den warf er in den Flur und zündete ihn an. Schmidt wurde sofort in Sicherheit gebracht, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Seither werden auch die Redaktionsräume der Zeit mit einem ausgeklügelten Sicherheitssystem geschützt.
Die Sache schien Schmidt nicht sonderlich aus der Ruhe gebracht zu haben. Er war aus der Blütezeit des deutschen Terrorismus, dem Deutschen Herbst des Jahres 1977, Schlimmeres gewohnt. Und doch machte der Zwischenfall deutlich, dass sich der ehemalige Kanzler nie wieder richtig frei würde bewegen können.
Mit seinem Eintritt in die Zeit-Redaktion war er zu Hause angekommen, in dieser Stadtrepublik, die er immer gemocht hatte. Besonders schätzte er, dass die großen Bauten, auch die Kirchen, von den Bürgern der Stadt finanziert wurden und nicht durch Steuergelder. Hamburg ist die Stadt der Stifter, viele Hundert gemeinnützige Stiftungen helfen bei sozialen wie bei künstlerischen, bildenden und städtebaulichen Vorhaben. Das war für Schmidt ein Zeichen »republikanischer Grundgesinnung«, das ihn sehr zufrieden machte. Aber einfach einmal durch seine Heimatstadt schlendern, ohne den Tross von Leibwächtern zu den Stätten seiner Kindheit und Jugend zu spazieren – diese Art der Erinnerung blieb ihm verwehrt. Wenn Loki Schmidt von »Zuhause« sprach, dann hatte das einen wehmütigen Klang. Sie wusste, dass das unbefangene Leben, das die beiden als Kinder für eine kurze Zeit führen konnten, für sie im Alter, wenn andere von Pflichten frei werden, nicht wiederkehren würde.
Es war Helmut Schmidt nicht in die Wiege gelegt, dass er als geehrter und respektierter Politiker in seine Heimatstadt zurückkehren sollte. Seine Herkunft war bescheiden, um ein Haar wäre sie ärmlich gewesen. Hätte es das Schicksal ein klein wenig anders gewollt, wäre sein Vater womöglich in die Sackgasse der Armut geraten. Aber sein Vater konnte sich durchkämpfen, und er selbst auch. Dies erklärt, weshalb Helmut Schmidt zeitlebens Pflicht und Disziplin für höchste Tugenden hielt, und auch, wieso er im Grunde seines Herzens stets Sozialdemokrat blieb – obwohl er oft auf Distanz zu seiner Partei ging und diese ihm auch nicht immer treu ergeben war.