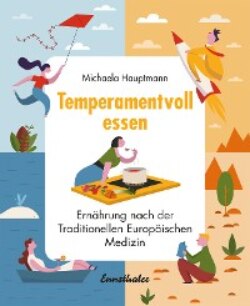Читать книгу Temperamentvoll essen - Michaela Hauptmann - Страница 18
Vier Säfte, mehr als Stoffliches
ОглавлениеDie TEM spricht von vier Körpersäften, den »Humores« (was griechisch-lateinisch so viel wie Feuchtigkeit, Leibessaft bedeutet): Sanguis, Chole, Phlegma, Melanchole. Diese vier Säfte sind die Vertreter der Elemente, sie entstehen aus der Verdauung und von ihnen leiten sich die Temperamente ab.
Bei dieser Zuordnung siehst du zuerst die Beschreibung der Qualitäten. Feuchtigkeit gibt es eben in unterschiedlichen Qualitäten, und darauf beruht auch die Zuordnung der Elemente.
• Sanguis ist wie das Blut feucht und warm. Es stellt durch Feuer bewegtes Wasser dar und ist Vermittler der Vitalkräfte. Sanguis repräsentiert das Element Luft und steht für den Sanguiniker.
• Chole, auch Cholera genannt, die Gelbgalle, ist warm und trocken. Sie bewegt und verändert das Feuer durch umwandelnde Kräfte. Chole repräsentiert das Element Feuer und steht für den Choleriker.
• Melanchole, auch Melancholera genannt, die Schwarzgalle, ist trocken und kalt. Sie gibt Stütze, setzt Grenzen und symbolisiert Verbrauchtes. Melanchole repräsentiert das Element Erde und steht für den Melancholiker.
• Phlegma, der Schleim, ist kalt und feucht. Er nährt das Feuer mit Substanz und ist die Urquelle aller Feuchtigkeit. Phlegma repräsentiert das Element Wasser und steht für den Phlegmatiker.
| Primärqualitäten der Säfte | warm | kalt |
| feucht | Sanguis – Blut | Phlegma – Schleim |
| trocken | Chole (Cholera) – Gelbgalle | Melanchole (Melancholera) – Schwarzgalle |
Die Humores, die vier Körpersäfte, sind allerdings keineswegs real vorhandene, stoffliche Säfte, wie du es vielleicht mit Blut ganz wunderbar assoziieren könntest. Doch was sind Gelbgalle, Schwarzgalle und Phlegma? Jeder Chirurg schüttelt hier den Kopf – zu Recht. Diese Säfte hat er noch nicht gesehen, denn sie gibt es so nicht. Diese vier Säfte beschreiben Funktionskreisläufe der alten Medizin.
Komplexe Vorgänge wurden über die Funktionskreisläufe verständlich, einfach und nachhaltig beschrieben. So einfach, dass auch heute noch aufbrausende Menschen als Choleriker und Menschen, die nicht aus der Ruhe zu bringen sind, als Phlegmatiker eingestuft werden. Eingeweihte wissen, dass dies nicht ganz so ist, dass mehr dazugehört.
Der Kochtopf als bildliche Darstellung für das Funktionsprinzip der vier Säfte:
Essen über offenem Feuer zu kochen, stellt das Funktionsprinzip der vier Körpersäfte einfach und anschaulich dar. Der Kochtopf und die Asche symbolisieren die Melanchole. Der Kochtopf ist das Begrenzende, die Asche das Verbrauchte. Das Feuer symbolisiert Chole, jene Energie, die den Topfinhalt – das Wasser bzw. Phlegma – als die nährende Substanz bewegt. Der entstehende Wasserdampf symbolisiert Sanguis, das luftige und vitalisierende Element. Dieses Prinzip, dieser Funktionskreislauf, muss genährt werden und dafür sind alle Säfte und die damit verbundenen Kräfte erforderlich.
Feuchtigkeit ist das Feuer des Lebens.
Sanguiniker, der luftige Blut-Typ
Der Sanguiniker ist, abgeleitet von der alten Medizin, der Blut-Typ. Blut, das Sanguis, steht für Feuchte und Wärme.
Das Funktionsprinzip des Sanguis durchfließt alle warmen und feuchten Gewebe und Organe und versorgt diese mit Nährstoffen. Sanguis findet man vor allem in Blut, Haut, Lunge, Leber und Nieren, also in allen gut durchbluteten Organen. Es bewegt und ist bewegt, allerdings sanfter und luftiger als das cholerische Prinzip. Das Sanguis-Prinzip ist auch wunderbar mit der Kindheit und dem Frühling zu beschreiben. Alles entsteht und sprießt mit einer kindlichen Leichtigkeit.
Im Bildnis der TEM entwickelte sich der Sanguiniker in einem Gebiet, in dem es durch ein gemäßigtes Klima ein reichhaltiges Nahrungsangebot gab. Aufgrund dessen hat er keine Sorge, genügend Nahrung zu finden – es gibt sie immer und überall. Da er dadurch auch keinen Hunger zu befürchten braucht, ist er sehr ausgeglichen. Oft ist er gut gelaunt, lustig und geht optimistisch durchs Leben. Er handelt spontan, oft auch unüberlegt. Er ist sehr kreativ und einfallsreich.
Das sanguinische Temperament steht wegen der besonders lebenswerten Qualitäten – Mischung warm und feucht – für das Prinzip des Lebens.
Die Körper- und die Kopfform des Sanguinikers sind oval. Die Lippen sind voll und kräftig. Der Gesichtsausdruck ist auch in fortgeschrittenen Lebensjahren jugendlich und frisch. Die Nase ist kurz. Die Augen sind groß und voller Neugierde. Der Sanguiniker hat einen guten Tastsinn, man spricht auch von Menschen mit einem besonders guten Fingerspitzengefühl.
Choleriker, der feurige Galle-Typ
Der Choleriker ist, abgeleitet von der alten Medizin, der Gelbgalletyp. Die Gelbgalle (Chole) steht für Trockenheit und Wärme.
Chole steht für Dynamik. Chole ist bewegt und bewegt auch. Das Phlegma beispielsweise wird durch die beschleunigend wirkende Gelbgalle bewegt und verändert. Alle Säfte, die sich in Herz, Muskulatur, Nerven und Nieren befinden – somit auch das Blut –, sind von Chole dominiert. Das Erwachsenenalter, also von der Pubertät bis zur beginnenden Alterung, ist jene Lebenszeit, die von Chole geprägt ist.
Der Choleriker stammt aus Sicht der TEM aus einer Zeit, in der es ausreichend Nahrung gab. Ein Sammler und Jäger, der mal mehr und mal weniger fand oder erlegte.
Unter dem Begriff »cholerisch« versteht man weit mehr als »leicht reizbar« oder »energisch«. Der Choleriker macht seiner Meinung Luft. Das wirkt im Moment herzlos, intolerant und egoistisch. Doch der Choleriker ist nicht nachtragend. Er sagt seine Meinung – meist lautstark – und damit ist es auch schon wieder getan. Choleriker sind willensstark und haben Durchsetzungsvermögen. In den Führungsetagen finden sich vorwiegend Choleriker, männlich wie weiblich. Organisation ist ihre Stärke.
Optisch erkennt man den Choleriker an einer ausgeprägten Muskulatur und bewussten Spannung. Gesicht und Körperform sind kantig. Das Gesicht hat markante Jochbeine und möglicherweise Stressfalten zwischen den Augenbrauen und an den Ohren. Der Händedruck ist ähnlich kräftig wie sein Biss.
Melancholiker, der erdige Schwarzgalle-Typ
Der Melancholiker ist, abgeleitet von der alten Medizin, der Schwarzgalle-Typ. Die Schwarzgalle (Melanchole) steht für Trockenheit und Kälte. Melanchole ist das Prinzip jener Säfte, die man sich am besten in den begrenzenden Oberflächen des Körpers vorstellt, sie sind vorwiegend trockene Substanz: Haut, Knochen, Haare, Nägel und Faszien sind von Melanchole dominiert.
Melanchole reiht man in die Zeit des fortgeschrittenen Erwachsenenalters ein, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass Melancholiker immer alt sind. Keineswegs. Aber je älter wir werden, umso stärker entwickelt sich das melancholische Temperament – sowohl beim Melancholiker selbst als auch bei allen anderen Temperamenten. Der Melancholiker wird in der Kindheit ebenso vom sanguinischen Temperament geprägt wie der Phlegmatiker und der Choleriker.
Der Melancholiker entwickelte sich aus Sicht der TEM in einer besonders karstigen Region, einer Gegend mit unfruchtbaren, steinigen Böden sowie schlechter Versorgung. Diese Kargheit prägte auch seinen Charakter. So lebt er eher zurückgezogen, ist oftmals ängstlich und leicht enttäuscht. Er neigt zu geizigen Zügen, hängt gern seinen Gedanken nach und wirkt daher verschlossen. Sein Wesen wird bestimmt von Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit. Er ist einfühlsam, hilfsbereit und nimmt Rücksicht auf Schwächere. Kunst und Kultur sind die Dinge, an denen er sich besonders erfreut.
Optisch ähnelt der Melancholiker dem Choleriker – doch ist er nicht kantig, sondern lang und meist dünn, eher hager und zierlich. Es sind die Faszien und nicht die Muskeln, die einen hohen Tonus aufweisen. Hochgezogene Augenbrauen sind typisch, ebenso ein schwacher Händedruck und eine trockene, durchscheinende Haut.
Phlegmatiker, der nährende Schleim-Typ
Der Phlegmatiker ist, abgeleitet von der alten Medizin, der Schleim-Typ. Der Schleim, das Phlegma, steht für Feuchte und Kälte. Phlegma steht für das nährende Prinzip. Es muss bewegt und geformt werden, um zu nähren, und darf nicht erstarren. Phlegma steht für die Feuchte im Bindegewebe, in den Fettzellen, im Knochenmark und Gehirn.
Zwei Phasen im Leben stehen für das phlegmatische Prinzip: das Säuglings- und Greisenalter.
• Es beginnt bereits mit der Schwangerschaft – sowohl die Mutter als auch das in ihr heranwachsende Kind sind in einem Phlegma-Hoch. Auch die Stillzeit, die nährende Zeit, ist für beide, Mutter und Säugling, eine besonders phlegmatische Phase.
• Schließlich der Übergang ins »Greisenalter«. Nun setz dich bitte nieder: In der alten Medizin hat man diesen Übergang bereits ab dem 40. Lebensjahr (!) gesehen. Tja, damals war die Lebenserwartung deutlich niedriger als heute.
Der Phlegmatiker ist aus Sicht der TEM der Gewinner der Eiszeit. Er ist angepasst an eine Epoche, in der es nur fallweise zu essen gab. Dann aber reichlich. Durch die lange Periode des Fastens – Mammut gab es nicht so häufig – entwickelten sich ein gieriges Verhalten und die Fähigkeit, große Speicher anzulegen. Die beiden Pole Essenspausen und Essenszeiten sind für den Phlegmatiker essenziell. Zu oft wird heute auf die Pausen, das Fasten, vergessen. Das Nahrungsangebot ist einfach zu dominant.
Die Wesenszüge des Phlegmatikers haben sich manifestiert. Man meint genau zu wissen, wann jemand ein Phlegmatiker ist. Schlägt man das Wort »phlegmatisch« im Duden nach, findet man folgende Bedeutung: »[aufgrund der Veranlagung] nur schwer zu erregen und kaum zu irgendwelchen Aktivitäten zu bewegen; träge, schwerfällig«.
In der TEM wird der Phlegmatiker als ruhig und gemütlich beschrieben. Er wirkt bedächtig, sachlich und selbstsicher. Nichts wirft ihn so leicht aus der Bahn, er ist nervenstark, stressresistent und anpassungsfähig, dadurch beständig und verlässlich.
Auch äußerlich kann man den Phlegmatiker, sofern die Merkmale ausgeprägt sind, erkennen. Er hat häufig einen rundlichen, sanften Körperbau, eine große Nase und große Ohren sowie kräftige Ohrläppchen und volle Lippen. Die Wangen sind pausbäckig und die Augenbrauen haben einen kräftigen, wilden Wuchs. Die Hände sind fleischig und füllig.