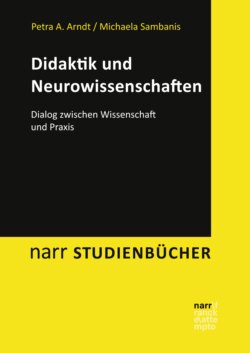Читать книгу Didaktik und Neurowissenschaften - Michaela Sambanis - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.7 Umgebungseinflüsse und Förderung der Entwicklung
ОглавлениеIn diesem Kapitel wurde ausführlich beschrieben, wie die Hirnreifung LernprozesseLernprozesse anregt und unterstützt, aber auch, dass bestimmte Abläufe und deren zeitliche Bedingungen verschiedentlich zu Einschränkungen führen. Wichtig ist, dabei anzuerkennen, dass bestimmte Abfolgen zwar festgelegt sind, man der Hirnreifung aber nicht hilflos ausgeliefert ist. Sowohl die Entwicklungsgeschwindigkeit als auch die Qualität der Entwicklung lässt sich beeinflussen. Allerdings helfen weder gutes Zureden noch Ermahnungen und kurzfristig ist ohnehin nichts zu erreichen. Langfristig jedoch ist das Gehirn, wie etwa auch die Muskulatur, trainierbar. Eine Vielfalt an Anregungen, Freiräume für eigene Erfahrungen und gezielte Herausforderungen unterstützen und beschleunigen die Entwicklung des Gehirns. Um genauer zu sein: Das Gehirn ist in seiner Entwicklung auf den Einfluss der Erfahrung angewiesen. Die Anregungen und Anforderungen der Umwelt formen das Gehirn (vgl. Diamond & Amso 2008). Dabei ist es wichtig, nicht von der Herausforderung in die Überforderung zu geraten. Wenn das passiert, weichen die kindlichen Gehirne, wie oben beschrieben, auf alternative StrategienStrategien aus und die Entwicklung profitiert nicht in der gewünschten Weise. Vielmehr werden die alternativen Strategien und damit die Verbindungen gestärkt, die zur Verhaltensweise der früheren Entwicklungsstufe gehören. Das behindert logischerweise den Fortschritt der Entwicklung.
Die Effekte von Anregungen sind vielfach nachgewiesen. Beispielsweise zeigen Drei- bis Fünfjährige, denen zu Hause viel vorgelesen wird, eine höhere AktivierungAktivierung der Hirnareale, die an Vorstellungsvermögen und auditivem Textverständnis beteiligt sind (vgl. Hutton et al. 2015). Verschiedene auf neurobiologisches Wissen aufbauende Programme fördern erfolgreich die Entwicklung kognitiver FertigkeitenFertigkeiten und Grundlagen der weiteren Lernfähigkeit bei Kindern (vgl. Diamond et al. 2007, Hermida et al. 2015).
Die Diskussion um den spontanen Entwicklungsverlauf und die Bedeutung der „künstlichen“ Förderung und Beschleunigung der Entwicklung – durch welche Form an Unterricht im weiteren Sinne und kommunikativer, sozial unterstützter Auseinandersetzung mit Erfahrungen und Konzepten auch immer – ist beileibe nicht neu. Ausführlich dokumentiert ist sie seit den Arbeiten von Wygotski (1964) und Piaget (1995) – was nicht bedeutet, dass sich Lehrkräfte früherer Epochen nicht bereits damit auseinandergesetzt hätten. Während Piaget seine Arbeit überwiegend in dem Sinne versteht, dass er den spontanen Entwicklungsverlauf beschrieben habe, betont Wygotski die Wichtigkeit von Lehrprozessen für die (kognitive) Entwicklung. Aus Sicht der Hirnforschung allerdings ist diese Abgrenzung nur sehr eingeschränkt nachvollziehbar. Das menschliche Gehirn ist sozusagen darauf programmiert, genau das aufzunehmen, zu lernen und als Basis seiner Entwicklung zu nutzen, was in der Welt, die das sich entwickelnde Gehirn um sich herum wahrnimmt, vorkommt. Käme in unserer Welt oder Teilen unserer Welt die Farbe Blau nicht vor, würde die Fähigkeit, diese Farbe wahrzunehmen, verkümmern. Bei Menschen, die im Dschungel aufwachsen und nie große freie Flächen sehen, entwickelt sich das SehsystemSehsystem anders als bei Menschen die in Savannen, Wüsten oder in einer gerodeten Kulturlandschaft groß werden. Oder, um ein aktuelleres Beispiel zu wählen: 80 % der Kinder in Singapur sind am Ende der Grundschulzeit kurzsichtig, weil sie sich wenig außerhalb geschlossener Räume aufhalten und selten in die Ferne blicken können, sondern stattdessen viele Stunden lernen müssen (in der Schule, zusätzlichen Nachhilfeschulen und abends mit den Eltern) und dabei nur in Bücher und auf Tablets starren (vgl. Spiewak 2017, Spitzer 2016).
Letztlich geht es darum, dass sich der LernprozessLernprozesse und damit die Hirnentwicklung den tatsächlich vorgefundenen Bedingungen anpassen. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Sprache. Kommen in einer Sprache bestimmte Laute nicht vor oder sind die Grenzen zwischen Lauten nicht bedeutsam, werden sie in den sprachverarbeitenden Hirnarealen nicht gespeichert, z.B. die Trennung von /l/ und /r/ im Chinesischen. Die menschliche Sprache ist ein Kulturgut, das Erwachsene benutzen, oftmals während Kinder anwesend sind, teilweise zur Kommunikation mit anderen, teilweise zur Kommunikation mit dem Kind. Hier könnte man im Sinne Piagets von einer spontanen AneignungAneignung ausgehen. Trennscharf ist die Abgrenzung zwischen spontanem und „künstlich“ angeregtem Entwicklungsprozess aber nicht. Gut untersucht ist, dass es für die Sprachaneignung wichtig ist, dass Sprache im sozialen Kontext genutzt wird (vgl. Kuhl 2010). In vielen Kulturen wird auch mit den Kindern gesprochen, um die Sprachentwicklung zu fördern. In diesem Fall wird der Lern- und Erfahrungsvorgang von einer anderen Person bewusst angeregt und wir würden ihn nicht als spontanen Entwicklungsvorgang bezeichnen. Dem kindlichen Gehirn ist das letztlich gleichgültig. Die andere Person, ebenso wie die Anregungen, die von ihr ausgehen, sind Teil der Umwelt und wenn sie regelmäßig vorkommen – egal, ob mit dem Ziel, einen Entwicklungsprozess anzuregen oder zu einem anderen Zweck –, sind sie es wert, beachtet zu werden. Das, was in der Welt existiert, wird wahrgenommen. Wenn viel gesprochen wird, lernt das Kind schnell, egal, warum viel gesprochen wird. Wenn weniger gesprochen wird, lernt es langsamer und weniger Wörter (vgl. Spitzer 2015). Je nach Anregung aus der Umgebung lernen Kinder unterschiedliche Objekte, FertigkeitenFertigkeiten, Kategorien und Konzepte. Ein Kind, dessen Eltern einen Bauernhof besitzen, lernt ganz andere Dinge als ein Stadtkind. Ein Kind, dessen Vater Schreiner ist und der in seinem Beruf aufgeht, erfährt vielleicht schon sehr früh etwas über Werkzeuge, Holzarten und Hobeltechniken. Ein Kind, dessen Mutter Biologin ist, mag neben dem Namen Gänseblümchen auch den lateinischen Namen Bellis perennis kennen. Vielleicht hat ihm seine Mutter auch erklärt, dass das Gänseblümchen zur Familie der Korbblütler gehört und z.B. mit dem Löwenzahn und der Aster verwandt ist. Ohne größere Schwierigkeiten wird das Kind auch eine Margerite oder eine Ringelblume als Korbblütler erkennen – ebenso leicht wie ein kleiner Autofan das neueste Modell einer bestimmten Automarke zuordnen kann.
An den Beispielen sieht man, dass es in der Welt vieles gibt, das vielleicht relevant ist, aber nicht regelmäßig in der Umwelt aller Kinder vorkommt. Um dem zu begegnen, haben Menschen eine Art Katalog des notwendigen Wissens aufgestellt, dieses Wissen systematisiert und sich überlegt, wie sie es an die Kinder und Jugendlichen herantragen. Zu diesem Zweck schicken wir Kinder und Jugendliche in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Hochschulen. Damit erzeugen wir allerdings eine Situation, die von unserer Seite aus mit der Erwartung verbunden ist, dass das Gehirn etwas Bestimmtes lernt, dass ein exakt definiertes Lernziel erreicht oder auch eine bestimmte Kompetenz erworben wird. Darauf sind Gehirne aber nicht ausgerichtet. Sie lernen nicht das, was man ihnen zu lernen aufträgt, sondern die Dinge, die häufig vorkommen oder die sie selbst häufig tun (zu Üben und Wiederholen im Unterricht vgl. das Praxisfenster in Kap. 6).
Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass der sich entwickelnde Organismus im Rahmen seiner Möglichkeiten genau die Erfahrungen erzeugt, aufsucht oder wiederholt, die seiner Entwicklung im gegenwärtigen Moment von allen in der jeweiligen Situation verfügbaren Erfahrungen am dienlichsten sind. Der Organismus sucht sich also einen Teil seiner Erfahrungen selbst. Dabei können die Beschränkungen der in einer Umgebung möglichen Erfahrungen ebenso negative und beeinträchtigende Effekte auf die Entwicklung haben wie ungeeignete und schädliche Erfahrungen. Beispielsweise kann ein Kind, das die Veranlagung besitzt, ein virtuoser Pianist zu werden, dies nicht umsetzen, wenn in seiner Umgebung nicht die Möglichkeit besteht, das Klavierspiel zu erlernen – etwa aufgrund kultureller Gegebenheiten, wenn es in seiner Kultur keine Klaviere gibt, oder aufgrund sozialer Gegebenheiten, wenn die Familie sich weder ein Klavier noch die Kosten der Klavierstunden leisten kann. Auch die Frage nach dem „relativen Anteil“, den genetische Voraussetzungen und (gesellschaftlich geprägte) Erfahrungseinflüsse auf die Ausbildung von Eigenschaften haben, lässt sich nicht ganz eindeutig beantworten. Für viele Eigenschaften bewegt sich der Einfluss der Umwelt in westlichen Gesellschaften zwischen 40 und 60 %. In der – rein hypothetischen – „besten aller Welten“, in der jeder heranwachsende Mensch zu jeder Zeit genau die Möglichkeiten und Lernanreize bekäme, die er in dem Moment zur optimalen Entwicklung benötigte, würden alle Unterschiede zwischen den Individuen nur noch auf genetische Faktoren zurückgehen, denn die Umwelteinflüsse würden der Entwicklung keine Grenzen mehr auferlegen (vgl. Asendorpf et al. 2012).
Um in der Entwicklung weiterzukommen, greift das Gehirn zu einem Trick: Dinge, Konzepte und Ereignisse, die längst bekannt und gelernt sind, sind langweilig (zu Langeweile vgl. 3.7). Kinder wenden sich von ihnen ab. Neues löst Interesse und Zuwendung aus, es sei denn, es ist so fremd und anders, dass man davor AngstAngst haben müsste oder dass man es, wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, einfach nicht hinbekommt. Wir nennen die Hinwendungsreaktion auf Neues „NeugierNeugier“. Das, was gerade noch nicht gelernt ist, aber nahe genug am schon Bekannten ist, suchen Kinder aktiv auf bzw. wählen die entsprechenden Anregungen aus dem vorhandenen Angebot. In dieser Weise formt und fördert das kindliche Gehirn seine eigene Entwicklung sozusagen selbst (vgl. Johnson 2003), es sei denn, es wird durch ungünstige Umgebungsbedingungen daran gehindert. Dabei ist von außen oft nicht einmal zu erkennen, dass das Kind beispielsweise gerade etwas über Satzbau oder soziale Beziehungen lernt, wenn es sich das immer selbe Märchen zum einhundertsten Mal vorlesen lässt oder dass es gerade etwas über Statik oder Mengen und Gewichte lernt, wenn es im Sand spielt.
An den Beispielen sieht man aber auch sehr gut, dass der Austausch mit Erwachsenen oder mit erfahreneren Kindern durchaus wichtig für das sich entwickelnde Kind ist, etwa, wenn Zusammenhänge erklärt oder soziale Situationen gemeinsam reflektiert werden. Diese gemeinsame Auseinandersetzung, der soziale Austausch, ist für die Hirnentwicklung und die LernprozesseLernprozesse sogar zwingend notwendig. Kinder, die ohne soziale Unterstützung ihrer Lern- und Entwicklungsprozesse auskommen müssen, bleiben in ihrer Entwicklung zurück. Dabei ist Sprache, die die Wahrnehmung, das DenkenDenken und Konzepte verdeutlicht, ein zentrales Element. Wie wichtig Sprache ist, lässt sich an den verheerenden Folgen erkennen, die sich zeigen, wenn ein Kind nicht hören und sprechen kann und zudem keine Gebärdensprache als Kommunikationsmittel zur Verfügung steht, wenn also keine Anregung durch Kommunikation möglich ist. Aber auch eine eingeschränkte Anregung, etwa aufgrund von Vernachlässigung oder, je nach Qualität der Einrichtung möglicherweise auch durch Heimunterbringung, führt zu Defiziten sowohl in der kognitiven als auch in der sozialen Entwicklungsoziale Entwicklung, die oft nur schwer auszugleichen sind (vgl. Marshall & Kenney 2009). Ebenso hat die Benachteiligung etwa durch niedriges Familieneinkommen und niedrigen Bildungsstand der Eltern nachweisbare Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns (vgl. Noble et al. 2015). Selbst die übliche Variationsbreite in der Form und Intensität der elterlichen Zuwendung führt zu Unterschieden in der Hirnstruktur von Kindern (vgl. Kok et al. 2015). Das menschliche Gehirn ist also tatsächlich darauf ausgerichtet, derartige Anregungen zu erhalten. Nur so kann ein Kind sich normal entwickeln und nur so kann es unser kulturelles Erbe antreten.
Dass wir Kindern in der sozialen Situation Wissen zur Verfügung stellen, sie also unterrichten, ist für das Gehirn nicht unerwartet und nicht das „Problem“ an der Schule. Allerdings lassen wir in der Schule die aktive Suche nach der gerade passenden Anregung und dem zugehörigen sozialen Austausch häufig nicht zu. Vielmehr wird oft vorgeschrieben, was der nächste Lernschritt sein soll – und der passt manchmal zu dem, was im Gehirn vorhanden ist, manchmal auch nicht.
Dabei ist der Prozess der AneignungAneignung aus „Sicht des Gehirns“ immer derselbe, egal, ob es sich um eine natürliche Anregung oder um einen didaktischen, von Eltern oder Lehrkräften angeregten Prozess handelt. Die Art des Aneignungsprozesses wird vom Inhalt bestimmt und davon, ob man sich alleine oder im Austausch mit anderen mit diesem Inhalt beschäftigt. Ob irgendjemand anderes eine lehrende Absicht mit der Situation verbindet, ist emotional und motivational bedeutsam und kann zu Versagensängsten, Widerstand oder auch zu einem Anstieg der MotivationMotivation führen (Ich tue das, weil ich der Lehrkraft eine Freude machen will).
Bei didaktischen Situationen mit bestimmten Lernzielen sind verschiedene Ebenen und Details zu beachten. Hierzu ein Beispiel aus dem Bereich der KonzeptbildungKonzeptbildung: Wörter, Sätze und Satzstrukturen werden gelernt, indem man mit der Sprache in Kontakt kommt, sie hört und versucht, sie selbst als Kommunikationsmittel zu nutzen – egal ob als Kleinkind in der Familie, später im Unterricht oder bei einem Urlaub in einem fremdsprachigen Land.
Sprache ist die Basis für die KonzeptbildungKonzeptbildung und bereits hier gibt es, wie wir oben gesehen haben, Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern. Sowohl die Bildung spontaner Konzepte, z.B. Hund, Spielzeug, wie auch die Bildung komplexerer Konzepte einschließlich wissenschaftlicher Konzepte, wie Leben, Energieerhaltungssatz etc., beginnt im Grunde mit dem Erlernen des zugehörigen Wortes und seiner Grundbedeutung (vgl. Shayer 2003). Dem folgt die Sammlung von Beispielen, etwa verschiedene Hunderassen, und die Abgrenzung zu Tieren, die nicht in die Kategorie gehören, z.B. Katzen und Füchse oder auch die Sammlung von Beispielen für Energieerhaltung. Man sammelt so lange Beispiele, bis sich das Konzept verfestigt hat. Ein Blick in die Physikbücher zeigt, dass dieses Vorgehen im Prinzip didaktisch aufgegriffen wird, allerdings haben Schülerinnen und Schüler, die ein Konzept sehr schnell und umfassend verstehen, in der Regel keine Chance, auf die zusätzlichen, für den individuellen LernprozessLernprozesse dann letztlich überflüssigen Beispiele zu verzichten. Hier wird also nicht mehr gelernt, sondern allenfalls das Durchhaltevermögen trainiert. Andererseits stehen den Lernenden, die mehr Beispiele benötigen würden, diese oftmals nicht zur Verfügung, sodass auch hier nicht gelernt wird – wenn auch aus völlig anderen Gründen. Angenommen, der Lernprozess gelingt und ein Konzept ist anhand von Beispielen hinreichend eingegrenzt, dann kann man im nächsten Schritt beginnen, die Eigenschaften des Konzepts zu verbalisieren, um eine Grundlage dafür zu schaffen, das Konzept flexibel in unterschiedlichen Zusammenhängen einzusetzen. Bei Grundschulkindern ist das für konkrete Konzepte gut möglich und es ist gut, das Vorgehen im Grundschulalter bereits einzuüben. Abstrakte Konzepte können erst ab dem dritten WachstumsschubWachstumsschub des Gehirns, also um das Alter von 11 bis 12 Jahren, bewältigt werden. Interessant ist, dass das Erlernen grammatikalischer Regeln im Fremdsprachenunterricht häufig auch die Ausbildung von Konzepten verlangt, also auch hier die Prozesse bei der Konzeptbildung einschließlich der jeweils notwendigen Anzahl verschiedener Beispiele zu berücksichtigen ist. Wie viele Beispiele es braucht, wann es an der Zeit ist, das Konzept umfassend zu verbalisieren und wann der Prozess vollständig abgeschlossen ist, sodass man ein neues Konzept einführen kann, ist eine schwierige Frage, die nur individuell beantwortet werden kann.
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass LernprozesseLernprozesse in der Entwicklung des Gehirns angelegt sind und ohne sie eine gesunde Entwicklung des Gehirns völlig unmöglich ist. Je nach Alter des Kindes stehen unterschiedliche Inhalte im Vordergrund. Auch die Art der möglichen Lernprozesse und der Grad der möglichen Komplexität des jeweiligen Inhalts ist altersabhängig. Lernen und Entwicklung vollziehen sich dabei nicht nur in der individuellen Auseinandersetzung mit der Umwelt. Vielmehr sind Kinder und Jugendliche auf eine kommunikative Interaktion mit anderen Menschen angewiesen, die ihnen z.B. helfen, Beobachtungen richtig einzuordnen, Zusammenhänge zu verstehen, Konzepte zu entwickeln und Hypothesen zu generieren. Insofern ist (schulischer) Unterricht keine Situation, die den normalerweise beim Lernen auftretenden Hirnprozessen zuwiderlaufen würde – das zur Beruhigung alle Didaktikerinnen und Didaktiker in der Leserschaft. Allerdings ist zu beachten, dass einige der Rahmenbedingungen, die in natürlich auftretenden Lernprozessen normalerweise vorhanden sind, im Unterricht u.U. fehlen. Hierzu gehören z.B. die spontane Bindung der Aufmerksamkeit (vgl. Kap. 3) und die damit zusammenhängende Motivation (vgl. Kap. 4), die Lernprozesse und die Verankerung von Gedächtnisinhalten unterstützen (vgl. Kap. 6).