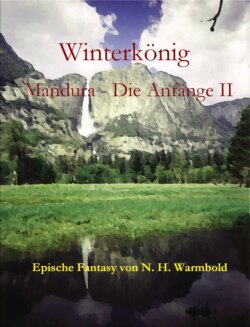Читать книгу Winterkönig - N. H. Warmbold, Nicole Heuer-Warmbold - Страница 9
Kapitel 6 – Der untere Tempel
ОглавлениеMüßig schaute Tessa aus dem Fenster, über den dunstigen Hang hinweg auf die Silhouette der Stadt. Immerhin besser als der regennasse Palasthof, dieser Anblick war dann doch zu trübselig, langweilig geradezu. Dann lieber der Blick über die Hauptstadt, die wie geduckt, wie an den Boden gepresst unter den niedrig hängenden Wolken lag. Sie übertrieb, die Beschreibung passte so gar nicht; ‚Samala Elis‘ und ‚gepresst‘. Doch eine bessere fiel ihr nicht ein.
Seufzend stützte sie das Kinn auf die Hand, vergaß den Bogen mit den Kritzeleien vor sich – was sollte das eigentlich darstellen? – und ließ die Gedanken wandern. Heraus aus den schützenden Mauern und dann durch das gewaltige Nordtor hinaus in Richtung Saligart, ihrem Bruder entgegen. Sie wusste nicht, wann Reik zurück sein wollte, heute, morgen, in den nächsten Tagen, aber sie freute sich auf ihn. Sie ertrug es nur schwer, wenn er so lange fort blieb, sie spürte stets eine merkwürdige Unruhe in sich, fühlte sich immer ein bisschen … Nicht zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, ihn einfach zu begleiten, mit der Garde reiten. Innerlich musste sie lachen: der Traum eines jeden Jungen in Mandura. Doch darum ging es ihr nicht. Bloß um die Gesellschaft, die Nähe und Gegenwart ihres Bruders.
Und sein Zweiter hieß Gerol, der andere Len, schnell ergänzte sie die Angaben auf dem Blatt, überlegte. Sandars Zweite, hm, der eine Lokar oder Lokan, sie wusste es nicht genau, vielleicht sollte sie Sandar fragen. Oder Guy. Aber Guy war in Hauptmann Ladrus Einheit und nicht dessen Zweiter. Guy war zuvorkommend und freundlich, ganz anders als die meisten Gardisten, nicht so steif und unnahbar. Und vor allem nicht so einschüchternd und barsch wie der Hauptmann, der nahe der Tür stand. Hauptmann Davian. War der nicht gestern schon hier gewesen? Vor dem hatte sie tatsächlich etwas Angst, obwohl sie mit dem Mann überhaupt nichts zu tun hatte und nie haben würde.
Sie und ein Gardehauptmann: der Gedanke war geradezu absurd. Und doch gar nicht so abwegig, denn Lucinda würde bald einen Gardehauptmann heiraten, ihren Vetter Sandar; es existierte schon lange ein Vertrag zwischen den Familien. Tessa könnte sich durchaus vorstellen, Sandar zu heiraten, doch der war ja schon vergeben. Sie konnte ihn gut leiden. Er war vielleicht etwas zu groß für sie, aber schließlich war sie deutlich größer als Lucinda. Und womöglich war sie ein bisschen zu nah mit ihm verwandt, ihre Mutter war die Schwester seines Vaters.
Wieder betrachtete Tessa das vor ihr liegende Blatt. Gettis Zweite kannte sie wirklich nicht mit Namen, Lucinda sicher auch nicht, und Hirons Zweite? Ob Ondra die Namen wusste, immerhin war Hiron doch ihr Bruder, einer ihrer Brüder. Aber Ondra hatte sich nie sonderlich für die Garde und deren Belange interessiert, schon damals nicht, und … Tessa konnte den Gedanken nur schwer ertragen, dass ihre Base damals nicht Reik, sondern Leif geheiratet hatte. Sie spürte wieder die alte Wut und Enttäuschung … Obwohl sich ihre Enttäuschung in Grenzen gehalten hatte. Nur wegen einer Feier, die ihr entgangen war? Es hatte dann ja doch eine Feier gegeben, und insgeheim war sie ganz froh, ihren Bruder noch etwas länger für sich zu haben.
Tessa unterdrückte ein Kichern: Als hätte sie Reik jemals für sich gehabt. Himmel, er war ihr Bruder! Sie starrte weiter angestrengt auf das Blatt Papier mit ihren Eintragungen. Wozu überhaupt notierte sie die Namen der Hauptleute der einzelnen Gardeeinheiten, darunter auch noch die Namen der jeweiligen Zweiten? In ein, zwei Fällen gab es sogar drei Zweite, wer hatte ihr das eigentlich erzählt? Aber sie ordnete nun einmal gern die Dinge um sich herum, schrieb auch gern, hatte das immer gemocht ...
Sie vermied es, zu offensichtlich zu dem Mann an der Tür zu blicken, ihn würde sie sicher nicht danach fragen. Er würde sie auslachen, oder schlimmer noch, sie belehren und ihr vorhalten, dies ginge sie …
Tessa fuhr zusammen, als er plötzlich, in gebührendem Abstand, neben ihr stand. Sie sah keine Notwendigkeit darin, das Blatt mit den Armen zu verdecken. Schließlich tat sie nichts Verwerfliches.
„Es muss ‚Lokar‘ heißen“, bemerkte der Hauptmann, „nicht ‚Lokan‘.“
„Danke …“, stieß Tessa hervor und wagte nicht aufzuschauen oder dem Mann gar ins Gesicht zu schauen. „Wisst Ihr zufällig auch die Namen … ich meine … oh, oh entschuldigt, ich …“ Sie konnte nur stammeln, dann verstummte sie. Was redete sie da? Selbstverständlich kannte der Mann die Namen der Zweiten aller Einheiten, vermutlich kannte er sogar die Namen sämtlicher Gardisten in jeder Einheit. Er war Gardehauptmann!
„Zufällig, ja.“ Er grinste nicht, war die Ernsthaftigkeit in Person, und seine Stimme klang ganz und gar sachlich. Dann deutete er mit dem Finger auf den Bogen und nannte ihr ohne zu zögern die entsprechenden Namen.
Hastig schrieb Tessa mit, ihre Schrift furchtbar krakelig und zittrig.
„Interessante Art der Darstellung.“
„Aha, ja …“, sie lachte unsicher. „Meint Ihr? Ich wollte das … die Namen nur übersichtlich anordnen, und … Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso.“
Hauptmann Davian, der Hauptmann Davian, zuckte die Achseln. Sie kannte ein paar der Gerüchte über ihn, hatte sich allzu oft Lucindas Gerede anhören müssen, die den Mann nicht ausstehen konnte. „Mancher Ostländer würde dafür bezahlen.“
„Aber…“, erschrocken sah sie ihn an. „Ist das etwa geheim?“
„Nein, aber nützlich. Bewahrt das gut auf“, riet er ihr ernst.
„Das … das werde ich, wirklich.“
Vielleicht sollte sie den Bogen vernichten, einfach verbrennen; aber der Gedanke missfiel Tessa. Sie würde ihn sorgsam aufbewahren.
* * *
Am Nachmittag begab Mara sich wie abgemacht zu Réa.
Zwei Frauen leisteten der jungen Priesterin Gesellschaft, auf Bett, Bank, Tisch und Stühlen lagen Kleider und Stoffe unterschiedlichster Farbe und Qualität ausgebreitet. Die beiden musterten Mara neugierig bei ihrem Eintreten.
„Mara, da bist du ja“, begrüßte Réa sie erfreut. „Darf ich dir Frau Airon vorstellen, die wohl beste Schneiderin der Stadt? Ich habe dir bereits von ihr erzählt. Und das ist ihre Tochter.“
Mara nickte den Frauen höflich zu. Und wenn Réa nicht übertrieben hatte, stand sie den beiden am besten informierten Frauen von Samala Elis gegenüber, zumindest was Klatsch und Gerüchte aus dem Palast anging.
Nachdem Réa auch Mara vorgestellt hatte, kam Frau Airon gleich wieder auf das Geschäftliche zurück, zeigte Réa mehrere Gewänder, die ihr ‚wunderbar‘ stehen würden, und nannte Réa die ganze Zeit über ‚meine Liebe’.
Mara ließ sich in einem Sessel nieder und schaute gelangweilt zu, wie Frau Airon und Tochter Réa mit Stoffen behängten, die sie in der Art eines fertigen Kleides drapierten. Schon bald wirkte Réa reichlich zerzaust, sodass sie sich hilfesuchend an Mara wandte. „Was meinst du?“
„Du weißt, dass ich nicht viel von Kleidern verstehe. Also …“, Mara überlegte, „… diese dunklen, schweren Stoffe stehen dir nicht, das bist nicht du. Warum bleibst du nicht bei Weiß, von der Form her ähnlich wie eine Priesterinnenrobe, nur der Stoff selbst feiner, kostbarer?“
Begeistert sah Frau Airon sie an – wahrscheinlich hätte sie auch begeistert reagiert, hätte Mara vorgeschlagen, Réa solle einen Sack tragen – und wühlte in den Stoffen. „Eine phantastische Idee, meine Liebe, dass ich darauf nicht selbst gekommen bin! Ich habe da eine Idee: Wir machen das so … und so … und so, …“, die Frau kommentierte jede ihrer Handbewegungen, „…die Schultern und die Arme nur spärlich bedeckt, im Grunde nackt, der Stoff nur von zwei Spangen gehalten. Etwa in der Art, dann fällt er sehr schön … Und dann hier etwas enger, hm, vielleicht ein Gürtel oder eine Schärpe? Ja, so … Und?“ Sie schaute Beifall heischend zu Mara.
Mara nickte und grinste Réa an. „Und die dann farbig, zum Beispiel in einem sehr dunklen Blau?“
„Ausgezeichnet, ein ganz vortrefflicher Vorschlag!“, ereiferte sich Frau Airon. „Schön, dann wäre das schon mal geklärt. Was ist mit Euch, meine Liebe? Wie soll Euer Kleid aussehen?“
„Ich möchte auf jeden Fall Ärmel, und zwar lange“, erklärte Mara rasch.
„Ärmel?“, wiederholte die Frau konsterniert. „An einem Festkleid für die Mittsommernacht?“
„Ja“, bestätigte Mara knapp. „Ein vornehmes Gewand für eine Magierin sollte enge, lange Ärmel haben, bis über die Handgelenke.“
Frau Airon und ihre Tochter warfen sich skeptische Blicke zu. Schließlich nickten beide entschlossen. „Spitze. Entweder Spitze oder ein hauchdünnes, durchsichtiges Gewebe. Anders geht es nicht.“
„Aber da sieht man doch alles …“, wollte Mara einwenden.
„Nicht, wenn Ihr ein ebenso dünnes Unterkleid tragt. Noch weitere Wünsche?“, fragte Frau Airon.
„Keine Rüschen“, fiel Mara ein.
„Nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Nichts … Überflüssiges, das würde nur ablenken. Der Stoff muss für sich sprechen, muss den Schnitt und Eure Figur betonen“, erklärte die Schneiderin. „Bleibt die Frage nach der Farbe. Weiß würde passen.“
„Nein“, lehnte Mara entschieden ab.
„Dann vielleicht sehr helles Blau oder Grün?“
„Nein“, Réa schüttelte den Kopf. „Besser etwas Dunkles. Wie wäre es mit Schwarz?“
„Unmöglich“, wehrte die Schneiderin ab. „Sehr dunkles Blau zusammen mit goldfarbenen Stickereien – das ginge vielleicht.“
Wieder schüttelte Réa energisch den Kopf. „Das andere Kleid ist bereits blau, das wäre zu ähnlich. Wieso nicht Rot?“
Unglücklich blickte Mara sie an. „Ist das nicht viel zu auffällig?“
„Du fällst sowieso auf, ganz gleich, welche Farbe dein Kleid hat. Man muss nur darauf achten, dass der Ton sich nicht mit deiner Haarfarbe beißt“, gab die junge Priesterin zu bedenken.
Frau Airon wiegte bedächtig den Kopf. „Ja, ich glaube, wir haben genau das richtige. Ich müsste noch Eure Maße nehmen und dann kommen wir in fünf … in sechs Tagen wieder, zur Anprobe. In Ordnung?“ Sie sah Réa an.
„Ja, das ist früh genug.“
Réa saß Mara gegenüber an dem kleinen Tisch in ihrem Schlafzimmer und blickte wie abwesend aus dem Fenster.
„Bist du mir etwa böse?“, fragte Mara.
„Weil du mich in der Robe einer Priesterin auf das Fest im Palast schicken willst, an dem einzigen Tag im Jahr, an dem ich tatsächlich einmal etwas anderes tragen könnte?“ Réas Lachen klang gequält. „Nein, ich bin dir nicht böse, ich hätte ja widersprechen können. Und du hast Recht: das wäre nicht ich.“
„Ich finde dich sehr schön in Weiß.“
Réa lächelte überrascht. „Danke. Ich hätte nicht Rot vorschlagen sollen, du siehst hinreißend aus in Dunkelblau. Die Gardeuniformen sind auch dunkelblau und …“
„Weiß ich doch“, meinte Mara nur.
„Ja, dieser Jula, mit dem du dich immer triffst, ist ja Soldat in der Garde“, bemerkte Réa. „Er scheint nett zu sein, ich habe ihn ein paar Mal oben im Palast getroffen, außerdem hat Reik ihn mal erwähnt.“
Mara nickte zustimmend.
„Ich habe dich heute Morgen gar nicht beim Frühstück gesehen, wo warst du?“, wollte Réa wissen.
„Ich habe noch geschlafen und später bei Bes in der Küche gegessen“, berichtete sie. „Danach war ich lange mit Nadka im Kräutergarten, sie weiß unendlich viel über giftige Pflanzen, was ich natürlich alles aufgeschrieben habe. Beruhigt?“
„Sicher, Mara, ich wollte dich doch nicht … Nur hatte Milla nach dir gefragt, sie schien besorgt und meinte, du wärst nicht auf deinem Zimmer gewesen, als sie dich zum Frühstück abholen wollte.“
Wieder nickte Mara. „War ich auch nicht, ich war bei Sina.“
„Oh … verstehe.“
„Ach ja?“ erwiderte Mara verschwörerisch und lächelte breit.
Réa wurde rot und wusste vor Verlegenheit kaum, wohin sie sehen sollte. Schließlich stand sie abrupt auf und verschwand im Nebenzimmer, um gleich darauf mit einigen Schlüsseln zurück zu kommen, die sie vor Mara auf den Tisch legt. „Für dich. Lorana sagte, du wüsstest, wozu.“
Mara nickte zögernd, nachdenklich.
„Sie meinte auch, du solltest nicht allein gehen.“
„Würdest du mitkommen?“, fragte Mara an Réa gewandt und stand auf. Dabei klang ihre Stimme kühl und ungerührt und verriet nichts von der Erregung, die Mara verspürte.
Ebenso ernst und ungerührt antwortete ihr Réa. „Natürlich, gern.“
Mara ahnte, dass auch die junge Priesterin angespannt war – und sich freute.
Réa ging voran. Natürlich wusste sie, wozu die Schlüssel dienten. „Wir werden Fackeln brauchen, es ist ziemlich … finster dort. Ich bin gleich wieder da.“
Mara setzte sich auf die Stufen, die zum hinteren Tempeleingang hinaufführten, und wartete. Sie verdrängte all die Fragen und Gedanken, die auf sie einströmten, gönnte der ebenerdigen Tür direkt vor ihr noch keinen Blick und bemühte sich, ruhiger zu werden, sich zu konzentrieren.
Es überraschte Mara nicht, dass Réa in Begleitung von Sina zurückkam – beide trugen brennende Fackeln. Sie sprang auf, erfüllt von Ungeduld und Anspannung.
Aufmerksam betrachtete sie die imposante, mächtige Tür, die zu den Gewölben führte, sah auf die Schlüssel in ihrer Hand und wählte den passenden aus. Das Schloss wurde offenbar häufig benutzt, der Schlüssel ließ sich mühelos drehen. Die hohen, schweren Türflügel schwangen mit erstaunlicher Leichtigkeit auf, als Mara sie anstieß.
Den Schlüsselbund in der Rocktasche verstauend trat sie über die Schwelle, Réa und Sina folgten ihr mit den Fackeln.
Sie fanden alles so vor, wie Mara es vermutet hatte, all das, was sie im Archiv vermisst hatte: die Geschichte des Tempels, die Sammlung der Tempelgesetze, die Familiengeschichten der manduranischen Herrscher, Ahnentafeln der wichtigsten und mächtigsten Familien von Mandura, Aufzeichnungen über die Ereignisse während der Regierungszeit der einzelnen Könige, alte Legenden und Prophezeiungen, auch solche, den König vom Blut der alten Könige betreffend.
All das befand sich in einem Raum tief unter dem Tempel, den zu erreichen sie nur der langen, steilen Treppe auf der linken Seite des Eingangs zum Gewölbe folgen musste.
Sie warf Réa einen misstrauischen Blick zu. „Das lag nicht schon immer hier unten, stimmt's?“
„Nein, natürlich nicht, die feuchte Luft hätte das Papier zerstört. Und wer will schon jedes Mal diese gruselige, glitschige Treppe hinabsteigen, nur um etwas in den Tempelgesetzen nachzuschlagen?“
„Warum sind die Papiere dann hier?“, wollte Mara wissen.
„Lorana hat sie herschaffen lassen“, erklärte Réa.
„Aber warum?“
„Weil man nicht jedem dahergelaufenen, frechen Mädchen, das behauptet, eine Zauberin zu sein, den Schlüssel zur gesamten manduranischen Geschichte aushändigt. Ihre Worte.“
Einen Moment war Mara sprachlos, wollte empört auffahren, musste dann aber doch lachen. „Ah, verstehe. Wohin kommen wir, wenn wir diesen Gang hier weitergehen?“
„Zu vielen weiteren Räumen, von denen die meisten leer sind“, erwiderte Réa. „In manchen lagern Vorräte, Lampenöl und ähnliche Dinge. Nicht besonders aufregend.“
„Ich werde sie mir trotzdem ansehen.“
Nachdem sie Sina um mehrere Ecken gefolgt waren – die Luft wurde immer stickiger, hatte einen modrigen Geruch, Boden und Wände schimmerten feucht im Licht der Fackeln –, kamen sie tatsächlich an Vorratsräumen vorbei, die allesamt auf der rechten Seite eines langen Ganges lagen. Dann vollzog der Gang eine scharfe Biegung nach links und führte noch etwa zehn Schritt weiter, um schließlich abrupt zu enden. Linker Hand befand sich in der Wand eine kleine Pforte, zu der mehrere Stufen hinab führten. Sie sah aus, als wäre sie schon lange nicht mehr benutzt worden. Versuchsweise rüttelte Mara an der Klinke; es war abgeschlossen, und keiner ihrer Schlüssel passte. „Was liegt dahinter?“
Réa blickte Sina betreten an, die fast unmerklich den Kopf schüttelte. „Nichts weiter, Mara, das ist …“
„Was, Réa?“, verlangte sie zu wissen.
„Es ist … der Kerker.“
Verblüfft starrte sie die Priesterin an. „Der Kerker? Du meinst, hier unten werden Menschen eingesperrt?“
„Ja, das heißt nein, es … Also, es ist niemand drin, jedenfalls im Moment nicht.“
„Aber manchmal schon?“ Mara ließ nicht locker.
„Ja. Wer gegen die Tempelgesetze verstößt, fällt unter die Gerichtsbarkeit des Tempels“, erklärte Réa. „Und es obliegt dem Tempel, ihn … zu bestrafen.“
„Ich verstehe schon. Aber wer hat den Schlüssel, etwa auch Lorana?“
„Geh dort nicht hinein, Mara“, wehrte Réa eindringlich ab, „wirklich nicht.“
„Wer hat den Schlüssel, Réa?“, wiederholte sie ihre Frage.
„Ich habe einen, Süße“, erklang Sinas stets etwas heisere Stimme.
Mara sah Sina erstaunt an. „Du?“
„Warum nicht ich? Ich bin nicht irgendeine Tempelwächterin. Malin hat ebenfalls einen, ein dritter befindet sich im Palast.“
„Dann schließt du mir jetzt auf?“
Sina lachte, ein kurzer, kehliger Laut. „Du bist unglaublich, Süße, einfach unglaublich. Und du meinst das auch noch ernst, nicht wahr?“
„Was … Ich verstehe nicht, natürlich meine ich das ernst. Warum fragst du?“ Mara war irritiert.
„Weil du mich ebenso gut dazu zwingen könntest, dir aufzuschließen, du könntest es mir befehlen. Ich könnte nichts dagegen tun. Du weißt das, ich weiß das, und Réa weiß es auch. Oder irre ich mich?“
„Ich …“, begann Mara. „Nein, du irrst dich nicht. Aber es liegt mir fern, dich zu etwas zu zwingen, wenn ich dich auch darum bitten kann.“
Sina schloss auf.
Was sie dahinter vorfanden, waren schauerliche, winzige Zellen, viel eher Löcher. Düster und feucht, und Mara schauderte bei dem Gedanken, dass hier Menschen eingesperrt, verhört, womöglich sogar gefoltert wurden. Sie sehnte sich plötzlich nach Licht und frischer Luft.
Sie hörte Sina und Réa leise miteinander reden, während sie selbst sich umsah. Sinas Stimme eindringlich und drängend, als wolle sie Réa von etwas überzeugen, während Réas Entgegnungen sanft, fast beruhigend klangen.
Auf den ersten Blickt deutete nichts darauf hin, dass hier Menschen gelitten hatten, möglicherweise sogar gestorben waren. Und doch schienen die roh behauenen Wände das Stöhnen und Wimmern, die Schreie der Gefangenen zurückzuwerfen. Wenn Mara nur lange und konzentriert genug lauschte, würde sie sie hören, würde ihre Angst und ihre Schmerzen nachempfinden können.
Eilig kehrte sie zu Sina und Réa zurück, sie wollte keine Sekunde länger allein an diesem furchteinflößenden Ort sein.
Sina blickte Mara spöttisch an, als diese ihr die Fackel gab. „Und? Hast du genug gesehen, Süße?“
„Kommen wir hier noch weiter?“
„Nein, das ist alles“, erklärte Sina schroff.
„Dann also die andere Treppe. Wann war das letzte Mal jemand hier unten?“, fragte sie nach.
„Du meinst, ein Gefangener? Vor sieben, acht Jahren.“
„Was genau warf man ihm vor?“, wollte Mara wissen.
„Er hat eine Priesterin getötet“, erwiderte Sina, wobei ihre Stimme kalt klang. „Vergewaltigt und getötet.“
„Und was … geschah mit ihm?“
„Er wurde zum Tode verurteilt.“
„Wie?“
„Das willst du nicht wirklich wissen, Süße, glaub mir“, gab Sina zurück.
„Doch, will ich.“
„Aber ich werde es dir nicht sagen, schon gar nicht hier unten. Außerdem wirst du, wie ich dich kenne, noch heute damit anfangen, die Tempelgesetze zu studieren. Dann erfährst du es sowieso.“
„Also könntest du es mir ebenso gut sagen“, beharrte sie. „Bitte, Sina.“
„Nein, Süße. Ich werde doch deinen Hang zu Grausamkeiten nicht auch noch fördern.“
„Was soll das heißen?“ Wütend funkelte sie Sina an, die sich gänzlich unbeeindruckt zeigte.
„Du redest für meinen Geschmack ein wenig zu oft und auch ein bisschen zu begeistert von Blut und Tod, vor allem vom Tod anderer Menschen. Und jetzt geh weiter, Réa ist sicher schon an der Treppe.“
Missmutig hastete Mara hinter ihr her. Sie wollte nicht im Dunklen zurückbleiben, stapfte ärgerlich die Treppe hinauf. Was sollten plötzlich diese Vorwürfe? Was hatte sie Sina getan?
Réa wartete am oberen Ende der Treppe, blickte in das letzte Licht des Tages hinaus. Mara wunderte sich, dass so viel Zeit verstrichen war, seit sie die Gewölbe betreten hatten. „Willst du nicht mehr mitkommen, Réa?“
„Warum wartest du nicht bis morgen, Mara, es wird schon dunkel?“, erinnerte sie die Priesterin.
„Da unten ist es ohnehin dunkel.“
„Ja, aber … Bist du denn nicht müde?“
„Nicht besonders. Was ist los, Réa? Du willst nicht, dass ich hinunter gehe, stimmt's?“
„Mir ist unwohl bei dem Gedanken, nach Sonnenuntergang dort unten zu sein, und du … Ach, egal, wir werden ja doch nicht weit kommen.“ Mit diesen Worten wandte Réa sich um und stieg als erste die Treppe hinab, die genauso lang, düster und feucht zu sein schien wie die auf der linken Seite.
Unten, gleich gegenüber dem Treppenabsatz, befand sich ebenfalls ein kleiner Raum für die Wache. Rechter Hand führte ein Durchgang tiefer in das eigentliche Gewölbe hinein. Es gab einen weiteren Raum für Wächterinnen, größer als der vorherige, die Tür war nicht verschlossen.
Dann verengte sich der Gang, sie konnten nur noch hintereinander gehen und mussten aufpassen, dass sie sich nicht die Ellenbogen an den rauen Felswänden stießen. Irgendwann begann sich der Boden zu neigen. Von der Decke tropfte Wasser, das sich in Pfützen sammelte. Ein Geruch nach schalem, abgestandenem Wasser, nach Moder lag in der Luft, und nach noch etwas anderem, seltsam und metallisch.
Plötzlich bog der Gang abrupt nach links ab. Noch immer war es sehr eng, die Wände glitzerten feucht. Mara fröstelte und versuchte, nicht an die Felsmassen zu denken, die sich über ihrem Kopf auftürmten, sie von allen Seiten bedrängten. Ihr Atem hatte sich in ein gehetztes Keuchen verwandelt. Wieder bog der Gang scharf nach links ab. Rechts öffnete sich ein weiterer Durchgang, der wiederum zu einer steilen Wendeltreppe führte, deren oberes Ende sich im Dunkeln verlor, jedoch einen Schwall frischerer Luft heranführte, welcher die Fackeln im Luftzug aufflackern ließ.
Wenigstens war der Gang hier breiter, nicht mehr so bedrückend eng, führte aber noch immer tiefer nach unten. Es folgte eine weitere Linkskehre, dann endete der Gang an einer kleinen, leeren Kammer.
Verblüfft sah Mara Réa an, die mit hochgezogenen Schultern vor ihr stand, drehte sich um und untersuchte eingehend die rechte Wand des Ganges. Es dauerte nicht allzu lange, bis sie gefunden hatte, wonach sie suchte: eine Tür, exakt und nahezu fugenlos in den umgebenden Fels eingepasst, kaum von der Wand zu unterscheiden.
Zufrieden lächelte sie vor sich hin. „Hältst du bitte die Fackel etwas höher, Sina?“
„Natürlich, aber wonach suchst du eigentlich?“, wollte ihre Freundin wissen.
„Nach dem Schlüsselloch.“
„In der Wand?“
„In der Tür“, erklärte Mara.
„Welche Tür?“, fragte Sina verwirrt.
„Du stehst direkt davor. Aber du siehst sie doch, Réa?“
„Ich sehe sie, aber nur, weil ich schon einmal hier war. Das Schlüsselloch befindet sich in der Nähe des Bodens, dort, wo die beiden Türflügel zusammenstoßen“, gab Réa Auskunft.
„Danke.“ Mara ging in die Hocke und tastete leise schimpfend nach dem Schloss. Natürlich musste sich genau vor der Tür eine tiefe Wasserlache befinden! Immerhin passte der Schlüssel und Mara stemmte sich gegen die Flügel, die sich schließlich rumpelnd öffneten.
Es roch durchdringend nach Staub. Und wieder nahm sie diesen metallischen Geruch wahr, fast wie der Geruch nach Blut. Doch vielleicht bildete sie sich das nur ein.
Hinter der Tür führte ein Flur sofort wieder nach rechts. An seinem Ende befand sich einmal mehr ein Raum für Tempelwächterinnen, um die Ecke öffnete sich der Flur in einen weiten Raum, fast eine Halle. Auf der gegenüberliegenden Seite lag ein weiterer Raum. Er war ebenfalls recht groß und bis auf steinerne Bänke und Liegen an den Wänden komplett leer.
„Was ist das für ein Raum?“, fragte Mara.
„Er dient … diente der Vorbereitung der Priesterinnen auf die Rituale im Tempel“, erläuterte Réa. „Jedenfalls hat Lorana das erzählt, als sie mit mir hier unten war.“
Der Geruch wurde immer intensiver, schien von der gewaltigen Tür her zu kommen, welche die östliche Wand der Halle beherrschte. Merkwürdigerweise behaupteten Sina und Réa, nichts zu riechen, als Mara sie danach fragte. Aber sie roch etwas, war sich fast sicher, dass sie Blut roch, geronnenes, altes Blut, und dass der Geruch aus dem Raum hinter der Tür kam, dieser Tür, die drohend vor ihr empor ragte, gewaltig, unüberwindlich, undurchdringlich. Eine Tür, die sie und jeden anderen Menschen verhöhnte und verlachte, denn sie hatte kein Schloss, keine Klinke und auch keinen Riegel oder Griff. Eine Tür, die sich nicht öffnen ließ!
Mara schob und drückte, keuchte vor Anstrengung, doch nichts geschah. Wütend schlug sie gegen die Türflügel. „Verdammter Mist, geh schon auf!“
„Du solltest hier nicht fluchen, Mara“, mahnte Réa.
„Wieso nicht? Liegt hinter dieser dummen Tür etwa ein Tempel? Auf der anderen Seite, hinter einer Tür, die gar keine Tür ist! Ich will da hinein und ich werde da auch hinein kommen, weil ich es will! Habt ihr gehört? Ich werde durch diese Tür gehen, ich will es so!“
„Mara, beruhige dich, und schrei nicht so herum“, bat Réa.
„Hast du Angst, die Decke könnte einstürzen?“ Sie lachte, es wäre zumindest einen Versuch wert.
Behutsam legte sie die Hände auf beide Türflügel, begann leise zu summen, veränderte die Tonhöhe, bis sie eine leichte Vibration spürte. Als würde die Tür vor Angst zittern.
Wieder lachte sie, lauter diesmal. Was für einen Unsinn trieb sie eigentlich? Und dann sprach, oder besser, rief sie die Worte, in der gleichen Tonhöhe, welche die Tür zuvor hatte vibrieren lassen, in einer Sprache, von der sie nicht wusste, dass sie sie überhaupt kannte. „Ich will es so!“
Krachend barsten die Türflügel auseinander, als hätten die gewaltigen Fäuste von Riesen sie aufgestoßen.
Mara lachte, erfreut und zugleich überrascht. Sie hatte nicht wirklich geglaubt, dass ihre Taktik funktionieren würde. Von dem aufsteigenden Staub musste sie husten.
Jetzt war es Sina, die laut fluchte. „Oh heilige Kacke, das ist doch überhaupt nicht möglich! Verdammt, Mara, was hast du getan?!“
„Die Tür geöffnet.“
Réa hatte es die Sprache verschlagen. Mit weit aufgerissenen Augen sah sie immer wieder von Mara zur Tür.
Dahinter, im Tempel, im Tempel unter dem Tempel, wie Sina ihn genannt hatte, war es dunkel. Das unruhig flackernde Licht der Fackeln erhellte nur ein kleines Stück des Bodens jenseits der Türöffnung.
Mara wollte bereits hinein, doch Réa hielt sie am Arm zurück, ihre Stimme rau und atemlos vor Anspannung. „Mara, du …“
„Ja?“
„Sei bitte vorsichtig.“
Aufmunternd lächelte Mara ihr zu. Dann gingen sie gemeinsam hinein.
Noch bevor sie über die Schwelle trat, den Fuß auf den Tempelboden setzte und dabei spürte, wie er erbebte, wie ein schwerfälliger Körper, der nach langem Schlaf erwachte, wusste Mara, dass sie einen großen Fehler begangen hatte.
Schlagartig erloschen die Fackeln und Finsternis regierte.
Réa schrie erschrocken auf, Mara klammerte sich keuchend an Sinas Arm.
„Es ist nur dunkel, Süße, kein Grund, mir den Arm zu brechen“, klang Sinas Stimme durch die Dunkelheit. „Jetzt müssen wir uns den Weg zurück eben ertasten, schöne Aussichten. Réa, alles in Ordnung bei dir?“
„Ja, ich bin nur erschrocken, als die Fackeln so plötzlich erloschen“, antwortete Réa atemlos.
Mühsam brachte Mara ihre Stimme unter Kontrolle, trotzdem war deutlich die Angst herauszuhören. „Ich gehe nicht zurück, ich gehe weiter.“
„Das ist Unsinn, Mara, du siehst überhaupt nichts und könntest im Dunkeln stolpern und dir sonst was brechen“, versuchte Réa sie zu überzeugen. „Wir kommen morgen wieder und …“
„Nein, ich muss es jetzt tun“, bestand Mara auf ihrem Vorhaben. „Ihr bleibt an der Tür zurück.“
„Das wäre ja noch schöner, Süße“, protestierte Sina, „ich…“
„Ich sagte, ihr bleibt hier an der Tür, beide! Ich befehle es euch!“
„Das wagst du nicht, du kannst uns nicht beide zwingen …“
„Probiere es aus“, unterbrach sie die Priesterin.
Ohne ein weiteres Wort verschwand Mara in der Düsternis, achtete nicht auf Réas Proteste und auch nicht auf Sinas dumpfes Stöhnen, als diese vergebens versuchte, sich gegen ihren Befehl zu wehren.
Sie setzte vorsichtig Fuß vor Fuß, kämpfte gegen die Angst vor der Dunkelheit an, den schier übermächtigen Wunsch zu schreien, weil die Schwärze von allen Seiten auf sie einstürmte, sie zu erdrücken, zu ersticken drohte.
Das Vibrieren des Bodens verstärkte sich. Gesang ertönte, erst ganz leise, flüsternd, wie aus weiter Ferne, wurde dann lauter, je weiter sie auf den Altarstein oder was immer sie auf der anderen Seite erahnte, zuging. Der Gesang klang nicht wie in Dalgena, nicht wie im Tempel über ihr, wo der Tag allmählich zur Nacht wurde. Er war düster, drohend, fast schrill, und er klang falsch. So wie auch dieser Tempel falsch erschien: der Altarstein stand am verkehrten, am östlichen Ende.
Oh ja, Sina hatte nicht nur eine Geschichte erzählt, hier waren Menschen geopfert worden, viele Menschen. Sie konnte es spüren, konnte das Blut riechen. Der Geruch war überwältigend, ekelerregend, ihr wurde übel und ihre Beine zitterten.
Dann endlich stand sie vor dem Altar, oder war es ein Opferstein? Sie fühlte die Masse vor sich, und wenn sie die Hände auf die Oberfläche legte, wäre diese ganz schmierig von warmem Blut, auch wenn es längst weggewischt worden war. Sie unterdrückten ein Stöhnen und fragte sich, ob es vielleicht jemand anderes war, dessen Stöhnen zu ihr drang. Sie musste sich am Stein festhalten, da die Beine unter ihr nachgaben, stand auf der falschen Seite des Altars, dort, wo das Opfer stand, sollte hinter den Altar gehen, aber sie konnte nicht, sie war so schwach!
Der Gesang wurde lauter und lauter. Ihr brach am ganzen Körper der Schweiß aus, sie zitterte vor Anstrengung und konnte sich doch nicht bewegen. Mit letzter Kraft riss sie die Hände empor und schrie gellend, gepeinigt vor Angst und Schmerz, übertönte den Gesang, und der Gesang verstummte.
Irgendwo in einer Kammer weinte ein Kind, in einem Dachzimmer schlug ein Mann seine Frau, in einer Küche schnitt sich jemand mit einem Messer tief ins eigene Fleisch, in einer Schenke prügelten zwei Männer voller Hass aufeinander ein, irgendwo in der Stadt starb ein Mensch.
Und sie schrie noch immer, jetzt aber nicht mehr ängstlich und schmerzerfüllt, sondern triumphierend und voller Freude, weil sie Macht in sich spürte und eine gewaltige Kraft.
Mit einem Mal war es strahlend hell im Tempel. Blinzelnd senkte sie die Arme, wandte sich zu Sina und Réa um und lachte befreit auf. Lachte, als sie die zwei auf sich zu laufen sah, lachte, weil die Fackeln wieder brannten, obwohl das jetzt unnötig schien. Lachte, weil sie Lorana und Malin und weitere Tempelwächterinnen hinter ihnen sah, nicht unerwartet, und wurde ohnmächtig.
* * *
Er fluchte nicht, das taten genügend andere, brüllte auch nicht herum oder schrie, was das gewesen sei, stieß sein Schwert in die Scheide zurück. Warum überhaupt hatte er blankgezogen? Es war ein Erdbeben gewesen, kein Angriff, ein heftiger Erdstoß, der einen Teil der Männer auf dem Gardehof von den Füßen geholt hatte, nichts weiter. Jetzt standen sie wieder auf, wohl keiner hatte eine ernstliche Verletzung erlitten, und klopften sich Staub und Schmutz von der Kleidung.
Davian wich kopfschüttelnd Sandars Blick aus und half dem Mann hoch. Hörte Getöse von den Ställen her, schrilles Wiehern, Geschrei und laute Rufe; offenbar drehten die Gäule durch.
„Der Jäger regt sich …“, Sandar lachte und hustete zugleich. „So nannte es meine Großmutter immer. Erdbeben, besonders diese ruckenden Erdstöße. Gab es zu ihrer Zeit wohl häufiger. Du blutest.“
Brummend nickte Davian, spuckte aus. „Hab mir auf die Zunge gebissen …“ Er spürte seinen heftigen Herzschlag, spürte das Blut durch seine Adern rasen, war noch immer in Bereitschaft, auf jeden loszugehen, der sich ihm in den Weg stellte. Und den Geschmack des Blutes … Ging es ihm so, Domallen, wenn der den Jäger in sich spürte?
Und vor diesem mächtigen Stoß, der sogar einen kleinen, wenn auch nutzlosen Abschnitt der inneren Festungsmauer zum Einsturz gebracht hatte: ein Gefühl von Raserei und Zorn, von gewaltigem Hass, dem Wunsch zu töten, wieder und wieder auf jemanden einzuprügeln, solange, bis der sich nicht mehr … In seinen Ohren, seinem Kopf ein immenser Druck, immer mehr, immer stärker anwachsend, die Gier nach Gewalt – so lange, bis er es nicht mehr ausgehalten und geschrien, brüllend sein Schwert herausgerissen hatte, um …
Doch noch jemand anderes hatte geschrien, nicht hier, nicht in seinem Kopf. Triumphierend hatte es geklungen und wie befreit, als würden die Ketten bersten und endlich Licht … Die Erde hatte gebebt.
„Der Jäger regt sich, hm?“ Mit dem Handrücken wischte Davian sich das Blut vom Mund.
„Ihr Spruch.“ Sandar zuckte die Achseln. „Vielleicht, um einem furchtsamen kleinen Jungen die Angst zu nehmen.“
„Und, hat’s funktioniert?“
„Nur bedingt, ich hatte immer das Bild von einem schrecklichen, zornigen Ungeheuer mit blutigen Hauern vor Augen, das sich in seinem riesigen Bett wälzt, einem Bett mit wahren Kissenberge, sag‘ ich dir. Das hat sich mir eingeprägt.“
Davian lachte, doch sein Lachen erstickte sofort. Er spuckte erneut aus, er wurde einfach den ekelerregenden Geschmack nicht los. „Jetzt hab‘ ich ein Bild, ein ziemlich anschauliches sogar.“
Ein Bild also, und er würde … er wollte, er musste es malen: Diese Gestalt, dieses Wesen, halb Mann, halb Monster, furchterregend und zugleich auf unerklärliche Weise anziehend.
Überaus männlich und brutal, groß und dunkel, natürlich groß, doch nicht zu groß, kein Riese, vielmehr ein Mensch … ein Mann, ein sehnig-muskulöser Kerl. Dunkle Locken fallen ihm in die Stirn, über die breiten Schultern, tief in den Nacken, Rücken, die Haut seines nur spärlich behaarten Gesichts, seines nackten Oberkörpers von der Farbe dunkler Bronze, wie Erde, wie der Boden des Waldes im Herbst, altes Gold über geronnenem Blut … Doch er zeichnete mit einem Kohlestift – ohne Farben.
Blutige Hauer? Davian lachte, schüttelte den Kopf, nein, das war Sandars Bild. Sein Gott trug Hörner, weit geschwungen, in sich gedreht; beinah unmöglich zu zeichnen, und doch gelang es ihm, halb in Trance, nicht bewusst, was er da tat. Hinterher war er entsetzt über sein Werk, die vielen irritierenden, verstörenden Einzelheiten. Und in seiner Vorstellung sah er die Farben des Bildes.
Augen wie Mahlströme aus Sternenlicht, darin irrlichternde Reflexe in Rot und Gold, behaarte Füße wie die Klauen eines Wolfes, die Eckzähne hinter den vollen Lippen etwas zu lang, die Ohren lugten keck und spitz aus den üppigen schwarzen Locken hervor und die Finger endeten in harten, hornigen Krallen.
Der Jäger an, vor dieser Bettstatt stehend, und doch kam diese ihm wie ein sicherer Hafen vor, wie der einzig friedliche Ort in einer Welt der Düsternis, der Dämonen und Fratzen, nur halb erahnt und erkannt, versteckt, verborgen in den Schatten am Rande … des Bildes.
Und er, der Gott, der Jäger … vielleicht trug er Hosen aus Leder, vielleicht waren seine Beine mit zotteligem Fell bedeckt, das Gemächt nackt und bloß, bedrohlich wirkend und doch nur halb aufgerichtet, da er sich über sein Lager beugte, zu der Gefährtin, die … Wieso trug sie die Züge des Mädchens, er … Mit einem Aufschrei warf er den Stift von sich und musste gegen dem Impuls kämpfen, das Bild zu zerreißen.
Er hatte zwei-, dreimal versucht, ihr Abbild aus dem Gedächtnis zu zeichnen, flüchtige Skizzen bloß, aber doch nicht so, auf diese Weise. Nie hatte er sie nackt, oder auch nur halbnackt, gesehen, lasziv und in lustvoller Erwartung, in Berge vielfarbig schimmernder Kissen gelehnt, der nackte Leib ihm dargeboten. Erregend, verlockend und allzu verführerisch, obgleich ihre Hände … Nein! Davian schrie auf, das hatte er nicht …
Aber genau das hatte er gezeichnet, diese Szene, verstörend, faszinierend, das Beste, was er seit langer Zeit gezeichnet hatte. Ein abscheuliches Meisterwerk, das er weder Sandar – und der war einiges gewohnt – noch sonst irgendwem zeigen konnte.
Das Bild ließ ihn nicht los, das Geschehen auf dem Bild brannte sich in seine Seele. Fluchtartig verließ er das Zimmer, sein Haus; er brauchte was zu trinken.
Später, wenn er besoffen genug war, würde er das Bild verbrennen, es in Dutzende Schnipsel zerreißen und sie genüsslich dem Feuer überantworten, einen nach dem anderen.
Natürlich wusste er genau, dass er dazu nicht imstande sein würde, niemals. Viel eher würde er es irgendwann Sandar oder gar … ihr zeigen. Die Kleine wäre schockiert, entsetzt. Angewidert von ihm, der diese Scheußlichkeit geschaffen hatte. Auch keine angenehme Vorstellung. Außerdem würde sich die Gelegenheit ohnehin nicht ergeben. Er ließ sich schwerfällig an einem Tisch nieder und bestellte gleich eine ganze Flasche.
Er betrachtete grübelnd seine schmutzigen, geschwärzten Finger und fragte sich, ob sie wohl seiner Zeichnung ähnlich war. Wenigstens ein kleines bisschen? Er hatte nicht sein Idealbild einer Frau gemalt, die sähe … Davian schüttelte den Kopf und setzte die Flasche an, trank. Blöde Idee, eine ganz blöde Idee, er kippte den Stuhl gegen die Wand, lehnte den Kopf an, schloss die Augen und lauschte mäßig interessiert den Gesprächen in der Schenke. Hörte ein paar völlig übertrieben ausgeschmückte Geschichten, an deren Wahrheitsgehalt er zweifelte, Geschichten von plötzlich aufgesprungenen Türen und Fensterläden, von Toren, die seit Jahren klemmten, verrammelt waren und plötzlich offen standen. Nette, unterhaltsame Kneipengeschichten, alle in ihrer Art recht ähnlich, und alle sollten sie sich heute zugetragen haben.
Von Schäden durch den heftigen Erdstoß hörte er nichts, keine Klagen, und das war tatsächlich bemerkenswert.
* * *
„Hauptmann Sandar?!“ Vor Verwunderung vergaß Lucinda beinah, die Tür weiter zu öffnen und ihren Verlobten herein zu bitten. Sie biss sich verlegen auf die Lippen. „Wollt Ihr nicht … Tretet doch bitte ein.“
„Gerne doch, Herzchen, ich danke dir.“ Hauptmann Sandar trat ein, stutzte kurz, vermutlich, weil er das Durcheinander, die Unordnung in dem geräumigen, ein wenig düsteren Zimmer bemerkte. „Ich wollte mich nur erkundigen, ob … Oder störe ich?“
„Nein, nein, bestimmt nicht“, sie lachte gezwungen, presste die Hand vor den Mund und sah sich um. Nahm einige Kleidungsstücke auf und trug sie rasch ins Nebenzimmer, wo sie sie aufs Bett warf. Sie rümpfte die Nase – ihr ungemachtes Bett erschien ihr schlampig, ehe sie zu Sandar zurückkehrte. „Ich habe nur … wollte ein paar Sachen aussortieren.“
„Verstehe. Ich darf doch?“ Er deutete auf den Sessel, dann setzte er sich, ohne ihre Erlaubnis, ein Nicken abzuwarten. „Ist was kaputt gegangen?“
Überrascht schüttelte Lucinda den Kopf, lachte dann erneut auf. „Oh, du meinst … Nein, das war nur … Krimskrams. Nicht so wichtig.“ Zwei der drei Figürchen, die sie auf dem Kaminsims aufgestellt hatte, eigentlich hatten sie ihr nie gefallen, sie fand sie albern, ja kindisch, doch jetzt waren sie zerbrochen und … Sie wollte deswegen nicht weinen, wandte sich ab.
„Diese dicken Spielleute, Musikanten?“
Sie nickte stumm, erstaunt, dass er sich erinnerte. Im nächsten Moment spürte sie seinen festen Griff um ihr Handgelenk. Er zog sie näher zu sich, zum Sessel. „Das tut mir Leid, Herzchen.“
Sandar zog sie einfach auf seinen Schoß und nahm sie in den Arm, beruhigend fest, sicher, doch dabei strahlte er einen allzu markanten männlichen Geruch aus. „Hast du dich sehr erschrocken?“
„Ich war ja gar nicht …“ Nicht hier, nicht allein, doch sie hatte vor Angst geschrien, als der Boden unter ihr ruckte, bebte. Die Wände hatten geächzt, das Geschirr im großen Schrank geklirrt, gescheppert, bevor alles … Und sie hatte nur schrill schreien und kreischen können, panisch, unfähig, sich zu rühren. Weinte auch jetzt, aber nur ein bisschen. Es war ja vorbei und Sandar hielt sie, beschützte sie. Sie wusste, dass das Bedrohliche nur noch eine Erinnerung war, dass keine Gefahr mehr bestand; presste die Lippen zusammen, drückte den Kopf an seine Schulter. Wünschte sich … „Du hattest bis jetzt Dienst?“
„Jup“, er zuckte die Achseln, küsste sie hastig. Auf die Wange, nicht auf den Mund, was sie fast bedauerte, gern hätte sie … „Aufräumarbeiten, es gab wohl ein paar Verletzte. Nichts Schwerwiegendes.“
„Das ist gut, nicht wahr?“
Er musterte sie, und Lucinda behagte sein Gesichtsausdruck nicht, bevor er sie küsste, dieses Mal auf den Mund. Ihr behagte auch nicht, wie er sie küsste, grob und fordernd, oder wie er sie an sich drückte, doch was konnte sie schon tun? Was wollte sie tun? Bald würde sie den Mann heiraten. Also ließ sie sich von ihm küssen, noch einige Male, ließ auch zu, wie er sie betatschte, am Ausschnitt ihres Kleides herumfummelte. Als er jedoch die Hand unter ihren Rock schob, sprang sie auf. „Nicht, bitte!“
„Nicht? Ich dachte, es würde dir…“
„Ich bin doch sehr…“ Warum sagte sie nicht, wie es war? Dass ihr seine Zärtlichkeiten nicht gefielen, sondern sie erschreckten, abstießen. Er, seine Größe, seine Stärke, seine Überlegenheit. „Ich habe noch zu tun, entschuldige, ich muss einige Dinge erledigen.“
Sandar fragte nicht weiter nach, sondern verabschiedete sich, sehr höflich, und ging.
(Ende 84. Tag)