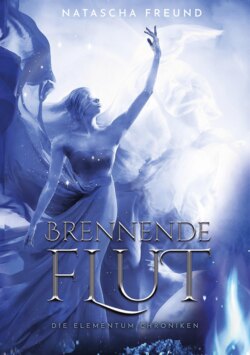Читать книгу Brennende Flut - Natascha Freund - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 9
Es vergeht kein einziger Tag, den ich nicht im Wasser verbringe. Auch im LaPearl gab es viele, sehr viele Schichten, die ich arbeitete.
Aber das war etwas anderes. Ich tat es fürs Geld und nicht für mich. Nun hat sich das Blatt gewendet. Das LaPearl ist Geschichte. Endlich, nach mehr als zwei Jahren, kann ich dort ausbrechen. Mich frei fühlen. Frei sein. Sanctus sagt mir, dass ich so lange bleiben kann, wie ich will. Er möchte dafür nichts weiter als meine Gesellschaft. Das erleichtert es mir ein wenig. Trotzdem bestehe ich darauf, ihm so viel wie möglich mit der Wiederherstellung des Hauptgebäudes zu helfen. Außerdem wechseln wir uns mit einkaufen und kochen ab. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich nur nach ein paar Tagen so wohl fühlen könnte. Doch ich tue es. Gerade sitzen wir am Tisch und essen Lachs mit Reis und Gemüse. Er ist ein besserer Koch als ich.
»15 Minuten …« Ich schlinge das Lachsfilet runter.
»15 Minuten?«, fragt Sanctus, während er an seinem Rotwein nippt und dabei zufrieden brummt.
»Ja«, lächle ich in mich hinein.
»So lange schaffe ich es unter Wasser zu bleiben.
So ein Fortschritt in nur wenigen Wochen ist wirklich unglaublich. Normalerweise kämpfe ich um jede Sekunde.« Ein wahrer Triumph.
»Das ist in der Tat sehr unglaublich. Und sehr beeindruckend. Ich freue mich, dass du dich für den See so begeistern kannst. Und noch mehr freut es mich, dass du immer wieder versuchst, über deine Ziele hinauszugehen. Tut es nicht gut, immer wieder einen Schritt weiterzugehen, als man glaubt, letztlich zu schaffen?« Sanctus’ Lächeln steckt mich regelrecht an. Aber ich glaube, dass er das nicht nur auf meine Leidenschaft im Wasser bezieht.
»Ja, das ist es.«
Als wir aufgegessen haben, räume ich das Geschirr ab und fange mit dem Spülen an. Ich schlage mit meinen Händen kleine Wellen ins Becken, sodass sich das Wasser aufschäumt. Jedes Mal tue ich das, wenn ich spüle. Mich fasziniert alles, was mit dieser natürlichen Flüssigkeit zusammenhängt. Ich spüre, wie sich Sanctus’ Blick in meinen Rücken bohrt, und drehe mich zu ihm um. Das, was ich in seinen Augen erkenne, ist nicht zu deuten. Sein Blick ruht unergründlich auf mir. Hastig drehe ich mich wieder um, summe vor mich hin und setze das Abspülen fort.
Weitere Wochen vergehen und aus fünfzehn werden siebzehn Minuten. Ein Wunder, dass ich unter Wasser nicht atmen kann, aber dann würde ich wohl nie wieder auftauchen wollen. Das alte Leben in Malum existiert beinahe nicht mehr. Die Erinnerungen werden von einem anderen Gefühl verdrängt.
Nur wenn ich schlafe, suchen sie mich in meinen Träumen heim. Die Schlagzeile meines Bruders, das Bild der abgebrannten Wohnung, die in Schutt und Asche liegt. Immer wenn ich von ihm träume, wache ich mit wässrigen Augen auf. Und dann ist da noch ein anderer Traum, der wesentlich häufiger vorkommt. Finger, die über meine nackte Haut streicheln, eine Zunge, die leicht über meinen Hals leckt, ein Lächeln, das mich innerlich schaudern lässt und die eiserne Kälte für einen Moment verdrängt. Wenn ich von Reff träume, wache ich atemlos auf. Nach solch einem Traum ziehe ich mir hastig den Overall an, stürme auf den See zu und stürze mich in die betäubende Kälte. Dann vergesse ich schnell, während ich mich drehe und wende. Ich tanze meine Trauer hinfort. Diese Erinnerungen werden nicht nur vom Wasser verdrängt, sondern durch alte ersetzt, die dieser Ort in mir auslöst.
Manchmal, wenn ich wieder aus dem See steige, höre ich in weiter Ferne ein Klatschen. Dieses Geräusch kommt von einem kleinen Jungen mit warmen rotbraunen Augen und gelockten Haaren in Honigblond. Immer wenn ich die jüngere Version von Vinc vor mir sehe, breitet sich Wärme in meinem Herzen aus. Und ich lächle ihm hinterher, bis die Silhouette verblasst, sodass er schließlich wieder fort ist und ich nur die dichten Bäume vor mir erkenne. Doch ich fühle keine Einsamkeit mehr, keine Trauer. Sie verfolgen mich nicht mehr so sehr. Allerdings ist ein großer Teil meiner selbst fort. Sowohl Vinc auch als Reff haben ihn mit sich genommen.
Trotzdem frage ich mich, ob es wirklich wahr werden könnte.
Kann ich tatsächlich noch glücklich werden?
Zumindest fühlt es sich so an. Denn nie war ich glücklicher als hier im Heim und am See. Ich fühle mich wohl. Sehr sogar. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist.
Drei weitere Monate vergehen und der Winter steht vor der Tür. Gerade bin ich dabei, die letzte Wand des Innenhofes zu streichen, als mir eine Schneeflocke auf die Nase fällt. Überrascht zucke ich kurz zusammen und schiele sie an. Dann sehe ich zum Himmel hinauf, der genauso grau wird wie die Augen von Sanctus.
Es folgen weitere Schneeflocken, die mich daran hindern wollen weiter zu streichen. Also lege ich die Arbeit nieder. Vom Beobachten dieses Spektakels wird mir – trotz Mütze, Jacke und Schal – langsam kalt. Drinnen erwartet mich Sanctus schon mit einer Tasse Kakao.
»Ich habe mir gedacht, dass es nicht mehr lange dauert, bis du wieder reinkommst.« Er überreicht mir die Tasse und ich nehme sie dankend an. Kurz nippe ich an der dampfenden Schokolade und genieße die Wärme der Milch.
»Ja, immerhin ist die Hälfte geschafft. Mal sehen, was der Schnee davon übriglässt. Ich werde mir gleich mal den Wetterbericht ansehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon anfängt zu schneien.«
Ich trinke einen Schluck, die Flüssigkeit läuft mir heiß die Kehle hinunter.
»Das musst du nicht. Ich denke, dass es langsam Zeit wird.« Erstaunt schaue ich ihn an.
»Für was genau?«
Er weicht meinem Blick nicht aus, als er sagt:
»Ich denke, es wird Zeit, dass du mich verlässt.«
Das trifft mich völlig unvorbereitet, sodass ich den Becher aus meiner Hand fallen lasse, bis er auf dem Parkett zerspringt. Eine Lache aus Porzellan und Schokolade verbreitet sich über den Boden.
Was hat er da gerade gesagt? Das kann doch nicht wirklich sein Ernst sein!
Ich bin glücklich!!, will ich ihn anschreien – aber ich kann nicht. Ich kann weder fühlen noch denken, ihn nur unentwegt anstarren. Mit Vorsicht kommt er auf mich zu, bis er genau vor mir steht.
Es fehlt nicht mehr viel und unsere Nasenspitzen berühren sich sanft.
Schwer lässt er seine Hände auf meine Schultern sinken.
»Du hast diesen Ort als deine Zuflucht gewählt. Von Tag zu Tag geht es dir besser. Doch du kannst dich nicht ewig vor deinem Leben verstecken.«
Mit zitternder Stimme sage ich etwas zu laut:
»Ja, erst mal war es so! Ein Zufluchtsort! Aber es ist so viel mehr für mich geworden. Mein Zuhause. Alles hier.« Ich wende mich aus seinem Griff und drehe mich mit ausgestreckten Armen um die eigene Achse.
»Das Haus, an dem ich mitarbeite, das gemeinsame Kochen, die Natur, der See … und du!«
Schon nach kurzer Zeit hatte er mir das Du angeboten, schließlich wohnen wir hier zusammen.
»Warum willst du, dass ich gehe? Zurück, in dieses beschissene Leben! Du verlangst zu viel, alter Mann!« Ich kann meine Emotionen nicht zügeln und Wut fängt an mir die Sicht zu vernebeln.
Sein Blick hält meinen gefangen und er lässt seine Hände erneut auf meine Schultern sinken. Er seufzt einmal tief.
»Bist du glücklich?«
Bitte was?
Verwirrt sehe ich ihn an. Er wiederholt seine Frage: Bist du glücklich, Libell?«
»Ja, das bin ich, Wie könnte ich auch nicht?«
Er ignoriert meine Gegenfrage und horcht mich weiter aus.
»Aber bist du auch zufrieden? Könntest du jetzt und hier tot umfallen und denken, dass du nichts bereut hast?«
Hat er jetzt vollkommen den Verstand verloren? Was will er denn mit dieser Frage bezwecken?
»Wenn ich tot wäre, könnte ich nicht mehr denken.« Seine Hände krallen sich in meine Oberarme, sodass es langsam anfängt zu schmerzen.
»Beantworte meine Frage, mein Kind«, stößt er durch zusammengebissene Zähne aus.
Ich schlucke, aber so, dass er es nicht mitbekommt. Er ist eh viel zu abgelenkt, indem er versucht, mich mit seinem Blick aufzuspießen. Ich unterdrücke ein weiteres Schlucken und sehe ihn immer noch etwas verwirrt in die Augen, halte seinem Blick stand.
»Ja, ich bin glücklich und ich bin zufrieden. Und wenn der Tod mich jetzt heimsuchen sollte, dann würde ich mich nicht wehren.« Und das ist die Wahrheit. Ich bin im Einklang.
Prüfend sieht er mich noch einmal an, bevor er dann von mir ablässt.
»Ich habe nicht gemeint, dass du in dein altes Leben zurücksollst.«
Okay, jetzt habe ich wirklich gar keinen Schimmer mehr.
»Aber du meintest doch eben …«
»Dass es Zeit wird, mich zu verlassen, ja, das habe ich gesagt. Aber niemals würde ich zulassen, dass du in dein altes Leben zurückkehrst, wenn du das nicht selber willst. Ganz im Gegenteil, ich will, dass du ein komplett neues Leben beginnst. Bloß hier ist nicht der richtige Ort dafür. Das ist der Ort deiner Kindheit, und das schließt dein altes Leben mit ein.«
Entmutigt lasse ich die Schultern sinken.
»Aber wo soll ich hin? Ich weiß es doch nicht. Dass du das willst, kam einfach zu überraschend. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht.«
Ein kleines Lächeln umspielt Sanctus’ Mund.
»Das ist auch nicht nötig. Man sollte sich nicht immer zu viele Gedanken machen, sondern sich leiten lassen, mehr auf seine Gefühle hören und auf seine Instinkte verlassen. Wer soll sich schon auf dich verlassen, wenn du es nicht selber kannst?«
Da hat er recht. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll, bis er mich mit einer Frage konfrontiert, mit der ich noch viel weniger gerechnet habe.
»Sag mir, Libell, willst du ihn wiedersehen?«
Ach du meine Güte! Wen meint er denn jetzt mit dieser Frage? Vorsichtig sehe ich zu ihm auf. Ich fühle mich auf einmal so klein.
»Wen?« Und wieder dieses kleine Lächeln, als Sanctus schlicht und direkt sagt:
»Deinen Bruder.«
Vinc???
Mir entgleist alles aus meinem Gesicht.
»Was? Vinc? Das kann ich nicht. Ich will nicht zurück in den Stadtkern. Ich habe meine Erinnerungen an ihn. Ich muss nicht …« Nervös fange ich an, von einem Fuß auf den anderen zu treten. Sanctus verzieht nicht einmal das Gesicht. Wie lange kann dieser Mann nur so starr gucken?
»Oh, das meinte ich auch nicht damit. Sonst hätte ich gefragt, ob du sein Grab besuchen willst. Ich fragte, ob du ihn wiedersehen willst.«
Ich beginne mir mit den Händen das Haar zu durchfahren, bevor ich sie in meine Kopfhaut kralle, bis es schon wehtut.
Vinc.
Der Gedanke an ihn versetzt mir einen Stich in mein Herz. Denn ich sehe wieder die Schlagzeilen vor mir und nicht diesen kleinen, fröhlichen Jungen, der er einst gewesen war.
»Ich glaube, ich verstehe immer noch nicht.« Er wedelt abwehrend mit seiner Hand.
»Das ist mir schon aufgefallen. Aber ich meine es so, wie ich es sage. Der Vinc, den du kanntest, lebt nicht mehr. Das ist wohl wahr.« Er überlegt kurz, wie er fortfahren soll.
»Aber seine Seele lebt weiter. Nicht hier auf Terra. Sag mir, mein Kind, was weißt du über Elementum?«
Jetzt ist er wohl wirklich übergeschnappt. Ich schnaube verächtlich.
»Dem göttlichen Mythos? Ich bitte dich!«
Er rollt verärgert mit seinen Augen.
»Nicht dem Mythos! Dem Parallelplaneten. Dem Planeten, entstanden durch Licht und Dunkelheit. Der Planet, dem Leben durch die vier Elemente eingehaucht wurde und der durch die Seelen der Menschen immer mächtiger wird.«
Ungläubig schüttele ich mit dem Kopf.
»Was willst du mir damit sagen? Vinc soll dort sein? Warum spielst du so mit meinen Gefühlen?«, fauche ich ihn wütend an.
»Willst du deinen Bruder nicht wiedersehen? Ihn berühren? Wenn du das willst, dann solltest du mich erzählen lassen. Ich mache dir klar, was wirklich passiert ist.« Oh nein, erst mal bin ich dran. Mir reicht es langsam! Woher soll er das alles wissen?
»Wer bist du?«
Sanctus starrt mich eine Weile lang an, bevor er meinem Ohr langsam so nahe kommt, dass er es fast mit seinen Lippen berührt. Ein eiskalter Schauer läuft mir über den Rücken.
»Ich bin alles und nichts …« Seine Stimme verändert sich, während er mir weiter ins Ohr flüstert.
»Weder männlich noch weiblich …« Ich nehme ein Geräusch wahr, kann mich allerdings nicht bewegen.
»… weder gut noch böse.«
Gelähmt.
Ich bin vor Angst gelähmt, als er von mir ablässt und sich aufrichtet.
Aber es ist nicht Sanctus, der vor mir steht. Eine Gesichtshälfte ist verkohlt und es stinkt nach verbrannter Haut. Sein Haar ist kaum zu erahnen. Hautfetzen hängen wie zerrissene Stoffe an ihm herab und ich kann an einigen Stellen Knochen erkennen. Schreckliche Übelkeit überkommt mich und ich taumle einige Schritte zurück, bis ich schließlich an die Wand stoße. Ich schaue weiter an ihm herab. Seine Kleidung fängt Feuer und verbrennt weiter. Aber er rührt sich nicht. Er sieht mich einfach nur an. Als ich meinen ersten Schock überwinde und mühselig versuche, die Übelkeit zu bekämpfen, begreife ich, wen ich da vor mir habe.
Es ist Vinc.
Aber nicht der Vinc, den ich zuletzt kannte, sondern der, der kurz vor seinem Tod steht. Als ich ihm wieder in die Augen blicke, erstarre ich. Die Gestalt, die Sanctus’ Augen trägt, sehen mich immer noch an. Grau leuchtend, wie ein wilder, unbändiger Sturm.
Während er auf mich zukommt, ergreift mich die Panik und ich presse mich mit dem Rücken dicht an die Wand.
Es gibt kein Entkommen!
Der Gestank dringt tiefer in meine Nase und verätzt mir die Nebenhöhlen. Einen Meter vor mir bleibt er endlich stehen und redet mir mit zwei Klangfarben zu. Seine undefinierbare Stimme und die von Vinc verbinden sich zu einem Rauschen und lassen ihn wie ein Echo klingen, bis mir ein eiskalter Schauer über den Rücken läuft.
»Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich war nie der, für den ihr mich alle gehalten habt.« Ein Schauer jagt hier den nächsten und ich spüre, wie ich beginne zu schwitzen, obwohl mir immer noch kalt ist.
Plötzlich verändert sich seine Gestalt. Verbrannte Haut wird durch heile ersetzt. Seine Statur wird größer und schmaler und dunkelblaue Haare wachsen aus seiner verbrannten Kopfhaut hervor. Angsterfüllt weite ich meine Augen, als ich in das Gesicht von Reff blicke. Nur, dass er es nicht ist, sondern irgendwer anders. Denn weiterhin liegen graue Augen vor mir.
Er setzt sich erneut in Bewegung, streicht mir mit einem Finger über die Wange, meinen Hals entlang. Während ich ihn genau mustere und zitternd jeder Bewegung folge.
»Ich bin das, was ich bin. Das, für das man sich entscheidet. Das, was jeden leitet.« Er verwandelt sich wieder zurück in Sanctus’ Gestalt.
»Schicksal.«
Schicksal?
Schicksal hin oder her!
Das ist eindeutig zu viel für mein schwaches Gemüt. Ich stoße mich von der Wand ab, schubse Sanctus so kräftig ich kann zur Seite und laufe raus, Richtung See. Ich flüchte wortwörtlich vor meinem Schicksal!
Kurz bevor ich den See erreiche, stoppe ich plötzlich. Ich kann nicht mehr. Schwer atmend beuge ich mich nach vorne und würge so lange, bis ich mich übergebe. Das verbrannte Gesicht meines Bruders, Reffs Gesicht und Körper. Meine unkontrollierbaren Gefühle. Nachdem ich nicht mehr würgen muss, lasse ich mich auf die Knie fallen, schließe die Augen und stecke meinen Kopf komplett ins Wasser. Der Kälteschock lindert das Chaos und dann lasse ich mich rücklings ins Gras fallen. Dank des Kälteschocks kann ich ruhiger, aber nur stark zitternd atmen. Der Schreck zerrt an mir, doch anscheinend werde ich nicht verfolgt. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, denn ich brauche gerade wirklich dringend mal Ruhe. Aber die finde ich nicht. Immer wieder sehe ich Sanctus vor mir. In Vinc’ fürchterlicher Gestalt. Und Reff. Sie brennen sich in mein Hirn und hinterlassen einen stechenden Schmerz, der sich bis ins Herz zieht. Je mehr ich versuche, die Bilder zu trüben, desto mehr klammern sie sich an mir fest.
Die ganze Nacht sitze ich im Gras voller Schnee und denke über mein Leben nach. Als ich meine Glieder endgültig nicht mehr spüre, stehe ich auf, klopfe mir den Schnee von den Beinen und schleiche langsam in Richtung Heim. Ich hoffe, dass ich Sanctus … oder das Schicksal heute nicht mehr zu Gesicht bekomme. Glücklicherweise erfüllt sich die Hoffnung, auch wenn ich tief in meinem Inneren weiß, dass ich dem Schicksal so oder so nicht entkommen kann.
Und das soll mir bereits am nächsten Morgen klar werden. Gedankenverloren hatte ich die ganze Nacht aus dem Fenster gestarrt. Nun wird die Dunkelheit von den Strahlen der Sonne verdrängt. Erst viel zu spät merke ich, wie sich eine Nadel in meine Haut bohrt.
»Au! Verflucht!« Gerade zieht Sanctus die Spritze aus meinem Fleisch.
»Tut mir leid, dass ich dir wehtun muss.« Sehe ich da wirklich Besorgnis in seinen Augen?
»Und wieso tust du es dann?«
Mit zusammengezogenen Brauen tupft er mir eine Heilsalbe auf die Haut. Unter der Berührung zucke ich kurz zusammen.
»Weil ich nicht will, dass du wieder so abrupt losrennst, bevor ich mich richtig erklären kann.
Beziehungsweise wieso ich dir die Fragen bezüglich deines Bruders gestellt hatte. Deshalb hielt ich es für besser, dir ein leichtes Beruhigungsmittel zu geben.«
Ich blicke schnaubend zur Seite, damit ich ihn nicht ansehen muss, und erwidere brüsk:
»Dann hättest du deine gruselige Verwandlung mal besser zuhause gelassen, Schicksal!« Das letzte Wort spucke ich ihm vor die Füße.
Mit hochgezogener Braue sieht er mich an.
»Also bitte! Als ob du mir sonst irgendetwas davon geglaubt hättest, wenn ich es dir normal erzählt hätte.«
Entnervt frage ich:
»Wer sagt denn, dass ich dir jetzt glaube?«
Jetzt ist Sanctus an der Reihe mit Schnauben.
»Du willst also noch mehr Beweise? Ich kann mich in alles verwandeln, was du nur willst. Aber ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Entweder glaubst du mir, oder eben nicht.«
»Dann beantworte mir erstmal nur eine Frage.« Jetzt horcht er auf.
»Wieso hast du dich für diese Gestalt entschieden?«
Seine Mundwinkel zucken kaum merklich und seine Gesichtszüge entspannen sich wieder.
»Für dieses Heim bin ich nur diese Gestalt. Ich bin nicht nur hier, bei dir, sondern überall auf ganz Terra. Hier bin ich präsenter als auf Elementum. Du kannst es dir so vorstellen: Ich bin ein Abgesandter von Elementum und versuche durch das, was ich tue, die
Menschen zum richtigen Handeln zu bringen.«
Skeptisch betrachte ich ihn.
»Du sagtest, du wärst weder gut noch böse. Also bezweckst du trotzdem, dass die Menschen sich entscheiden, gut zu sein?« – Schnell antwortet er:
»Nein, ich begleite die Menschen nur und leite sie auf ihrem Weg. Jeder ist selbst für sein Schicksal verantwortlich und muss die Konsequenzen alleinig tragen. Sie sind in ihrer Entscheidung frei.« Ah ja, okay.
»Also zeigst du dich ihnen so, wie mir gestern?« Sanctus lacht kurzzeitig auf, worauf ich ihn am liebsten getötet hätte. Natürlich geht das nicht, aber was ist denn so witzig daran?
»Nein, niemals würde ich das – ich bin wie die Luft, die sie atmen. Ich entscheide mich nur in äußersten und besonderen Notfällen dazu, mich so zu zeigen, wie gestern.«
Endlich sieht er mir in die Augen. Aus irgendeinem Grund fange ich an, ihm zu glauben.
»Und ich bin so ein besonderer Notfall?«
»Ja, in der Tat, das bist du.«