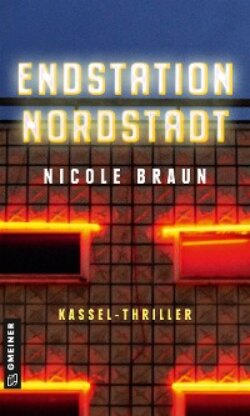Читать книгу Endstation Nordstadt - Nicole Braun - Страница 15
9
ОглавлениеIch ging die Straße entlang zu meinem Auto. Um diese Tageszeit zeigte die Nordstadt ungeschminkt ihr hässliches Antlitz. Keine Leuchtreklamen lenkten von dem Erbrochenem ab, das der Regen zu großen Lachen ausgewaschen hatte. Bis weit nach Mittag schien das Viertel seinen Rausch auszuschlafen und Kraft für die kommende Nacht zu sammeln.
Als ich in den Wagen stieg, fragte ich mich, ob es nicht leichter wäre, mir endlich einzugestehen, dass ich in der Nordstadt meine Heimat gefunden hatte. Der Gedanke stieß saurer auf als Mollys Kaffee.
Ich ließ den Motor an und fuhr den kurzen Weg in die Innenstadt bis zu meiner Kanzlei. Seit man für diesen hochglanzpolierten Einkaufspalast oberhalb vom Königsplatz den großen Parkplatz geopfert hatte, musste ich länger herumkurven als vorher. Endlich fand ich eine Lücke und parkte den Ford mit der Schnauze im eingeschränkten Halteverbot. Die Politessen kannten meine senfgelbe Kiste und übten Nachsicht, im Gegenzug bekamen sie den einen oder anderen rechtlichen Rat von mir kostenlos.
Ich nahm den kleinen Umweg über den Königsplatz. Hier sah es aus, als hätte man versucht, den Zustand Kassels nach dem Krieg zu rekonstruieren. Die Bauarbeiten für die Neugestaltung des Platzes liefen trotz des schlechten Wetters weiter. Man hatte wohl den Ehrgeiz, zur Documenta im Juni fertig zu sein. Ich kannte die Pläne und war mir sicher, dass ich mich in hundert Jahren nicht an diesen leeren, seelenlosen Ort gewöhnen würde, der der Königsplatz bald sein sollte. Es war gerade mal zwei Jahre her, dass die Kinder im Sommer mit nackten Füßen durch die Wasserbassins getrampelt waren. Conny hatte am Rand gesessen und das Eis gegessen, das die Kinder erst quengelnd eingefordert und dann nicht mehr gemocht hatten. Vielleicht tat die Stadt mir sogar einen Gefallen damit, diese Erinnerungen mit dem Bagger in Schutt und Asche zu legen.
An einem Kiosk, der behelfsmäßig in einem Container untergebracht worden war, deckte ich mich mit den Tageszeitungen ein, die in Schuhmanns ehemaligem Wirkungskreis lagen. Mal sehen, ob die Presse konkretere Informationen hatte als ich.
In der Unteren Königsstraße kaufte ich ein Hörnchen und eine Tüte Milch und bog mit vollen Armen in die Hedwigstraße ein. Ich ärgerte mich, dass ich keine Tüte mitgenommen hatte. Nun musste ich meine Aktentasche vor dem Hauseingang abstellen, der gerne als Toilette missbraucht wurde.
Keine 50 Meter von der Einkaufsmeile entfernt flanierten kaum noch Passanten. Die Seitenzweige der Unteren Königsstraße waren ohnehin nicht besonders beliebt. Kaum der geeignete Platz für eine Kanzlei könnte man meinen, doch ich hatte absichtlich einen Ort gewählt, der vom geschäftigen Trubel ein wenig abseits, aber trotzdem zentral lag.
Die Kanzlei in der Wilhelmsstraße hatte ich aufgegeben, um dem Ärger mit den ansässigen Geschäftsleuten aus dem Erdgeschoss ein Ende zu setzen. Irgendwann hatte ich zunehmend Besuch von Menschen bekommen, die an der Mauer am Friedrichsplatz ihrem Tagwerk nachgingen – betteln und drücken. Zunächst hatten die Ladeninhaber im Erdgeschoss noch die Nase gerümpft. Es war ihnen lästig gewesen, dass sich meine Mandanten vor dem Eingang mit zittrigen Fingern eine Zigarette ansteckten oder mit Begleitern in hitzige Diskussionen gerieten. Nachdem einige mit dem Hinweis verscheucht worden waren, dass Herumlungern an diesem Ort nicht erwünscht sei, hatte ich mich für eine geeignetere Gegend entschieden – passender für mich und meine Mandanten.
In der Regel vertrat ich Kleinkriminelle, seltener Menschen, die schwere Delikte wie Mord oder Totschlag begangen hatten. In den letzten Jahren immer häufiger als Pflichtverteidiger. Wenn mich ein Klient von sich aus aufsuchte, dann deshalb, weil ihn Kollegen abgewiesen hatten. Die Situation war schon selten absurd: Ich sollte als Rettungsanker herhalten, dabei war ich selbst am Absaufen.
Ohne anzuhalten, passierte ich die Reihe Briefkästen im Flur. Für Mahnungen hatte ich im Augenblick keinen Nerv, darum würde ich mich später kümmern.
Ich erklomm die drei Etagen, indem ich jeweils eine Treppenstufe übersprang, schloss die Tür zu meiner Kanzlei auf und warf die Aktentasche im winzigen Eingangsbereich in die Ecke. Zwei Türen hatte man der Eingangsnische abgetrotzt, die linke führte zum Klo, ich ging rechts in mein Büro.
Es war nicht gerade einfach, ein freies Fleckchen für das mitgebrachte Frühstück zu finden. Schließlich schob ich mit dem Ellenbogen eine Stelle auf dem Schreibtisch frei und legte die Zeitungen ab.
Hinter zwei Schranktüren versteckte sich eine kleine Pantryküche, dort türmte sich dreckiges Geschirr. Ich spülte die Kaffeekanne aus und setzte mit den letzten Krümeln aus der Dose neuen Kaffee auf.
Zwischen den Aktenbergen stand die Tasse von gestern, von einem eingetrockneten Rest abgesehen noch einwandfrei. Ich stapelte die Ordner auf dem Schreibtisch aufeinander und breitete die HNA aus. Oberhalb des Artikels prangte übergroß das unsägliche Foto, darunter ein knapper Text. Franz Schuhmann war auf tragische und ungeklärte Weise aus dem Leben geschieden. Hinweise auf ein Verbrechen gab es laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei keine, allerdings hatte man auch noch keinen Abschiedsbrief entdeckt. Dann folgte eine erstaunlich ausgiebige Würdigung des Verstorbenen, der als überaus erfolgreicher Geschäftsmann, ehrenamtlicher Wohltäter und angesehener Bürger der Stadt gelobt wurde. Ein Kommentar im Göttinger Boten zeichnete ein vollkommen gegensätzliches Bild: Der Text glich eher einer Aneinanderreihung der Untaten des Verstorbenen und hinterließ bei mir den Eindruck, dass es an ein Wunder grenzte, dass Schuhmann sich nicht eine grausamere Art zu sterben ausgesucht hatte, nur um angemessen Buße zu tun.
Die Wahrheit lag mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo in der Mitte. Seltsam fand ich jedoch, dass niemand eine Verbindung zu den jüngsten Selbstmorden gezogen hatte. Vielleicht, weil dieser Tote sich am Ort seines vermeintlichen Erfolgs erhängt hatte, während die anderen intimere Arrangements für ihre Abgänge gewählt hatten.
Mit einer Tasse Kaffee in der Hand ging ich zum Schreibtisch. Bevor ich mich setzte, griff ich zum Mantel, den ich über den Schreibtischstuhl geworfen hatte. Ich fummelte die Liste aus der Tasche, die Sharp mir übergeben hatte, dabei fielen vier Hunderter auf den Boden. Ich sah sie an. Ich hätte sie aufheben und in die Manteltasche stopfen oder irgendwo zwischen den Aktenbergen verstecken können, wo ich sie sicher nicht so schnell wiederfinden würde. Doch ich ließ sie einfach liegen und pfefferte den Mantel in die Ecke.
Danach breitete ich Sharps Liste aus und überflog die Namen, während ich das Hörnchen gedankenverloren in den Kaffee stippte und an dem aufgeweichten Teig nuckelte.
Ausgerechnet mir hatte Sharp Betriebsgeheimnisse anvertraut, und das sollte etwas heißen. Es schien ein für ihn recht ungewöhnliches Problem zu sein, dass er zu so einer Maßnahme griff, denn üblicherweise wurden Ärgernisse dieser Art innerhalb der Familie geregelt. Ich ging die Namen durch. Soweit ich es auf den ersten Blick beurteilen konnte, allesamt keine Berühmtheiten, aber immerhin überwiegend Kasseler Größen in ihrem jeweiligen Metier. Drei, nein seit gestern waren es ja vier, also vier von den sechs Personen waren nicht mehr am Leben. Michael Zanetti, irgendein hohes Tier bei der Gewerkschaft, Galerist Sandro Ratstetter, Verleger Roman Levin und jetzt der Insolvenzverwalter Franz Schuhmann. Zwischen den ersten drei Selbstmorden klaffte je eine Lücke von beinahe einem Jahr, die beiden letzten trennten nur wenige Wochen. Außerdem unterschied sich jeweils die Art der Selbsttötung. Entweder lag hier ein makabrer Zufall vor oder jemand gab sich allergrößte Mühe, Gesetzmäßigkeiten zu vermeiden. Der einzige Hinweis darauf, dass möglicherweise ein Serientäter eine Liste abarbeitete, lag direkt vor mir. Und außer mir und Sharp kannte offensichtlich niemand diesen Zusammenhang. Aber wozu die derart aufwendig inszenierten Tötungen? Nur um Sharp zu schaden? Oder griff da einer das Geld ab, das Sharp verliehen hatte?
Es klingelte. Um diese Zeit vermutlich der Postbote mit einem Einschreiben. Sicher wieder ein Vollstreckungsbescheid oder eine Vorladung. Da es einen Mandanten betreffen konnte, hatte ich keine Wahl. Ich zögerte. In dieser Gegend war es ratsam, die Gegensprechanlage zu benutzen, doch die war wie üblich defekt. Also drückte ich den Türöffner und lauschte in das Treppenhaus. Ich hatte mittlerweile ein gutes Gehör für die Geräusche entwickelt, die sich die Stufen hinaufbewegten. Sergejs 100-Kilo-Schritt in Militärstiefeln hätte ich bereits in der ersten Etage erkannt. Gleichzeitig wäre es genauso sinnlos gewesen, ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen, wie aus dem Fenster zu springen.
Das erwartete Poltern von Sergej blieb aus, und ich lauschte auf den gehetzt sportlichen Gang des Postboten, zwei Treppenstufen auf einmal nehmend, auf den Etagenabsätzen keine Sekunde Pause, um zu verschnaufen.
Zu meinem Erstaunen näherte sich ein gleichmäßiges Stakkato, verursacht durch spitze Absätze einer federleichten Trägerin. Ich roch sie, bevor ich sie sah. Durch das muffige Treppenhaus waberte der Duft eines Blumenteppichs, auf dem sie sich elegant die Stufen nach oben bewegte. Blondes Haar wippte über die Brüstung, dann tauchten strahlend geschminkte Augen auf, danach ein blutroter Mund.
Riva Levin trug einen figurbetonten, halblangen roten Mantel mit dunklem Nerz am Kragen. Der Stoff wirkte fein, wahrscheinlich Kaschmir, und die Härchen des Felles zitterten in der Zugluft und wirbelten ihr Parfüm direkt in meine Nase. Allein von dem, was der Mantel gekostet haben mochte, hätte ich einen Monat fürstlich leben können.
Oder eine Nacht besinnungslos zocken.
Ich konzentrierte mich auf die Frau, die nun keinen halben Meter von mir entfernt stand und die Beine in eine Position gebracht hatte, die ihre Silhouette vorteilhaft zur Geltung brachte.
Während ich noch überlegte, wie ich es umgehen konnte, sie in das chaotische Büro reinbitten zu müssen, kam sie mir zuvor.
»Darf ich?« Sie zeigte auf die Tür, deren Klinke ich in meinem Rücken festhielt.
»Selbstverständlich«, sagte ich weniger selbstsicher als beabsichtigt, trat einen Schritt zur Seite und ließ sie an mir vorbei in den winzigen Flur.
»Tut mir leid, die Garderobe ist kaputt.«
Sie warf einen Blick auf den Haken, der an einer losen Schraube von der Wand baumelte, und nickte.
»Kommen Sie ins Büro, dort können Sie ablegen.« Während ich voranging, war ich froh, dass durch all die Unordnung wenigstens der Duft von frischem Kaffee wehte.
Sie sah sich um. Ihre Augen blieben an den 100-Mark-Scheinen auf dem Fußboden hängen und sie lächelte. »Das Geld liegt nicht immer nur auf der Straße, sondern manchmal wohl auch auf dem Boden einer Anwaltskanzlei.«
Schnell hob ich die Scheine auf und ließ sie achtlos auf den Schreibtisch fallen. »Ich brauchte Platz für die Zeitungen«, sagte ich, erleichtert darüber, dass die aufgeschlagenen Gazetten die Unordnung darunter verbargen.
Sie trat einen Schritt nach vorne und überflog die Schlagzeilen, während sie ihren Mantel aufknöpfte, ihn auszog und ihn sich über den Unterarm hängte. Anschließend deutete sie auf die Fotografie der Fabrikhalle mit dem Leichenwagen davor. »Ich war mir erst unsicher, ob Sie das sind. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie zufällig dort waren.«
Was sollte ich darauf antworten? Ich zuckte lediglich die Schultern.
»Hat das etwas mit dem Tod meines Mannes zu tun?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Man könnte einen Zusammenhang sehen.«
»Wenn Sie den Weg hierher auf sich genommen haben, um über den Tod von Franz Schuhmann zu plaudern, muss ich Sie enttäuschen. Darüber weiß ich nicht mehr, als in diesem Artikel steht.«
»Darf ich mich setzen?« Sie zeigte auf den Stuhl, der halb unter der herabhängenden HNA verborgen war.
»Selbstverständlich«, entgegnete ich, indem ich die Zeitung zusammenraffte, darauf bedacht, dass der Großteil des Schreibtisches abgedeckt blieb. »Kaffee?«
»Gerne. Schwarz.« Sie nahm Platz und legte den Mantel über die Oberschenkel.
In der Kochnische wählte ich eine Tasse, deren Belag mir am einfachsten zu entfernen schien, spülte sie notdürftig und trocknete sie mit dem brettharten, fleckigen Handtuch ab, das schon seit Wochen in der Spüle hing. Es gab Momente im Leben, da wünschte ich mir das breite Kreuz von Sergej. Ich konnte ihren Blick in meinem Rücken förmlich spüren und bemühte mich, nicht fahrig zu wirken.
Nachdem ich ihr eingeschenkt hatte, hielt ich ihr die Tasse hin. Sie nahm sie leicht wie ein Vögelchen zwischen ihre perfekt manikürten Finger, roch am Inhalt, nippte vorsichtig und schien zufrieden.
Ich atmete tief ein und füllte Kaffee in meinen Becher nach, der noch auf dem Schreibtisch stand.
Währenddessen wartete sie ab, bis ich ihr gegenüber saß. »Sie hatten mich gefragt, ob ich die Männer kannte, die in den letzten Monaten Selbstmord begangen haben.«
»Das hatte ich gefragt, richtig.«
»Und ich hatte Ihnen geantwortet, dass Sie mir persönlich nicht bekannt waren.«
»Ich erinnere mich.«
Sie deutete auf die aufgeschlagenen Zeitungen. »Herrn Schuhmann habe ich recht gut gekannt. Das heißt, eigentlich nicht ihn, sondern ich kenne seine Ehefrau Erin. Wir sind uns hin und wieder im Schönheitssalon begegnet.«
»Und Sie sind extra hierhergekommen, um mir das mitzuteilen?«
»Nicht nur.« Erneut trank sie einen kleinen Schluck und schien zu überlegen. »Ich war neugierig. Ich wollte wissen, wie ein Anwalt residiert, der sich im Auftrag von Geldeintreibern verdingt.«
»Konnten Sie Ihre Neugier befriedigen?« Ich versuchte, nicht ärgerlich zu klingen.
»Durchaus. Sagen Sie, wie heißt eigentlich Ihr Auftraggeber? Ich glaube, das hatten Sie vergessen zu erwähnen.« Sie legte den Kopf schief.
»Sagt Ihnen der Name Horst Scharpinsky etwas?« Ich wollte nicht um den heißen Brei herumreden, zumal ich das Gefühl hatte, dass sie es ohnehin wusste. Scharpinsky war in Kassel bekannt wie ein bunter Hund, und außer ihm kam nur noch einer infrage, der hinter einer solch hohen Summe geliehenen Geldes her sein konnte.
Sie nickte. »Scharpinsky oder Bahat. Einer von beiden musste es ja sein. Das sind doch die Herren, die Kassel mit ihrem Schwarzgeld überschütten, oder?«
»Wie kommt es, dass eine Frau wie Sie sich in solchen Kreisen auskennt?«
Aus ihrem Blick sprach eine Mischung aus Skepsis und Amüsement. »Das erfährt man alles aus der lokalen Presse. Ich wiederum frage mich, warum ein Anwalt für Strafrecht sich mit diesen Menschen abgibt.«
Jetzt musste ich lachen. »Sie haben ja gar keine Ahnung, mit was für Menschen sich ein Anwalt für Strafrecht abgeben muss.«
»Ja, sicher.« Sie lächelte verständnisvoll. »Aber Scharpinsky ist nicht Ihr Mandant, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern Ihr Auftraggeber.«
Ich hatte keine Lust, mich zu rechtfertigen, und startete ein Ablenkungsmanöver. »Ihr Mann hatte ja offensichtlich auch Kontakt zu Scharpinsky.«
»Das stimmt leider. Und ich würde zu gerne wissen, warum. Vor allem, warum er das hinter meinem Rücken getan hat.«
»Und die Antwort auf diese Frage erwarten Sie von mir?«
»Das wäre schön.«
»Da lauert ein Interessenskonflikt, wie Sie sich sicher denken können.«
Ohne ein weiteres Wort öffnete sie ihre Handtasche, zog ein Bündel Geldscheine heraus, stand auf und legte es auf die Zeitung.
Ein Herr auf braunem Untergrund schaute ernst vom Schein zu mir herauf, als ahne er, was eine Eins mit drei Nullen in meinem Hirn für einen Wirbel veranstaltete. Ich wagte gar nicht zurückzusehen. Mir wurde schwindelig.
»Könnte das Ihren Interessenskonflikt mildern?«
»Sie wissen, dass mich das in riesige Schwierigkeiten bringt.«
»Wenn ich die Sachlage richtig einschätze, stecken Sie bereits bis zum Hals drin.« Sie setzte sich wieder auf den Stuhl, schlug die Beine übereinander und guckte unschuldig. »Ich habe keine Ahnung, was geschehen ist. Warum mein Mann glaubte, mit diesen Leuten Geschäfte machen zu müssen, und warum er jetzt tot ist. Ich will es einfach verstehen. Und der Einzige, der mir dabei helfen kann, sind Sie. Sie sollen nichts Ungesetzliches tun. Ich möchte nur denselben Wissensstand wie Ihr Auftraggeber, mehr nicht.«
»Es ist ungesetzlich, als Anwalt zwei Parteien in derselben Sache zu vertreten.«
»Sie geben mir, was Sie können, ohne in Teufels Küche zu kommen. Wäre das in Ordnung?«
Ich spürte, dass ich nickte, während mein Blick über die Scheine glitt. Der Teufel hatte gerade einen Stuhl für mich an den Küchentisch gestellt.