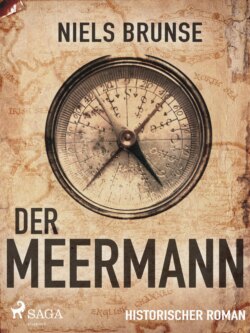Читать книгу Der Meermann - Niels Brunse - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеIm Morgengrauen hörte ich, wie der Knecht das Pferd vor die kleine zweirädrige Kutsche des Pastors spannte, und ich hörte die Stimme des Pastors, als er aus dem Haus kam und auf den Bock stieg. Dann klapperten die Räder über die Steine des Hofplatzes, knirschten im Kies der Einfahrt und rollten über die Dorfstraße davon. Zwei Tage wollte er in Norwich bleiben, zwei Tage, an denen es auf dem Pfarrhof eine Person weniger gab, die mich im Auge behalten konnte. Ich streckte mich und stand auf.
Von meinem Schreibplatz am Tisch konnte ich verfolgen, was im Haus vor sich ging. Als ich eine Seite geschrieben hatte, kam Frau Deborah ins Zimmer, holte ein Buch und einen Brief und bat den Knecht, beides zum Pastor der Nachbargemeinde zu bringen. Ich ließ mir nichts anmerken, ermittelte aber auf meiner inneren Skala, dass er dazu mindestens einige Stunden brauchen würde, da der Pastor das Pferd hatte und der Knecht zu Fuß gehen musste.
Als ich gut drei Seiten geschrieben hatte, fingen die Pastorin und die Magd in der Küche an, Brot zu backen. Es handelte sich um ein größeres Unterfangen, denn es galt, mehrere Kilo Teig zu kneten und den Backofen anzufeuern, sie würden also fürs Erste ausreichend zu tun haben. Beinahe gleichzeitig brach die Sonne hinter den Wolken hervor und schien durchs Fenster, direkt auf meine Schreibhand.
Ich beendete den Satz, machte einen Punkt, nahm einen neuen Bogen und schrieb:
Lieber Pastor Strongworth. Ich danke Euch für Eure Freundlichkeit und Gastfreundschaft, aber ich kann nicht länger bleiben. Nun muss ich mein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. John Vivilt
Ich setzte einen Strich unter meinen Namen, einen dicken, schwarzen Schlussstrich, denn ich wusste, dass ich diesen Namen zum letzten Mal benutzte. In London würde ich mich anders nennen. Ich wollte nicht noch einmal aufgespürt und hierher zurückgebracht werden.
Den kurzen Brief legte ich unter den Stapel der beschriebenen Bögen, klappte das Buch zu, verkorkte das Tintenfass und schlich mich aus der Haustür. Ich ging ums Haus herum, damit ich nicht am Küchenfenster vorbei musste. Kurz darauf trat ich mit meiner kleinen Kiste unter dem Arm durch eine Hintertür in den Pfarrgarten und lief die Hecke an dem kümmerlichen Feld des Nachbarn entlang, hinunter zum Fischerlager.
Die Männer waren auf See, aber Meg und Harry empfingen mich. »Ist es an der Zeit?«, fragte Meg. »Ja«, antwortete ich, »so schnell wie möglich.«
Sie gab mir etwas gesalzenen Fisch, reichte mir einen Tonkrug mit Trinkwasser und erklärte mir, dass er einem der anderen Fischer gehöre. Seinen Namen habe ich vergessen. Sehr ernst verabschiedeten wir uns voneinander und Harry klammerte sich einen langen Augenblick an mein Bein, aber auch er verstand, dass es jetzt darum ging, rasch zu handeln. Er fasste mit an, als wir mein kleines Boot ins Wasser schoben.
Der Wind stand nicht sonderlich günstig, aber es gelang mir, mit ein paar unbeholfenen Manövern abzulegen, dann nahm ich Fahrt auf. Weit entfernt sah ich ein Boot mit geborgenen Segeln und drei Männern an Bord – sie konnten mich zweifellos an meiner wunderlichen Takelage erkennen. Alle drei winkten mit ausladenden Armbewegungen, es mussten meine Freunde sein; der Mittlere von ihnen – der Statur nach zu urteilen, John – setzte die Hände vor den Mund und schrie irgendetwas, aber der Wind riss die Worte mit sich und ich hörte nichts als einen lang gezogenen Uuu-Laut. Der Sinn jedoch war nicht misszuverstehen: Viel Glück. Ich winkte zurück, musste mich aber gleich darauf wieder um Schot und Ruder kümmern.
Es war ein zähes Unterfangen, in dem unsteten Wind voranzukommen. Ich hatte keine Karte und steuerte mehr oder weniger von Küstenvorsprung zu Küstenvorsprung. Früher oder später musste die Themsemündung auftauchen, aber ich hatte nicht einmal eine klare Vorstellung davon, wie ich sie erkennen sollte. Ich segelte durch einen Regenschauer, der meine Kleider durchnässte und heftige Böen mit sich brachte, so dass ich die ganze Zeit höchst konzentriert agieren musste. Doch durch das kleine Segel und den niedrigen Mast konnte das Boot glücklicherweise nicht so leicht kentern und ich musste mich nicht einmal hinauslehnen, um es gerade zu halten. Nach dem Regen flaute der Wind etwas ab. Ich nutzte die Gelegenheit, zog mir das nasse Zeug vom Oberkörper und wechselte es mit dem trockenen Hemd aus der Kiste; dadurch wurde mir wieder warm.
Bei Einbruch der Dunkelheit hatte ich noch immer nichts gesehen, das auch nur im Geringsten an die Themse erinnerte. Ich segelte aufs Land zu und fand eine Stelle im Windschatten einer Landzunge. Dort zog ich das Boot ein Stück ans Ufer und aß zu Abend. Gesalzener roher Fisch und Wasser sind eine harte Kost, aber ich hatte Hunger und hätte auch einen Schuh verspeisen können. Dann legte ich mich ins Boot, um zu schlafen. Sollte es im Laufe der Nacht ins Wasser rutschen und abtreiben, wollte ich zumindest an Bord sein.
Ich erwachte bei Sonnenschein und einem lebhaften Nordwestwind. Nun ließ es sich problemlos segeln und kurz nach Mittag bot sich ein Anblick, der mir die Nähe des Flusses verriet, dass kein langer Weg mehr vor mir lag: Vier, fünf große Handelsschiffe, die dicht hintereinander vor Anker lagen und offensichtlich auf Hochwasser warteten. Es musste die Themsemündung sein, die sich hier öffnete.
Während ich näher kam, begannen die Schiffe Segel zu setzen, und schon bald schaukelten sie in Richtung Land davon. Der Wind und die Tide waren eindeutig mit ihnen und ich begleitete sie durch eine weite Bucht, die sich rasch verengte und mehr und mehr von größeren und kleineren Schiffen, Jollen mit Sprietsegeln und vereinzelten Schaluppen befahren wurde, die sechs oder acht Männer ruderten. Geräusche von knallendem Segeltuch und knarrendem Tau vermischten sich mit dem Glucksen und Rauschen des Wassers und den Kommandorufen der Bootsmänner; die Schiffe glitten vorüber wie große Seevögel mit ausgespannten Schwingen. Es war ein phantastischer Anblick, aber ich hatte keine Zeit, ihn zu genießen.
Der Wind hatte noch mehr auf Nord gedreht und die Schiffe und Jollen machten gute Fahrt. Ich hielt mich, so nah ich konnte, am Ufer zu meiner rechten Seite, um manövrierfähigeren Booten nicht in die Quere zu kommen. Und dann passierte es. Mit einem splitternden Geräusch kam mein Boot ruckartig zum Stehen und ich starrte auf das spitze Ende eines schräg abgebrochenen Pfahls, der sich direkt unter der Wasseroberfläche verborgen hatte und nun eine morsche Stelle am Bootsboden durchbohrte – Flusswasser drang durch das Loch. Durch den Wind und die Strömung begann mein Boot zu schwojen und die Drehbewegung ließ das Leck nur noch größer werden. Ich hatte keine Wahl, ich musste über Bord springen. Das Wasser war brackig und undurchsichtig. Ich hielt meine kleine Kiste über den Kopf und sprang aufs Geratewohl hinein. Glücklicherweise fand ich Grund unter den Füßen. Bis zu den Achseln stand ich im Wasser und die Strömung riss mich beinahe um, doch nach ein paar zappelnden Schritten kam ich dem Ufer näher.
Bald stand ich am sicheren Ufer, durchnässt und schlammiggrau, und sah zu, wie mein kleines Boot langsam kenterte und sank. Aber so aufgespießt wie es war, konnte es weder ganz untergehen noch abgetrieben werden, die Segel flatterten wirr im Wind. Ich war drauf und dran, mich noch einmal ins Wasser zu werfen, um sie zu bergen, sah aber ein, dass es sinnlos war. Stattdessen fiel mir ein, dass ich das Boot nie getauft hatte – und im Stillen gab ich ihm den Namen Spatz. Obschon kein richtiger Seevogel, war er doch tapfer geflogen und hatte mich beinahe bis London gebracht.
Das war das zweite Mal, dass ich ein Boot verlor. Nur gab es diesmal niemanden, der mich rettete; ich musste selbst zu der staubigen Straße finden und mit durchweichten, schmatzenden Schuhen in Richtung Stadt gehen, die ich nur als gelblichbraunen Dunst am Horizont ahnte – es war der Rauch der vielen Schornsteine. Die Sonne schien, aber sie hatte nicht die Kraft, um das nasse Zeug an meinem Körper zu trocknen, und die Schatten waren bereits lang geworden, als ich an einem Fachwerkhaus vorbeikam. Es war ein Haus mit zwei Stockwerken, in der Mitte gab es eine Toröffnung und über der Eingangstür hing ein Schild an einer Stange. Das Schild stellte einen Elefanten dar, eindeutig von jemandem gemalt, der ein derartiges Tier noch nie gesehen hatte. Ich vermutete, dass es sich um ein Wirtshaus handelte.
Ich blieb stehen und dachte: Warum soll ich es nicht versuchen? Ich war müde und hungrig, und die Kälte der klammen Kleider zog mir in die Knochen. Der Gedanke an eine weitere Nacht im Freien war unerträglich. Ich trat unter dem Elefantenschild ein und wurde von einem feisten Mann in einer schmutzigen Leinenschütze empfangen. Er sah ebenso unwirsch wie zuvorkommend aus und ich war ziemlich sicher, dass es sich um den Wirt handeln musste.
»Kann ich hier meine Kleider trocknen?«, war das Erste, was ich sagte.
Er musterte mein nicht sonderlich vertrauenerweckendes Äußeres und fragte: »Hast du Geld?«
»Mein Boot ist auf dem Fluss gesunken«, erwiderte ich. »Ich habe nur das hier.« Und stellte die Kiste auf einen Tisch.
Er öffnete sie und nahm die Sachen heraus. Die Strümpfe gab er mir sofort zurück, aber das Hemd interessierte ihn. Er befühlte den Stoff und suchte ihn nach abgenutzten Stellen ab; es störte ihn offenbar nicht, das es nach dem Regenguss auf dem Meer noch immer feucht war. Die Kiste wurde von allen Seiten begutachtet.
»Dafür kannst du heut Nacht ein Bett bekommen, Holz für den Kamin sowie Brot und Käse«, erklärte er und klopfte mit einem Finger auf die Kiste. »Und für das Hemd zehn Pence.«
Wahrscheinlich war es viel zu wenig, aber ich schlug ein. Später sollte ich mich noch oft genug mit Brot und Käse begnügen müssen, aber dort in der Wirtsstube schmeckte es zusammen mit einem großen Krug kühlen Wassers, das der Wirt gnädigerweise nicht berechnete, großartig.
Auch am Kaminfeuer der Kammer, die man mir anwies, war nichts auszusetzen. Als ich meine Mahlzeit beendet hatte, war bereits jemand dort gewesen und hatte angefeuert. Mir stand die Kammer zunächst allein zur Verfügung, obwohl sich drei Betten darin befanden; ich hängte meine noch immer klammen Sachen über ein paar Stuhllehnen vor das Feuer und kroch nackt zwischen die Laken.
Die Matratze war aus Stroh, aber es war eine Matratze. Und es gab Laken. Und eine Wolldecke. Und das Bettgestell stand auf dem Boden und bestand nicht nur aus einem Strohhaufen auf der bloßen Erde. Beinahe hatte ich vergessen, was für ein Gefühl es war, auf zivilisierte Weise zu schlafen. Vor Müdigkeit und Erleichterung schlief ich auf der Stelle ein.
Ich erwachte, als der Wirt mit einer Kerze in der Hand einen anderen Reisenden ins Zimmer führte. Da ich ja wusste, dass so etwas passieren konnte, war ich nicht sonderlich überrascht. Draußen war es dunkel, aber die Glut im Kamin leuchtete noch immer schwach, und so konnte ich erkennen, wie der Fremde Mantel und Stiefel auszog und neben dem Bett, das man ihm zugewiesen hatte, kniete. Er war einfach gekleidet und hatte, soweit ich sehen konnte, ein zerfurchtes Gesicht und graues schulterlanges Haar. Kaum ein gefährlicher Zimmergenosse, vielleicht ein älterer Kaufmann auf dem Weg nach London, so wie ich. Er betete ein unverständliches, von Räuspern und Husten durchsetztes Nachtgebet und kam danach nur mühsam auf die Beine, wobei er einen gediegenen Furz von sich gab. Bald schnaufte er still und friedlich in seinem Bett.
Nicht der neue Mitbewohner hielt mich wach. Es war ein in mir aufsteigender Gedanke, der mich am Einschlafen hinderte. Nun hatte ich mich so weit von Winterton entfernt und hatte so viel Neues gesehen, und doch gab es noch immer keinen, aber auch nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass ich mich möglicherweise doch in meiner eigenen Zeit befand. Alles passte in »die Zeit der anderen«, und wenn ich noch eine winzig kleine Hoffnung gehabt hatte, einen Riss in dem Bild zu finden, so musste ich jetzt sogar diesen kleinen hypothetischen Vorbehalt abschreiben. Es war, als hätte das Schicksal – oder was auch immer es war – sich einen Spaß damit gemacht, meine Faszination für frühere Zeiten beim Wort zu nehmen und sie mich nun persönlich erleben zu lassen. Ich dachte an meinen Spitznamen im Gymnasium und auf der Universität – er war mir bis auf die Uni gefolgt, weil einer meiner Klassenkameraden sein Anglistikstudium gleichzeitig mit mir begann. John Gammeldags, John Altertümlich. Manchmal verdrehten meine Freunde die Augen zum Himmel, wenn ich mich über Holbergs Episteln, Shakespeares archaische Schurken oder Dickens’ Beschreibungen der merkwürdigsten, längst verschwundenen Milieus verbreitete. Und Milton, ganz ehrlich! Sie hätten sich eher einen Arm der Länge nach gebrochen, als sich mit Miltons Versen zu beschäftigen. Doch Milton hatte irgendetwas in mir angestoßen und plötzlich entdeckte ich, dass ich noch immer Bruchstücke seiner Gedichte auswendig konnte, obwohl ich nicht sonderlich viel dafür getan hatte. Leider war das aber auch schon alles, ich hatte mich überhaupt nicht mit seinem Hintergrund und seiner Zeit beschäftigt; jetzt hätte es mir wirklich nützen können … Waren all meine Erlebnisse hier nur ein langer Traum, eine mystische Visite all der Vorstellungen, die ich mir gemacht hatte? Aber wieso gerade England und warum diese Epoche? Und wenn es ein Traum war, hatte ich doch noch nie einen Traum erlebt, der so lang dauerte und sich physisch so lebendig präsentierte. Noch immer hatte ich Schrammen und blaue Flecken, weil ich für Pastor Strongworth schwere Lasten schleppen musste, und an den Fingern meiner rechten Hand waren noch immer die Spuren seiner Tinte zu erkennen …
Ich muss dennoch eingeschlafen sein, denn als ich erwachte, war es hell und der Kaufmann bereits fort. Meine Sache waren alle noch da, also zog ich mich an und bürstete notdürftig den eingetrockneten Schlamm heraus. Die Schuhe sahen schlimm aus, aber sie waren trocken; sie hatten sich sogar geweitet, weil ich so lange in ihnen gelaufen war, als sie noch feucht waren. Nun drückten sie endlich nicht mehr.
Als ich herunterkam, war die Wirtsstube leer. Da ich keine Lust hatte zu warten, machte ich mich einfach auf den Weg. Schließlich schuldete ich niemandem etwas und besaß lediglich, was ich am Körper trug und in den Taschen hatte: drei Paar Strümpfe und das klimpernde Kleingeld, das der Wirt mir für das Hemd des Pastors gegeben hatte. Geld in der Tasche, ein fast vergessenes Gefühl. Ich war guten Muts.
Ich weiß nicht, wie lange ich gelaufen bin und ich weiß auch nicht mehr, wie die Lichtverhältnisse waren, ich erinnere mich nur an das überwältigende Gefühl, als ich von einer Anhöhe der Straße das massive viereckige Gebäude mit den kleinen Ecktürmen erblickte, das ich sofort wiedererkannte. Der Tower, the Tower of London! Es war das erste Mal, dass ich in diesem fremden England etwas sah, das mir nicht unbekannt war. Den Tower hatte ich mit meinen Eltern besucht, ich war einmal allein dort gewesen und dann zusammen mit Christine auf einer Spritztour übers Wochenende. Oder richtiger, ich würde den Tower in dreieinhalb Jahrhunderten besuchen … oder wollte ich?
Es war eine sonderbare Mischung aus Wiedersehensfreude und Beunruhigung, die mich in diesem Augenblick erfasste. Es war nicht dieser bezaubernde, für die Touristen restaurierte Tower, den ich vor mir sah; das Gebäude sah eher heruntergekommen und düster aus, aber er war es unverkennbar. Ein Halt – und eine schwindelnde Fallgrube, denn gerade durch ihre Bekanntheit ließ die Burg mich bis ins Mark begreifen, womit ich eigentlich konfrontiert war.
Ich hatte London erreicht. Freitag, den 11. Oktober 1647.