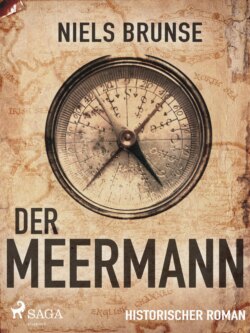Читать книгу Der Meermann - Niels Brunse - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеNach einer Nacht, in der ich abwechselnd tief schlief und aus innerer Unruhe oder vor Kälte aufwachte, wurde ich am nächsten Morgen geweckt, als mich jemand sanft an der Schulter rüttelte. Ich schlug die Augen auf und sah, wie Will sich über mich beugte. Reflexartig schaute ich auf mein linkes Handgelenk, nachdem ich mich aufgerichtet hatte, aber meine Uhr war ja nicht mehr da, sie war zusammen mit meinen übrigen Habseligkeiten verschwunden.
»Da wartet ein Mann auf dich«, sagte Will. »Vom Pastor.«
Schlaftrunken und hungrig folgte ich ihm bis zu einem schmalen Pfad, auf dem tatsächlich ein breitschultriger Mann in Grau stand und mit Pferd und Karren auf mich wartete. Das Pferd ließ den Kopf hängen, auf dem Karren lag eine dünne Lage Stroh, und der Mann gab mir wortlos ein Zeichen, dass ich mich daraufsetzen sollte. Ich tat es, und während Will mir nachsah und erst eine Hand zum Gruß hob, als ich mich schon so weit entfernt hatte, dass ich seine Gesichtszüge nicht mehr erkennen konnte, wurde ich langsam in Richtung des Kirchturms gefahren, den ich am Vortag entdeckt hatte. Der Karren war hart und unbequem und der Weg holprig; es knarrte und rumpelte, eigentlich wäre es bequemer gewesen, selbst zu gehen, aber aus irgendeinem Grund sollte ich wie eine Ladung Brennholz oder ein Sack Kartoffeln zu diesem Pastor gefahren werden. Er musste ein mächtiger Mann im Dorf sein, da offenbar alle widerspruchslos, seinen Anordnungen Folge leisteten.
Wir hielten vor einem Steinhaus, das zurückgezogen in einem Garten mit großen Büschen und Hunderten von blühenden Rosen stand. Der Pfarrhof, dachte ich, und ganz richtig: Als die Haustür aufging, öffnete der Knecht endlich seinen Mund und sagte: »Da kommt der Pastor. Er heißt Jonathan Strongworth. Vergiss das nicht.«
Ich beobachtete Pastor Strongworth, als er über die Steinplatten des Gartenweges schritt. Er hatte einen schwankenden, humpelnden Gang, der auf ein steifes oder möglicherweise verkrüppeltes Bein hinwies, und stützte sich auf einen Stock mit einer Stockzwinge, die bei jedem zweiten Schritt einen kleinen Knall auf den Steinen verursachte. Sein Gesicht war hager und unrasiert. Unter einer Art langen Weste mit vielen Knöpfen, die nur vom Hals bis zur Mitte des Bauches zugeknöpft waren, trug er lediglich ein Hemd.
Als er den Karren erreicht hatte, musterte er mich eine Weile prüfend. »Das also ist der Meermann«, stellte er mit einer überraschend klangvollen Stimme fest.
»Ich bin kein Meermann«, erwiderte ich in meinem besten Oxford-Englisch. »Ich bin ein menschliches Wesen wie Ihr und alle anderen. Mein Name ist John Vivilt und ich komme aus Kopenhagen in Dänemark.«
Seine einzige Reaktion bestand darin, mit der Hand ein kleines silbernes Kruzifix aus der Tasche zu ziehen und es mir entgegenzustrecken, als wäre es ein Messinstrument. Da ich mich weder in Schmerzen wand noch heulte oder Feuer spie, schien er hinsichtlich meiner menschlichen Beschaffenheit zufrieden zu sein.
»Glaubst du an unseren Herrn Jesus Christus?«, fragte er und heftete seinen bohrenden Blick auf mich. Ich hielt es für das Ratsamste, alle Diskussionen und Einschränkungen zu ignorieren und ganz einfach mit Ja zu antworten.
Er nickte. »Hast du gegessen, master John?«, erkundigte er sich dann mit einer Anrede, aus der ich nicht klug wurde. War es höflich oder herablassend gemeint? Jedenfalls hatte ich nichts gefrühstückt, und außerdem spürte ich einigermaßen dringend, dass ich seit dem Vortag nicht auf der Toilette gewesen war. Ich bedankte mich für die Einladung zum Frühstück, erklärte aber auch auf eine etwas verklausulierte Weise, dass ich zuvor noch etwas anderes zu erledigen hätte.
»Ah, die Natur ruft«, sagte er. »Benutz den Stall.« Er deutete auf die halb geöffnete Tür eines Fachwerkgebäudes hinter dem Pfarrhaus.
Ich ging hinein. Der Stall verfügte über einige Viehboxen, aber nur das Pferd, das den Karren gezogen hatte, stand dort und wurde vom Knecht des Pfarrhofes gestriegelt. Der Bursche sah meinen suchenden Blick und zeigte stumm auf die Rinne vor den Boxen – Mistgang wird sie wohl genannt. Er entfernte sich nicht, sondern drehte mir lediglich den Rücken zu, während ich mir die Fischerhose herunterzog und mich in die Hocke setzte. Es sah aus, als wäre ich nicht der einzige Mensch, der erst kürzlich hier gehockt hatte. Hinterher wischte ich mich mit einem Büschel Stroh ab. »Wo kann ich mir die Hände waschen?«, fragte ich den Knecht, der mich verwundert ansah, so dass ich die Frage wiederholte. »In der Küche, würde ich meinen«, erwiderte er und machte eine unbestimmte Handbewegung in Richtung des Steinhauses.
In der Küche traf ich auf eine Dienstmagd, die bei meinem Anblick die Augen aufsperrte und die Hand vor den Mund hielt. Dennoch half sie mir mit einer Schüssel und einer Kanne Wasser und reichte mir ein dünnes Leinenhandtuch, als ich meine tropfenden Hände aus der Schüssel nahm. Sie musste von mir gehört haben, denn hinterher führte sie mich – mit vorsichtigem Abstand – in eine Stube, in der der Pastor und seine Frau an einem alten Eichenholztisch saßen.
An den Tisch kann ich mich sehr genau erinnern. Viele Stunden sollte ich daran sitzen, in Gesellschaft von Pastor Strongworth und seiner mageren Ehefrau Deborah, zusammen mit neugierigen Gästen des Pastors oder ganz allein mit meinen Kopierarbeiten. Es war ein schwerer, solider Tisch mit einer dicken, vom Alter gedunkelten Platte, die sich ein wenig gebogen hatte, so dass der Tisch nicht ganz eben war; er konnte gut mehrere hundert Jahre alt sein, der Stil war schwer zu bestimmen. Der Tisch wurde eine Art Ankerpunkt in meiner Zeit auf dem Pfarrhof, ein Ort, an dem ich mit einer fremden Welt konfrontiert wurde, einer fremden Gedankenwelt in all ihren unterschiedlichen Aspekten. Gleichzeitig aber auch der Ort, an dem ich etwas erhielt, um mich für das Tagwerk zu stärken, denn bereits nach dem ersten Tag wurde es zu einer festen Regel, dass ich mit am Tisch saß statt mit dem Knecht und der Magd in der Küche zu essen. Dies geschah nur, wenn der Pastor unterwegs war und Frau Deborah ihre Mahlzeiten sittsam allein einnahm.
Nach dem Tischgebet und den ersten Bissen der Mahlzeit – Grütze, Brot, Käse, gesalzene Heringe und dünnes selbstgebrautes Bier, kein Tee, wie ich anachronistisch erwartet hatte – begann der Pastor, mich auszufragen. Vor allem die Mitteilung, dass ich so gut Englisch sprach, weil ich es auf der Universität studiert hatte, interessierte ihn. Wieso unterrichtete man die Sprache eines fremden Landes auf der Universität von Kopenhagen und nicht nur Latein, Griechisch und Hebräisch? Meine Antworten wurden zunehmend unbestimmter und schließlich nahm ich meinen Mut zusammen und konfrontierte ihn mit meiner Vermutung: »Ich glaube – selbst wenn es Euch unverständlich erscheinen mag –, dass ich in der Zeit zurückgereist bin, mehr als dreihundertundfünfzig Jahre. Ich habe Dänemark im Jahr 2005 verlassen und nun schreiben wir 1647, soweit ich es verstanden habe …«
Er sah mich eine ganze Minute an, als wollte er den Gedanken begreifen oder meine mentale Gesundheit beurteilen. Dann sagte er: »Master John, man kann nicht durch die Zeit reisen. Gott hat bei der Erschaffung der Welt die Zeit eingerichtet, damit wir unsere Zeit leben und hinterher in das ewige Leben eingehen können, wenn wir es verdient haben. Die Zeit ist eine Eigenschaft, kein Land, in das man reisen und wieder zurückkommen kann. Möglicherweise wärest du beinahe ertrunken, als dein Boot unterging – und Menschen, die dem Tode nahe gewesen sind, können unter den merkwürdigsten Wahnvorstellungen leiden. Aber hab keine Angst, das gibt sich bald wieder.«
Nach diesen besänftigenden Worten aß er weiter. Und jedes Mal, wenn ich ihn in den Monaten danach mit einer sonderbaren Information über die Welt, die dereinst kommen würde, überraschte, beruhigte er mich wieder mit der gleichen felsenfesten Überzeugung, dass ich im Irrtum sei und er recht habe. Ich konnte ihn nicht einen Zoll davon abbringen.
Ebenso unwiderruflich war sein Beschluss, mich in sein Haus aufzunehmen. Die armen Fischer vom Strand könnten mich weder unterbringen noch ernähren, erklärte er, daher würde er mir ein Dach über dem Kopf, Kost und Kleidung anbieten – unter der Bedingung, dass ich bei ihm bliebe und für ihn arbeitete, wenn es etwas zu erledigen gab.
Ich sah die Fischer vor mir – ihre zerschlissene Kleidung, ihre engen Hütten – und mir wurde klar, dass er recht hatte. Ich akzeptierte. Damit hatte ich eine Art Job und Pastor Strongworth hatte seinen Haustand um ein Kuriosum erweitert.
Allerdings hätte ich wissen müssen, dass es tatsächlich immer etwas zu tun gab. Wenn ich nicht Brennholz für die Feuerstelle in der Küche zu hacken hatte, musste ich der Dienstmagd helfen, die zwei Kühe des Pastors zu melken und zu tränken – sie molk und ich trug die Eimer hin und her –, bevor das Vieh im Sommer auf die Weide kam. Und wenn im Stall nicht nach den Tieren (und Menschen) ausgemistet werden musste, war ein Zaun oder ein Gatter zu reparieren. Hatte ich nicht der Pastorengattin behilflich zu sein, wenn sie mit einer groben Schere im Garten umherging und ihre Rosen pflegte, so gab es zumindest ein Beet, das umzugraben oder zu jäten war.
Oft war ich vollkommen erschöpft, wenn ich mich auf mein Strohlager in der hintersten Box des Stalls legte. Der Knecht und das Mädchen hatten kleine Kammern im steinernen Hauptgebäude und zunächst fühlte ich mich gedemütigt, wie ein Tier in den Stall verwiesen zu sein – aber es hatte seine Vorteile. Ich war allein, die Menschen ließen mich in Ruhe, und das Pferd schnaubte leise und stampfte mit den Hufen auf den Boden, was sehr beruhigend klang. Sogar an das Rascheln der Mäuse im Stroh gewöhnte ich mich.
Darüber hinaus gehörte es zu meinen Pflichten, mich als Sehenswürdigkeit bereitzuhalten, wenn der Pastor Gäste empfing. Meist handelte es sich um Kollegen aus den Nachbargemeinden oder Adlige, die den Feudalherrn des Dorfes besuchten. An einem der ersten Tage, nachdem ich in den Stall des Pfarrhofes gezogen war, erschien der Gutsherr persönlich. Es war das einzige Mal, dass ich Pastor Strongworth unterwürfig erlebte. Es hieß »Mylord« hier und »Mylord« da, und der Baron wandte sich mit seinem feisten, rotfleckigen Gesicht jedes Mal an den Pastor, wenn er mich etwas fragen wollte, worauf der Pastor die Frage für mich zu wiederholen hatte, als wäre es unter Mylords Würde, mit einem Geschöpf meiner Art direkt zu sprechen.
Die Besucher stellten mir die sonderbarsten Fragen und völlig schwachsinnige Aufgaben – so sollte ich zwei und zwei zusammenzählen, die Frage beantworten, wie der erste Mensch hieß, oder spitzfindige naturwissenschaftliche Probleme lösen: Woher kommt das Wasser im Meer oder was lässt den Wind wehen. Einige wollten mehr über das Land hören, aus dem ich stammte, andere wollten meine Arme oder meine Zähne prüfen. Ich wurde entweder behandelt wie ein an Land gespülter Idiot, dessen Intelligenz man als zweifelhaft anzusehen hatte, oder als eine Art Fabelwesen, das ein übernatürliches Wissen besaß. Sehr bald schon war es nicht mehr lustig – jedenfalls nicht für mich.
Es gab eine Ausnahme. Eines Tages, kaum ein paar Wochen nach meiner Ankunft, wurde ich vom Feld geholt, weil wieder einmal ein Gast eingetroffen war. An diese Begegnung erinnere ich mich noch sehr gut, denn mit diesem Gast sollte ich später mehr zu tun bekommen. Es handelte sich um einen großen kräftigen Mann mit einer starken, dominanten Ausstrahlung – Hugh Peters, ein Feldgeistlicher im Heer des Parlaments. Strongworth saß neben ihm und schien auf der Hut zu sein. Peters nahm mich ernster und war offensichtlich besser informiert als die meisten, er unterzog mich geradezu einem Verhör über Dänemark und die dänischen Verhältnisse. In jenen Wochen hatte ich mir das Gehirn zermartert, um mich an alles über Christian IV. und die Zeit danach zu erinnern; viel war mir nicht eingefallen, aber von Hugh Peters fühlte ich mich provoziert und so berichtete ich das meiste. Um einen Trumpf zu landen, erzählte ich ihm, dass König Christian nächstes Jahr sterben und sein Sohn Frederik III. ihm auf dem Thron folgen werde, außerdem würde Dänemark bald einen Krieg mit Schweden beginnen und seine dominierende Position im Norden verlieren. Und wenn Peters von einem Mann namens Corfitz Ulfeldt gehört hätte, dann sollte er wissen, dass dieser Mann sich als ein Verräter erweisen würde.
»Ulfeldt? The Lord Senechal?«, fragte Peters und hob die Augenbrauen. Ich konnte mich nicht mehr an Ulfeldts Titel erinnern, aber der Name war offenbar bekannt und die Information hinterließ Eindruck. Ich bestätigte es.
Peters blickte mich durchdringend an und wollte mich weiter befragen, als Pastor Strongworth sich einschaltete und erklärte, dass Master John an gewissen Wahnvorstellungen leide und sich einbilde, die Zukunft zu kennen, aber mit Gottes Hilfe würde er Master John schon wieder auf den rechten Weg bringen. Die angespannte Atmosphäre zwischen den beiden Geistlichen, die ich bereits bemerkt hatte, als ich eintrat, verschärfte sich, und nach einem weiteren Versuch und einer weiteren Einmischung von Strongworth brach Peters das Gespräch ab und verabschiedete sich kühl.
Als er fortgeritten war, packte Pastor Strongworth mich hart am Arm und fuhr mich an: »Du sollst nicht prophezeien, Master John, das kann dich das Leben kosten. Auf dem Scheiterhaufen.« Dann schickte er mich wieder hinaus aufs Feld.
Er hat ja recht, dachte ich unterwegs erschüttert. Im siebzehnten Jahrhundert wurden Hexen und Hellseher noch verbrannt.
Strongworth ehrte den Sonntag und heiligte ihn. Wenn wir am Sonntag den Besuch des Gottesdiensts hinter uns hatten, verlangte er nichts mehr von mir. Am ersten Sonntag war ich überrascht, als ich ihn und seinen Hausstand in die graue Kirche begleitete, deren mächtiger viereckiger Turm in der flachen Landschaft so weit zu sehen war. Der Innenraum der Kirche erschien mir nicht sonderlich groß, aber sie war bis zum letzten Platz gefüllt; ich hatte den Eindruck, als wäre die gesamte Gemeinde erschienen, in den Reihen erkannte ich auch meine Fischerfreunde. Nach dem Gottesdienst bemerkte ich Strongworth gegenüber, dass er ein bekannter Geistlicher sein müsse, wenn so viele Gläubige seine Kirche aufsuchten. Er erwiderte trocken, dass sie kämen, um Gottes Wort zu hören, nicht seines, und im Übrigen wäre es gesetzlich verboten, dem sonntäglichen Gottesdienst fernzubleiben.
Dass er der Worte mächtig war, erfuhr ich dennoch Sonntag für Sonntag. Wenn er auf die Kanzel humpelte und zu predigen begann, bekam seine ohnehin schon klangvolle Stimme ein noch größeres Volumen, er schmetterte die Konsonanten und ließ die tiefen Vokale in Worten wie »alMIGHty GOD«, »CHRIST the LORD«, »deVOURing FIRE« und »eternally DAMNed« zwischen den Steinwänden dröhnen. Es gab nicht eine Bibelstelle, die er nicht so interpretierte, dass sie von der Sünde aller irdischen Pracht und Herrlichkeit handelte; von der Strafe, die auf die Eitlen und diejenigen wartete, die Gottes Allgewalt über die eigene unbedeutende Macht hier auf Erden nicht anerkannten; und von der Belohnung der Seligen für ihre Demut und mäßige Lebensweise. Die Kirche war spartanisch und frei von jeglichem Bilderschmuck und die Lieder erklangen einstimmig und eintönig. Es gab nicht einmal eine Orgel.
Pastor Strongworth war Puritaner, zweifellos. Ich versuchte mich zu entsinnen, was ich in dem Semester, als ich den Kurs über Milton besuchte, über den Puritanismus gelesen hatte. Leider erinnerte ich mich am besten an einige von Miltons Versen; doch mir dämmerte, dass wir uns mitten im englischen Bürgerkrieg befinden mussten, in dem die Puritaner und das Parlament gegen den König und die Royalisten kämpften. Der König – Karl I.? – wurde hingerichtet und Cromwell übernahm die Macht als Lordprotektor, bis Karl II. sechzehnhundert und wasweißdennich zurückkehrte … Hätte ich den ganzen Stoff doch bloß besser gepaukt!
Wieder wurde mir das Absurde meiner Situation klar, während ich mich in der Dorfkirche zurechtzufinden versuchte, gestrandet in Zeit und Raum. Es gab keine andere sinnvolle Erklärung, und doch war es sinnlos und meine Einsamkeit fürchterlich. Die Männer auf den Bänken neben mir – denn die Gemeinde saß sittsam getrennt nach Männern und Frauen auf je einer Seite des Mittelganges – schauten mich verstohlen an und glaubten wahrscheinlich, mich hätten die Worten des Pastors ergriffen. Aber wenn ich die Augen zusammenkniff und nicht zu weinen versuchte, dachte ich nur an mich selbst.
Nach dem Gottesdienst aßen wir am ersten Sonntag im Pfarrhaus, und hinterher erklärte der Pastor mir, ich könne mich ausruhen oder spazieren gehen. Allerdings sollte ich am Abend wieder zurück sein, doch ein Gebet unter freiem Himmel wäre Gott ebenso genehm wie ein Gebet in der Kirche. Ich ging, aber ich betete nicht. Meine erste Wanderung führte mich zum Strand, um dem Fischer John die geliehenen Kleider zurückzugeben. Ich hatte vom Pastor zwei Hemden, ein Paar Hosen, vier Paar Strümpfe, ein Paar Schuhe und eine Art lange Jacke bekommen, alles abgenutzt, aber heil und sauber. Außerdem hatte er mir eine kleine alte Kiste gegeben, um die Kleider in meiner Box im Stall zu verwahren. Das war großzügiger, als mir zu diesem Zeitpunkt bewusst war, denn obwohl es sich um die ältesten Kleidungsstücke des Pastors handelte, hatte er seine Garderobe dadurch im Grunde halbiert. Alles war ein wenig zu klein und die Schuhe drückten – auf dem Weg zum Strand zog ich deshalb Schuhe und Strümpfe aus –, aber es war eindeutig eine Verbesserung.
Die Fischer freuten sich über unser Wiedersehen, fast hatte ich das Gefühl, nach Hause zu kommen, als ich ihre zusammengezimmerten Hütten sah. In den folgenden Monaten besuchte ich sie häufig und plauderte mit John und Meg über dieses und jenes oder erzählte dem kleinen Harry Geschichten – von den griechischen Göttern, von Hamlet und König Lear und von einer Zeit, in der die Menschen an Bord großer Schiffe gehen und bis zum Mond und den Sternen fliegen würden. Er hörte mit offenem Mund zu und auch die Erwachsenen lauschten mit gespitzten Ohren, während sie so taten, als wären sie damit beschäftigt zu nähen oder die Netze zu reinigen. Sie waren der Ansicht, dass der Ruhetag ausreichend eingehalten wäre, wenn sie nicht hinausfuhren.
Wenn es irgendwo einen Ort unter Menschen gab, an dem ich mich in diesen Monaten geborgen fühlte – ja, in all den zehn Jahren, die ich nun in meiner Zeitverschiebung zugebracht habe –, dann bei den Fischern in diesem namenlosen Weiler bei Winterton.
Die einzige Tätigkeit, die auch meinen Gedanken etwas Nahrung lieferte, waren die Kopierarbeiten, mit denen Pastor Strongworth mich beschäftigte. Irgendwann hatte er gefragt, ob ich lesen und schreiben könnte, und als ich es bejahte, hatte er mir einen Federkiel in die Hand gedrückt und mich gebeten, einen Satz zu kopieren, den er auf ein Stück Papier geschrieben hatte. Dies gelang mir problemlos, denn glücklicherweise verwendete er wie alle Engländer die leicht zu entziffernden lateinischen Buchstaben und nicht diese undurchschaubare Frakturschrift, die ich nur von den Furcht einflößenden Karteikästen der Älteren Sammlung in der Königlichen Bibliothek von Kopenhagen kannte. Ich hatte sie nie lernen müssen.
Pastor Strongworth lachte, als er bemerkte, welche Mühe ich mit etwas so Simplen wie dem Zuschneiden und Anspitzen eines Federkiels hatte, aber er half mir mit dem Federmesser. Und ich lernte auch rasch, die Feder rechtzeitig in die Tinte zu tunken und klare und deutliche Buchstaben zu schreiben. Er ließ mich bestimmte Abschnitte aus geliehenen Büchern abschreiben; nahezu alle waren in Latein verfasst und soweit ich es übersehen konnte, ging es darin um theologische Fragen. Ich verstand nicht viel von dem, was ich kopierte, und schon gar nichts von den griechischen Zitaten, die bisweilen in den Texten standen, aber ich malte die griechischen Buchstaben so sorgfältig ab, wie ich konnte, und alles war zu seiner Zufriedenheit.
Manchmal schrieb ich an dem alten Eichenholztisch bis weit in den Abend hinein – mithilfe einer Talgkerze, die mir die Magd brachte, bevor sie zu Bett ging. Ich hatte mit dem Papier sparsam umzugehen – der Pastor zählte die Bögen, die er mir überließ – und eng, aber leserlich zu schreiben. Diese penible Aufgabe und die verschwommene Ahnung über den Inhalt der Texte, die ich mir mithilfe meiner bescheidenen Lateinkenntnisse und des üblichen Vorrats an Fremdworten verschaffte, genoss ich in einer Weise, gegen die physische Arbeit keinerlei Chance hatte.
Eines Abends saß ich daher sehr lange mit Feder und Tinte am Tisch. Als ich endlich fertig war, ordnete ich die Bögen, pustete die Kerze aus und wollte gehen – doch draußen im Korridor bemerkte ich, dass die Tür zum Studierzimmer des Pastors nur angelehnt war und ein schwacher Lichtschein aus dem Zimmer fiel. Ich dachte, ich könnte ihm die fertige Abschrift ebenso gut gleich geben, holte die Papiere und ging auf den hellen Türspalt zu.
Noch bevor ich klopfte, konnte ich in das Studierzimmer blicken. Was ich sah, ließ mich innehalten. Der Pastor und seine Frau knieten zu beiden Seiten eines Stuhles und der Schein eines Kerzenleuchters an der Wand erhellte ihre Gesichter. Ich vermutete, dass er sein versehrtes Bein unbeholfen zur Seite ausgestreckt hatte; sie stützte wie er die Ellenbogen auf den Stuhl. Beide hielten die Augen geschlossen und sein sonst so strenger Gesichtsausdruck war in sich gekehrt und wehrlos. Und ihre Miene, normalerweise scharf wie eine Axt, war nun sanft und heiter.
Sie bewegten nur stumm ihre Lippen, vielleicht sprachen sie aber auch so leise, dass ich nichts hören konnte, obwohl ich nur wenige Meter entfernt stand. Sie beteten. Von Zeit zu Zeit schlugen sie die Augen auf und sahen sich mit einer ganz leisen Andeutung eines Lächelns an – und dann begann einer von ihnen mit einem neuen Gebet und wieder schlossen sie die Augen und bewegten die Lippen synchron. Entweder kannten sie die Worte auswendig oder diese beiden Menschen waren so eng miteinander verbunden, dass das leiseste Flüstern für ihren Einklang genügte.
Ich konnte mich nicht losreißen, lange blieb ich stehen und schaute sie an, obwohl ich das Schamlose und Verletzende durchaus spürte – als hätte ich sie beim Beischlaf überrascht. Der Anblick erfüllte mich mit einer merkwürdigen Sehnsucht und schließlich nahm ich mich zusammen, ging zurück in das dunkle Esszimmer, legte Buch und Papier auf den Tisch und schlich mich hinaus in meinen Stall.
Ich hatte sie tief versunken gesehen, in einer fremden Welt, an der ich nie Anteil haben würde, und vielleicht war es dieses Erlebnis, das mich ernsthaft den Entschluss fassen ließ, den Pfarrhof zu verlassen.