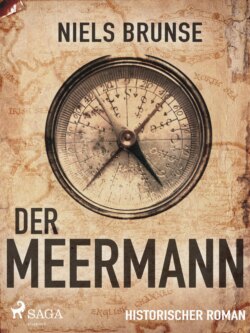Читать книгу Der Meermann - Niels Brunse - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеMeinen ersten Versuch, dem Pfarrhof zu entkommen, unternahm ich irgendwann im August. Ich erwachte sehr früh am Morgen. Kein menschliches Geräusch war zu hören, alles schlief noch, und der Himmel war gerade so hell, dass man sehen konnte, wohin man trat. Ich beschloss sehr schnell, dass jetzt der Moment gekommen sei.
Die Idee, Winterton heimlich zu verlassen, hatte mich mehrere Wochen beschäftigt. Ich war es leid, das Gefühl haben zu müssen, ausgenützt und ausgestellt zu werden, und ich war mir so gut wie sicher, dass der Pastor sich widersetzen würde, wenn ich ihm mitteilte, dass ich fort wolle. Ich war der Ansicht, dass ich hinreichend für ihn gearbeitet hatte und ihm nichts schuldete. Ich schlich in die Küche, nahm mir ein Brot, etwas kaltes Fleisch und eines von den Tüchern, die über die Milchkannen gelegt wurden. Das Essen wickelte ich in das Tuch und verknotete es zu einem Bündel. Ich besaß nichts, nicht einmal eine Tasche, um meine Sachen zu tragen, und die kleine Kiste für die Kleider war zu schwer. Der Pastor durfte die Kleider zum Wechseln gern behalten, ich hatte beschlossen, so wenig wie möglich mitzunehmen.
Dann brach ich auf.
Ich hatte nicht einmal eine klare Vorstellung davon, wohin ich wollte. London hatte ich mir gedacht, denn in einer großen Stadt gibt es mehr Möglichkeiten als auf dem Land, aber ich war mir nicht ganz sicher, welchen Weg ich einzuschlagen hatte. Also wählte ich die Richtung, die so aussah, als führte sie nach Süden, das Meer lag linker Hand. Ich hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde. Allerdings war mir bewusst, dass mein Vorhaben nicht ungefährlich war. Schließlich besaß ich nichts und musste mich darauf verlassen, dass sich unterwegs genügend Gelegenheiten böten, um mit anzufassen und dafür etwas zu essen und ein Obdach für die Nacht zu bekommen.
Im Laufe des Tages wurde es schwül, doch die Wolken, die sich zu einem Gewitter auftürmten, das niemals zu kommen schien, schirmten die Sonne ab, so dass ich nicht so schnell durstig wurde. Die Landschaft war flach und wechselte zwischen sumpfigen Marsch- und Moorgebieten und für Ackerbau geeigneteren Gegenden. Hin und wieder begegnete ich einem Reiter oder einem Wagen; die Leute sahen mich an, sagten aber nichts. Der Weg führte von Dorf zu Dorf und all diese Dörfer wirkten tot und verlassen, allerdings war Erntezeit und wahrscheinlich halfen die Einwohner draußen mit. Einige Male sah ich denn auch ein Stück entfernt Menschen auf den Feldern.
Im Schatten einer kleinen Steinbrücke, die über einen Wasserlauf führte, aß ich etwas von dem Fleisch und dem Brot. Weil es nichts anderes gab, trank ich von dem Wasser, durchaus mit einer gewissen Sorge, aber es schmeckte frisch und gut. Dann ging ich weiter.
Von Weitem sah ich drei Reiter auf mich zu galoppieren. Hinter ihnen wirbelte der Staub zu Wolken auf, als würden ihre Pferde Feuer speien und die Straße in Brand setzen. Ich trat an den Straßenrand, drehte den Kopf zur Seite und hielt die Hand vor Mund und Nase, als sie vorüberritten – dann hörte ich plötzlich, wie einer von ihnen mit einem Ausruf sein Pferd zum Stehen brachte und wendete, die beiden anderen taten es ihm nach. Als der Staub sich gelegt hatte, blickte ich in ein Gesicht, das ich schon einmal gesehen hatte. Es war der rotfleckige Baron, der mich im Pfarrhof in Augenschein genommen hatte.
»Was haben wir denn hier?«, rief er. »Unser guter Meermann – auf Abwegen, he?«
»Guten Morgen, Mylord«, erwiderte ich ausgesucht höflich. »Ist dies die Straße nach London?«
»Das schon, aber dort hast du nichts zu suchen«, erklärte der Baron und befahl einem seiner Diener – dass sie Diener waren, sah ich an ihrer groben Kleidung, die sich von den Goldknöpfen des Herrn und seinen fein gearbeiteten Reitstiefeln deutlich unterschied –, mich auf sein Pferd zu setzen und dorthin zu bringen, wo ich hingehörte.
Ich protestierte, aber der Baron beugte sich vor und versetzte mir einen leichten Schlag mit der Reitpeitsche. Der Diener grinste. »Hoch mit dir!«, befahl der pausbäckige Adlige.
Ich sah mich rasch um. Ich hatte keine Chance. Ich konnte ihnen nicht entkommen, weder auf der Straße noch in dem übrigen Gelände, das aussah, als gäbe es dort festen Grund. Ich schäumte vor Wut, dass der Baron mich behandelte wie Pastor Strongworths rechtmäßiges Eigentum, wie ein entlaufenes Schaf; aber ich hatte keinen Zweifel, dass die Reitpeitsche mich beim nächsten Mal härter treffen würde, wenn ich weiterhin protestierte. Irgendwie gelang es mir, das linke Bein über den Pferderücken zu bringen. Der Diener griff hinter sich und half mit einem unsanften Ruck an meinem Hemd nach, im selben Augenblick gab er seinem Pferd die Sporen und setzte seinen Galopp auf dem staubigen Weg fort.
Ich konnte nicht reiten – ich lernte es erst später – und klammerte mich mit beiden Armen an den Leib des Dieners, um nicht herunterzufallen. Ich verlor meinen Schnappsack, während die Knochen des Pferdes und mein Steißbein zusammenprallten und ich mir die Schenkel an dem steifen, hohen Sattel aufschürfte. Wo Mylord und sein anderer Domestik blieben, weiß ich nicht – aber schließlich wurde ich am Pfarrhof abgesetzt, mürbe und wund, der Diener packte meinen Arm und führte mich ins Haus. Der Pastor kam aus seinem Studierzimmer und der Bursche meldete kurz: »Wir fanden ihn auf der Straße«, grüßte und ging.
»Master John«, sagte Strongworth, als wir im Studierzimmer allein waren, »du bist hier im Haus kein Gefangener und ich kann dir nicht verbieten zu gehen. Doch ich möchte dir sehr zuraten zu bleiben. Es sind schlechte Zeiten, es wird schwer für dich werden, eine Möglichkeit zu finden, dich selbst zu ernähren. Hier hast du zumindest Nahrung und Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Das Land ist in Aufruhr, der Krieg kann schon bald wieder aufflammen, und wenn du nicht zwangsausgehoben oder von einem Söldner, dem du im Wege stehst, getötet werden willst, dann bleib. Versteck dich hier und der Herr wird seine Hand über dich halten.«
Es hörte sich an, als würde mir die Gnade des Herrn nur dann zuteil, wenn ich auf dem Pfarrhof blieb statt mich in der Welt herumzutreiben. Ich antwortete nur kurz angebunden, als er fortfuhr, auf mich einzureden. Schließlich schickte er mich hinaus, jedoch ohne irgendein Zeichen von Zorn. Ich hatte den Eindruck, dass er mich gern behalten hätte, da ich unterhaltsam und obendrein ein billiger Sekretär war; allerdings konnte ich seinen Gesichtsausdruck nicht recht deuten.
Einige Tage später fragte ich ihn ganz direkt, ob er mir einen Empfehlungsbrief für irgendjemanden in London geben könne, dann würde ich selbst sehen, wie ich dorthin käme. Er lehnte es umgehend ab. Ich fragte warum, doch er erwiderte nur, so wäre es am besten.
Zumindest wusste ich nun, woran ich bei ihm war.
Lediglich den Fischern vom Strand konnte ich mich anvertrauen. Mittlerweile hatte ich das Gefühl, dass sie die Einzigen waren, die mich als einen Menschen und sogar als einen Freund ansahen. Ihre erste Furcht und Skepsis war völlig verschwunden, zumal mir die Haare auf meinem Kopf und am Körper wieder wuchsen. Obwohl es noch lange dauern sollte, bis ich die Langhaarfrisur vorweisen konnte, die die meisten Männer hier trugen, sah ich jedenfalls wieder mehr nach einem Mann als nach einem kahlen Fabelwesen aus. Fischer John half mir sogar jeden Sonntag bei der Rasur, denn ich besaß weder ein Rasiermesser noch hatte ich Geld, um den Schmied des Dorfes zu bezahlen, der neben seinem eigentlichen Beruf den Leuten auch Zähne zog und den Bart schabte.
Während einem meiner sonntäglichen Besuche bekannte ich, wie sehr ich es leid war, vorgezeigt zu werden, und erzählte von meiner Sehnsucht, etwas anderes zu sehen als das begrenzte Leben von Winterton. Sie hörten zu, und während John mir mit seinem sorgfältig geschliffenen Messer Wangen und Kinn rasierte und ich gezwungenermaßen still sitzen musste und den Mund zu halten hatte, hielt er einen kleinen Monolog.
»Doch, ich verstehe dich, mein Freund John. Als ich jünger war, verspürte ich auch diese Sehnsucht, ja, das tat ich. Ich wollte die Welt sehen, ich wollte Seemann werden und in ferne Länder reisen. Aber mein Vater war Fischer wie sein Vater vor ihm, und das Fischen hatte ich gelernt, Seemänner gab es genug. Und so übernahm ich sein Boot, dies da, das dort drüben steht …«, er wies mit dem Messer auf die Hütte, die aus halben Schiffsrümpfen gezimmert war, »… später bekam dann ich mein eigenes Boot, zusammen mit Jock, das war teuer genug, aber das alte leckte und so sehr wir es auch abdichteten, es half nichts. Aber gesehnt habe ich mich, damals, als ich jung war. Doch dann heiratete ich Meg, und mein Platz war hier, nun ja, wir beklagen uns nicht. Aber du bist ganz allein und das ist auch nicht gut für einen Mann; ich verstehe dich, mein Freund John. Ich wünschte, wir könnten dir helfen.«
»Wenn ich nur ein Boot hätte«, sagte ich, als John nach der Rasur das Messer zusammenklappte. »Ich kann nicht reiten und auf der Landstraße kann mich jedermann anhalten. Aber ich kann segeln. In einem Boot würde ich schon nach London kommen.«
»Ein Boot zu finden ist nicht so leicht«, warf Will ein, der auf einer Tonne saß und dem Gespräch zugehört hatte.
»Nein, das ist nicht leicht«, bestätigte Meg.
»Und ich habe kein Geld, ich kann nicht einmal bezahlen, um mir eines zu leihen«, sagte ich. »Also was soll’s.«
Wir versanken in grübelndes Schweigen.
»Erzähl mir eine Geschichte«, bettelte Harry.
Eines Abends, als wir nach dem Essen allein waren, bat ich Pastor Strongworth mir zu erklären, warum es im Land Unruhen gab und Kriegsgefahr bestand. Er ging bereitwillig darauf ein, doch mit einer derartigen Unmenge an Details, dass ich rasch den Überblick verlor und einfach nur versuchte, so viel wie möglich zu begreifen. Ich verstand, dass die Anhänger des Königs in der Defensive waren und der König selbst sich in einer Art Gefangenschaft des Parlamentsheeres befand. Außerdem hatten die Puritaner die Macht im Parlament, aber sie waren untereinander zerstritten. Und vor allem gab es ein theologisches Schisma zwischen Presbyterianern und Unabhängigen, das den Pastor sehr beschäftigte – obwohl beide Parteien die hochkirchlichen Laudianer hassten, die nach Laud benannt waren, dem erst kürzlich hingerichteten Erzbischof von Canterbury. Es folgte eine Unzahl weiterer Namen und Bezeichnungen von Gruppierungen, und allmählich begriff ich, dass das politische Leben in England zu der Zeit, in die ich geraten war, mindestens ebenso verworren erschien wie in einer modernen Demokratie. Sogar absolutistische Monarchen und mächtige Feldherren mussten vorsichtig agieren. Mir fiel auf, dass Strongworth mit keinem Wort den Namen Cromwell erwähnte, sondern von Fairfax als oberstem General des Parlamentsheeres sprach. Möglicherweise habe ich mich früher einmal besser erinnert, aber so weit habe ich seine Erklärungen noch im Gedächtnis behalten. Schließlich fragte ich ihn, welcher Fraktion der Kirche er angehöre.
»Das ist eine schwierige Frage«, antwortete er zögernd. »Die Presbyterianer sind Recht und Gesetz am nächsten, aber die Unabhängigen stehen möglicherweise Gottes Wille näher.« Er seufzte und als würde er plötzlich das Bedürfnis verspüren, sich jemandem anzuvertrauen, fügte er hinzu: »Mein Freund Hugh Peters suchte in ebendieser Sache meinen Rat, ebenso wie viele andere.«
Es wurde mir klar, dass die umfangreiche Korrespondenz des Pastors mit seinen Amtskollegen und das intensive Ausleihen von Büchern, aus denen ich zu kopieren hatte, nicht nur der Zeitvertreib eines Dorfgeistlichen war. Strongworth war offenbar eine Art Koryphäe, die in den heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Puritaner für Argumente sorgte. Damals verstand ich noch nicht, dass um nichts Geringeres als die Vollendung der englischen Reformation und damit um enorme soziale Konsequenzen gekämpft wurde. Auch war mir nicht ganz klar, obwohl ich gerade von Erzbischof Laud gehört hatte, dass dieser Streit um theologische Prinzipien für die Teilnehmer durchaus auf Leben oder Tod hinauslaufen konnte.
»Was hilft’s?«, erklärte ich nonchalant. »In einigen Jahren sitzt Karl II. als König auf dem Thron.«
»Halt den Mund!«, brüllte Strongworth und schlug auf den Eichenholztisch, dass die Zinnteller hüpften. »Wenn ich dich noch einmal prophezeien höre, werde ich dich verprügeln!«
Ich stand wortlos auf und ging. Er rief mich nicht zurück, es war das einzige Mal, dass er mir drohte.
Hätte ich an Zeichen des Himmels geglaubt, wäre ich wohl zu der Überzeugung gelang, dass es sich bei den beiden Vorfällen, die sich Ende September dicht nacheinander ereigneten, genau darum gehandelt haben musste. Eines Tages auf dem Rückweg von der Weide, auf die ich die Kühe getrieben hatte – ich hatte es inzwischen gelernt und brauchte die Hilfe der Magd nicht mehr –, erlaubte ich mir, ein bisschen auf der Landstraße nach Norden zu wandern, einfach so, ohne die Absicht davonzulaufen. Ich war völlig allein und sah plötzlich auf der Straße ein Bündel liegen. Es erwies sich als ein schwerer Leinenbeutel, in dem es klimperte, als ich ihn aufhob. Er enthielt einige Dutzend große glänzende Kupfernägel. Ich konnte es mir nur so erklären, dass der Beutel von einem Wagen oder einem Pferd gefallen sein musste und der Eigentümer längst weit weg war. Ich nahm den Beutel an mich und legte ihn in meine kleine Kiste im Stall. Am nächsten Sonntag brachte ich ihn den Fischern mit, zunächst um sie zu fragen, ob die Nägel etwas wert wären und ich sie verkaufen könnte, um so zum ersten Mal etwas Geld in den Händen zu haben, aber auf dem Weg zum Strand wuchs in mir die Überzeugung, dass ich ihnen die Nägel eigentlich schenken müsste, als Gegenleistung für alles, was sie für mich getan hatten.
Sie freuten sich sehr über mein Geschenk und erklärten, dass sie genau solche Nägel bräuchten, um ihre Boote zu reparieren. Ihre Freude bewies, dass die Nägel ziemlich wertvoll sein mussten, wenigstens für arme Leute, und beinahe bedauerte ich, nicht um Geld dafür gebeten zu haben. Aber ein Geschenk ist ein Geschenk und schließlich hatten sie mir das Leben gerettet, also konnte ich doch nicht einen Beutel Nägel zwischen uns kommen lassen, dachte ich beschämt.
In der Woche darauf wurde das Wetter herbstlicher und eine ganze Nacht lang heulte der Wind durch die Ritzen und schiefen Luken des Stalles. Es herrschte auflandiger Wind und ich lag wach und stellte mir vor, wie es am Strand aussehen musste: Die Dunkelheit, der aufwirbelnde Sand und die weißen Schaumzähne auf dem Meer nahe den Hütten, wo man die Boote über Nacht bestimmt besonders hoch auf den Strand gezogen hatte.
Als ich am Sonntag zusammen mit dem Pastor und seinem Hausstand in die Kirche ging, sah ich John und Jock in einer kleinen Gruppe von Menschen, die vor der Tür auf jemanden warteten. Sie warteten auf mich, und als wir uns begrüßt hatten und der Pastor mit seinem Gefolge hineingegangen war, flüsterte Jock mir zu: »Wir haben am Strand ein Boot gefunden. Möglicherweise ist es deins.«
An diesem Tag hörte ich nicht richtig zu, weder den Gebeten noch der Predigt. Die ganze Zeit kreisten meine Gedanken um das Boot, um die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass es nach mehreren Monaten wieder aufgetaucht sein sollte, um die vielversprechenden Perspektiven, die sich eröffneten, wenn es tatsächlich mein Boot sein sollte. Und nachdem ich wie gewöhnlich im Pfarrhaus gegessen hatte, konnte ich gar nicht schnell genug aufbrechen.
John und Jock begleiteten mich, wir gingen eine gute halbe Stunde am Strand in nördliche Richtung. Schon von Weitem sah ich das Boot – und wusste, dass es nicht meins war. Kein weißer Glasfieberrumpf, kein Glitzern von blankem Metall, sondern eine geteerte Holzjolle wie ihre, nur kleiner und ein wenig anders in den Linien. Das Boot lag am Strand auf der Seite und es zeigte sich, dass an einer Bordwand einige der oberen Planken zerbrochen und beschädigt waren. Das Ruder fehlte und der Mast war knapp zwei Meter über dem Mastfuß gebrochen. Vom Segel gab es keine Spur und abgesehen von ein paar ausgefransten Tauenden war auch das Rigg verschwunden.
»Das ist nicht mein Boot«, sagte ich und konnte meine Enttäuschung kaum zurückhalten.
»Jetzt ist es deins«, sagte John. »Lass es uns instand setzen, dann kannst du damit nach London segeln.«
»Aber …«, wandte ich ein.
»Wir helfen dir«, versprach John.
Zusammen schleppten wir die Jolle in ein Versteck zwischen den Dünen und Jock verwischte die Schleifspuren mit einem großen Büschel Strandhafer, das er mit bloßen Händen ausriss; ich hätte es nicht tun können, ohne mich an den scharfen Blättern zu schneiden. In den folgenden Tagen brachte ich alle möglichen Entschuldigungen vor, um den Pfarrhof möglichst früh verlassen zu können und zum Strand zu gehen, und meine Fischerfreunde transportierten inzwischen in ihrem Boot Werkzeug, einen Eimer Teer und etwas Treibholz in das Versteck.
Tag für Tag wurde der havarierte Rumpf einem seetüchtigen Boot ähnlicher. Die beschädigte Bordwand wurde mit Brettern repariert, die eigentlich nicht zu den übrigen Planken passten, das Stück einer rot gestrichenen Tür, die passender Weise noch mit einem Scharnier versehen war, ließ sich als Ruder verwenden, und ein Riemen mit zerbrochenem Ruderblatt wurde abgesägt und zum Mastbaum ernannt. John hatte ein kleines dreieckiges Segel aus dem Stück Persenning genäht, unter dem ich in der ersten Nacht geschlafen hatte. Als schwierigstes Problem erwies sich der Mast. Will, der uns in den letzten Tagen geholfen hatte, stieg auf eine der flachen Dünen und hielt Ausschau.
»Lasst uns einen Baum fällen«, schlug er vor, als er zurückkam. Er hatte weit entfernt in der einsamen Landschaft eine Stelle gefunden, an der einige junge Pappeln standen, wahrscheinlich am Rand eines Wasserlaufs.
»Frisches Holz? Du musst verrückt sein«, sagte Jock.
»Was anderes haben wir nicht«, erwiderte Will.
Sie sahen mich an und ich nickte. Es kostete uns einige Stunden, um dorthin zu gelangen, den geradesten der schlanken Bäume zu fällen, ihn zu entrinden und zuzusägen – und ihn dann durch das sumpfige Gelände zurückzutragen, praktisch von einem kleinen Erdhügel zum nächsten. Doch als es dämmerte, stand der Mast, weiß, neu und sachkundig im Kielschwein verzapft. Jock umfasste ihn mit beiden Händen und versuchte ihn zu verdrehen. Er bewegte sich nicht.
»Das Rigg wird ihn schon halten«, meinte er.
Am nächsten Tag wurde das Boot getakelt – mit Vor- und Achterstag und Wanten an jeder Seite, alles aus zusammengebundenen alten Tauresten, die nicht einmal die gleiche Stärke hatten. Das Fall für das Segel bestand aus einem dünnen Hanfgarn, das doppelt geführt wurde. Das Boot war fertig. Der Anblick hätte jeden anständigen Bootsbauer zum Weinen gebracht – doch mein Herz klopfte vor Erwartung.
»Lassen wir es zu Wasser«, schlug John vor und zu viert schleppten wir das Boot hinaus, bis es genügend Wasser unter dem Kiel hatte. Es schwamm! Die Fischer brachten das Werkzeug an Bord ihres eigenen Bootes und wollten aufbrechen – doch Jock überlegte es sich anders. »Es ist besser, ich segele mit dir«, sagte er.
Wir legten ab. Ich saß wieder an der Ruderpinne eines Schiffes! Der Wind kam aus Südwest, so dass beide Boote kreuzen mussten, und ich stellte schon bald fest, dass wir nicht gerade ein Rennboot für mich gebaut hatten. Doch mit dem kleinen Segel ließ sich leicht manövrieren und der Pappelmast krümmte sich so graziös wie der Mast einer modernen Regattajolle, so dass das Boot sich beinahe selbst trimmte. Jock bemerkte es ebenfalls und schaute sich kopfschüttelnd und lachend den Mast an. Im Übrigen achtete er auf eventuelle Lecks; an vier, fünf Stellen sickerte Wasser ins Boot, aber nicht wirklich bedrohlich. Jock holte ein Büschel gerupftes Tauwerk aus der Tasche und stopfte es mit seinem Messer locker in die Ritzen.
»Ich bringe das morgen noch in Ordnung«, sagte er.
Einige Zeit nach John und Will erreichten wir das Fischerlager. Mein kleines Boot wurde neben die anderen gezogen und ich machte mich eilig auf den Weg zurück zum Pfarrhof. Ich musste die Kleiderkiste mitnehmen, wenn ich aufbrach, ich hatte eingesehen, dass ich alles benötigen würde, was überhaupt von irgendeinem Wert war. Außerdem brauchte ich Tageslicht und einigermaßen vernünftigen Wind.
Es war bereits dunkel, als ich zurückkam, doch im Studierzimmer des Pastors brannte noch Licht. Ich schlich in den Stall und tastete mich vor, aber er musste mich kommen gehört haben, denn kurz darauf stand er mit einem Kerzenhalter in der Hand in der Stalltür.
»Master John!«, rief er.
Ich ging zu ihm, bereits halb ausgezogen, nur in meiner Hose und mit nackten Füßen.
»Ich muss morgen nach Norwich und werde erst übermorgen zurück sein«, sagte er. »Auf dem Tisch liegen drei Bücher mit Lesezeichen, außerdem habe ich Papier und Feder bereitgelegt. Schreib wie gewöhnlich die Stellen für mich ab.«
»Ja, natürlich.«
Er senkte das Licht. »Was hast du denn da auf deiner Hose? Teer?«
»Ich habe den Fischern geholfen«, erklärte ich.
Er hob die Kerze wieder, so dass er mir in die Augen sehen konnte – und ich in seine. Ich hatte das Gefühl, als würde ich eine ferne Trauer in seinem Blick aufkeimen sehen. Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch nur die ungewohnte Beleuchtung.
»God speed thee«, wünschte er.
Ein zweideutiger Ausdruck. Viel Glück – oder gute Reise. Er schien zu ahnen, was ich vorhatte.
In der Tür wandte er sich um.
»Gute Nacht, Master John.«
Ich wünschte ihm ebenfalls eine gute Nacht und er schloss die Tür. Die Dunkelheit des Stalles umfing mich.