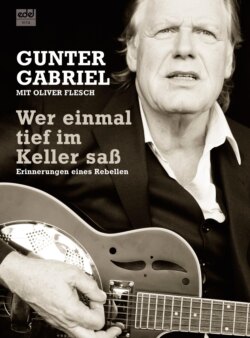Читать книгу Gunter Gabriel - Oliver Flesch - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7 Was hat der liebe Gott mit mir vor?
Оглавление»Ich glaube, der liebe Gott hat noch 'ne Menge vor mit dir!«, sagte die Krankenschwester, als sie mir die Haare aus dem verschwitzten Gesicht strich, damals, als ich zehn war und mit Wundstarrkrampf im Kreiskrankenhaus von Bünde – festgezurrt, gefesselt an Händen und Füßen – in einem vergitterten Bett lag. Mit einem Esslöffel im Mund. In einem weiß gekachelten Badezimmer, von dem ich wusste, dass alle Todgeweihten dort ihre letzte Nacht verbringen mussten, um die Zimmer freizumachen für Neuzugänge. Bitter aber wahr.
Was war passiert? Warum lag ich da in diesem Bett? Monate vorher, vielleicht sogar ein halbes Jahr vorher, war ich an einem sonnigen Nachmittag mit dem Fahrrad und einem Freund hinten auf dem Gepäckträger in meinem Heimatort Hunnebrock bei Bünde unterwegs gewesen. Die Straße war etwas abschüssig, ich kann mich noch genau erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Ein Personenwagen kam von unten die Straße hoch und einer kam von oben runter. Und sie trafen sich genau auf der Höhe, wo ich mich gerade mit meinem Fahrrad und meinem Freund hinten drauf befand. Ich sah das Unglück kommen. Ich konnte nicht nach rechts ausweichen, vielleicht auf eine Grasnabe, denn die Bordsteinkante hinderte mich daran. Mein Freund, der den Crash ebenso vorausgesehen hatte, sprang von meinem Fahrrad runter, versetzte mir damit ungewollt einen Stoß, und ich landete direkt vor dem von oben kommenden Auto. Mein rechtes Knie war hinüber, noch heute sieht man die große Narbe, die mich übrigens später vor der Bundeswehr bewahrte. Ein paar Rippen waren gebrochen, Hautabschürfungen, Gesicht und Schädel demoliert. Dennoch war ich lebendig. Es war 1952, eigentlich noch immer kurz nach dem Krieg, was erklärt, das ich ambulant verarztet wurde, trotz der Schwere der Verletzungen. Vielleicht ließ man mich auch deshalb zu Hause, weil zur damaligen Zeit ein Ärzteehepaar im Haus meiner Großeltern wohnte. Wie auch immer. Anfangs befürchtete man, mir das rechte Bein amputieren zu müssen. Das blieb mir zwar erspart, aber dann passierte etwas, was auch schrecklich war und was nicht hätte passieren dürfen.
Nachdem der Arzt meine klaffende Wunde gesäubert und versorgt hatte, zog er eine Spritze auf. Oh nein, nur das nicht! Ich hatte panische Angst vor diesen Nadeln. Der Arzt sagte, die Spritze sei wichtig, der Tetanusbazillus könnte mich befallen und töten. Aber davon verstand ich eh nix. Ich brüllte, ich strampelte, bis meine Großeltern mitleidig abwinkten: »Dann lassen Sie doch den Jungen in Ruhe.«
Ein kapitaler Fehler, der mich beinahe das Leben gekostet hätte, wie vorausgesagt. Der Arzt ließ sich bequatschen. Und so entzündete sich die Wunde, ich bekam schweres Fieber, ich bekam Krämpfe, Erstarrungen, biss mir auf die Lippen und drohte, meine Zunge abzubeißen. Ich war dem Tode näher als dem Leben. Ich hatte wirklich Wundstarrkrampf, sprich Tetanus, bekommen. Im Wahn sah ich psychedelische Farben und hörte Geräusche und gedämpfte Stimmen, wie aus einer anderen Welt. Die meiste Zeit schlief ich und träumte wirr – über Monate.
Der Sommer ging, der Herbst kam, bis ich eben in diesen gekachelten Raum geschoben wurde, von dem ich wusste, was das bedeutete. Es war meine letzte Nacht. Ich würde sterben. Und jeder wusste es. Doch dann kam dieser Morgen. Die Ärzte standen über mein Bett gebeugt, in dem ich an Händen und Füßen gefesselt, mit einem Esslöffel im Mund, in die Morgensonne blinzelte. Und dann sagte die Krankenschwester den Satz, den ich nie vergessen werde: »Ich glaube, der liebe Gott hat noch 'ne Menge vor mit dir!« Ich hab das damals nicht richtig geschnallt, was sie damit meinte. Heute, rückblickend, muss ich sagen: An dem Satz war echt was dran. Und so bin ich dem Tod zum zweiten Mal von der Schippe gesprungen.
Und es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht liegt es gerade an diesen Ereignissen, dass ich heute mit dem Tod besser klarkomme als viele in unserem Land. Ich verleugne ihn nicht, ich verharmlose ihn nicht, ich wünsche ihn nicht unbedingt herbei, aber ich habe Respekt vor ihm. Und ich rede ihn immer mit Sir an.
Es sollte noch Monate dauern, bis ich endlich im Frühjahr 53 aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Immer noch geschwächt und abgemagert, kam ich erst mal in eine Rehaklinik, in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Es war eine Rehaklinik der Bundesbahn, immerhin war mein Vater ja Eisenbahner. In dieser Klinik machte ich Bekanntschaft mit einem Mann, der – im Nachhinein betrachtet – mein erstes Vorbild war: Albert Schweitzer. Ich lernte ihn nicht persönlich kennen, aber ich bekam einen Bildband geschenkt und der war mein wichtigster Schatz in der damaligen Zeit. Das Buch hieß: »Albert Schweitzer in Lambarene«. Das Buch würde ich immer noch besitzen, wenn nicht bei einem Brand ein Teil meiner Bibliothek in Flammen aufgegangen wäre.
Ich weiß nicht, ob ich in der Schule ein Jahr wiederholen musste, ich glaube eher nicht. Ich weiß nur, dass meine Stiefmutter meinte, ich hätte das Zeug zur Oberschule. Doch hatte ich wohl durch diese ganze Krankheitsgeschichte einfach zu viel Unterricht versäumt, um meine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und so blieb ich ein Volksschüler. Und das war gut so.
1955
Hausmusik mit Schwester Marion – bevor Elvis in mein Leben trat