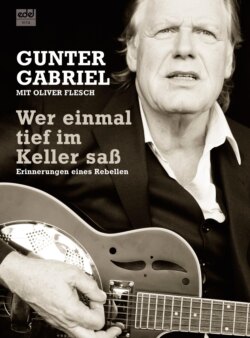Читать книгу Gunter Gabriel - Oliver Flesch - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9 Elvis und die Folgen
ОглавлениеDie Schreibmaschine war meine erste große Liebe. Noch heute bin ich im Besitz von zwei IBM-Kugelkopf-Maschinen, die ich immer wieder aufs Neue repariere. Seit damals hat weißes DIN-A4-Papier eine besondere Bedeutung für mich – und das Geschmiere mit dem Kugelschreiber hörte auf.
Meine zweite große Liebe war eine billige Gitarre – wo ich war, war auch sie. Die Gitarre schleppte ich überall mit hin. Und wenn meine Eltern mal nicht zu Hause waren, holte ich sie aus dem Plastiksack und hackte erbarmungslos auf den sechs Saiten rum, bis die Finger meiner rechten Hand, der Schlaghand, bluteten.
Zur Gitarre kam ich dank eines Mannes, der eine Art Leitstern für mein Leben werden sollte. Dieser Mann war sieben Jahre älter als ich und hieß Elvis »the Pelvis« Presley. Als ich ihn zum ersten Mal hörte – es war ein Samstag im Winter 56, ich weiß es noch genau – wurde ich gläubig. Ich glaubte nicht an Gott – wo war der Typ, als mir mein Vater ständig in die Fresse geschlagen hatte? –, ich glaubte an Elvis Presley. Elvis war Gott, eine Ein-Mann-Rockrevolution.
Er kam aus Memphis – kein Mensch wusste, wo das lag – und hatte eine Stimme, die eben nicht wie Freddy klang oder Fred Bertelmann oder Bruce Low. Diese Stimme klang so, wie keine Stimme zuvor geklungen hat. Und was da im Hintergrund rumsägte, kein Mensch wusste, was das war.
Es waren die schrillsten Gitarren, die man je zu hören bekommen hatte. Mit einem Mal war Musik nichts mehr für Weicheier, mit einem Mal war Musik was für Rabauken. Für junge Kerle, die rote Florett-Mopeds mit 'ner durchgehenden Sitzbank fuhren, die spitze italienische Schuhe trugen und lange Koteletten und Haare hatten.
Heute wird so getan, als ob die weltweite Jugendbewegung mit den Beatles begonnen habe. Den Beatles! Das muss man sich einmal vorstellen! Diese weichgespülten Schwiegermami-Lieblinge. »I Wanna Hold Your Hand« – wenn ich das schon höre! Elvis sang »You Ain't Nothing But A Hound Dog«, der King wollte ficken, nicht Händchen halten. Plötzlich bekam mein Leben richtig Drive, als hätte es die lange benötigte Sauerstoffzufuhr gelegt bekommen. Dadurch, dass ich in der Handelsschule ein bisschen Englisch gelernt hatte, tat sich was in meinem Kopf. Ich lernte diese verdammten englischen Texte einigermaßen auswendig. Und dadurch, dass ich mich mit den Texten beschäftigte, bekam ich auch mit, wer diese verdammten Songs überhaupt geschrieben hatte. Und dadurch ging mir langsam, aber sicher ein Licht auf. Ich erkannte urplötzlich, dass die Leute, die diese Songs schrieben, viel, viel wichtiger waren, als die, die vorne am Mikro standen. Also wurden die Jungs, die sich die Lieder ausdachten, meine ersten wahren Helden. Wie das Duo Leiber-Stoller, das waren die zwei, die für Elvis schrieben.
Ich konsumierte Musik also nicht nur, sondern informierte mich auch über deren Hintergründe. Und als ich erfuhr, dass Paul Anka seine Ode an Diana selbst geschrieben hatte und noch dazu in meinem Alter, schien es, als hätte ich den Schlüssel für das Eingangstor zu einer magischen Welt gefunden. Was der kann, kann ich zwar lange noch nicht, aber es liegt zumindest im Bereich des Möglichen!, dachte ich und versuchte, den Text ins Deutsche zu übersetzen. Ein zunächst mühsames Unterfangen, obwohl die Lyrics eigentlich trivial waren: »I'm so young and you're so old – this, my darling, I've been told«. Aber wenn du vierzehn und verliebt bist, bedeuten diese Zeilen mehr als alles andere. Es gab auch eine deutsche Version. Aber die war wieder einmal jenseits von Gut und Blöde: »Träumte von ihr fast ein Jahr – weil sie schön wie Mutter war …«, sang Peter Kraus. Na, da wusste ich wenigstens, wie man es nicht machen sollte. Mein Vater teilte meine Liebe zur Musik. Wenn auch zu einer anderen Art von Musik. Rock-'n'-Roll-Sänger waren für ihn allesamt Affen aus dem Dschungel, und da spielte es keine Rolle, ob die schwarz oder weiß waren. Er selbst war ein ganz ansehnlicher Musiker, spielte ziemlich gut Mandoline und Mundharmonika. Nur mir traute er – wie sollte es anders sein – nichts zu.
»Lass den Jungen doch träumen, er braucht ein Instrument!«, sagte meine Stiefmutter oft zu meinem Vater. Sie war es auch, die mir mein erstes Musikinstrument schenkte. Es war klar, dass es eine Gitarre sein musste. Keine Blockflöte, kein Klavier und keine Trompete. Ich wollte sein wie Elvis.
Ich durfte sogar Unterricht nehmen. Einen Winter lang, dann hatte ich die Schnauze voll. Die Dame, bei der ich lernte, war so alt, ich schätze, die hat die Musiker, deren Werke ich üben musste – Mozart und so'n Zeug – noch persönlich gekannt. Nein, ich wollte nicht zaghaft zupfen, ich wollte die Gitarre schlagen, so wie Elvis. Ich wollte rocken! Denn: Ich war nun ein Rock 'n' Roller!
Ganz langsam veränderte sich auch die deutsche Radiolandschaft. Was immens wichtig war, denn Radio war alles damals. Und so wurde mein nächster Held ein Radiomoderator: Chris Howland. Auf NWDR (später WDR) gab's jeden Mittwoch »Spielereien mit Schallplatten«, und Howland selbst nannte sich Heinrich Pumpernickel. Ich liebte seine Stimme und ich liebte die Musik, die er spielte. Ich kroch mit meinen Ohren in die Lautsprecher. Was ich toll fand war, dass er Hintergrundgeschichten über die Sänger und deren Songs erzählte.
So wurde neben Elvis und Paul Anka ein Dritter mein Held: Lonnie Donegan. Warum? Weil er Working-Man-Songs sang, sprich Arbeiterlieder. Und das war's für mich. Und das ist das, was ich bis heute selber am liebsten mache. Arbeiterlieder. »My Old Man's A Dustman« – was für eine Geschichte. Oder »Rock Island Line«. Oder die Story von »John Henry«. Skiffle, so nannte man diese Art Musik. John Lennon hat mal gesagt, dass für ihn Skiffle der Anfang gewesen sei, und Elvis, und dass es vorher nichts gegeben habe. Genau so war's bei mir, merkwürdigerweise. Auch wenn uns die Sprache und der Ärmelkanal trennten.
An meiner miesen Grundsituation änderte allerdings auch die Musik nichts. Mein Vater blieb jähzornig und unberechenbar. Er fand immer einen Anlass, mir die Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Und dabei fand er immer neue Methoden, mich einzuschüchtern.
Zum Beispiel sperrte er mich in den Kohlenkeller, wo ich Briketts stapeln musste, die er als Eisenbahner von der Bahn als Bonus bekam. Jeder Stapel musste dem anderen genau gleichen. Der Wahnsinnige kontrollierte meine Strafarbeit mit einer Wasserwaage. Gelang mir das Stapeln nicht exakt – was meistens der Fall war – gab's einen kräftigen Nachschlag. Dort, wo niemand meine Schreie hörte. Einmal, als ich wieder grün und blau geschlagen oben in der Wohnung ankam, tröstete mich Inge mit den Worten: »Bald bist du groß und stark, dann kannste es ihm zurückzahlen!« Es gab nichts auf der Welt, was ich mir mehr wünschte.
Aber der Kohlenkeller war für mich Hölle und Paradies in einem. Wenn mein Vater nicht da war, verkroch ich mich dort und schrie meine Songs, die ich im Radio gehört hatte. So laut, dass die Briketts zu Staub zerfielen. Ich war dann immer so aufgeregt und erregt, dass ich mich erst nach Stunden wieder einkriegen konnte. Es war eine absolut erotische Beziehung zwischen meiner Gitarre und mir und nur noch zu toppen durch eine echte Liebesbeziehung. Jedenfalls: Erst war die Gitarre, dann kamen die Mädchen. Ja, durch die Gitarre kam ich überhaupt erst an Mädchen ran, aber das sollte ich erst später schnallen.
Oft ging ich freiwillig runter, um ungestört üben zu können. Ich versuchte, die Songs aus dem Radio, die mir gefielen, nachzuspielen. Was als Anfänger ohne fundierte Englischkenntnisse schwer war. Erst als wir einen Dual-Plattenspieler bekamen und ich mir meine Lieblingslieder immer wieder reinziehen konnte – natürlich nur, wenn mein Vater nicht da war –, ging's ein wenig einfacher. Mein erstes Lied, das ich auf der Gitarre spielen konnte, war »Tom Dooley« vom Kingston Trio. Meine Finger bluteten, als ich es endlich draufhatte. Ein unvergesslicher, ein schöner Schmerz. Mein zweites Lied war »Diana« in der deutschen Version von Peter Kraus. Überhaupt, Peter Kraus – was blieb uns anderes übrig, als ihn zu mögen!? Er hatte natürlich nicht dieses Wilde, Erotische und Gefährliche von Elvis, aber er sang auf jeden Fall verständlich in Deutsch. Bis eben Ted Herold kam. Der war da schon ein anderes Kaliber. Düster und cool und explosiver und viel näher dran an Elvis, als Peter Kraus je dran sein konnte. Peter Kraus blieb letzten Endes immer der Turnschuh-Rocker, bis heute.
Inzwischen sehe ich das natürlich viel toleranter und sage: »Scheiß drauf, wer was war.« Ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man mich als »deutschen Johnny Cash« bezeichnet. Das ist natürlich totaler Quatsch. Jeder von uns hat so seine Attitüden, die er sich von dem und dem abgeguckt hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich kurz vor Johnny Cashs Tod 2003 in seinem Studio saß und »Folsom Prison Blues« in Deutsch aufnahm, mit seiner Truppe, und wie der Gitarrist zu seinen Kollegen sagte: »He has the same attitude as Johnny.« So ist das eben. Von irgendwoher muss es ja kommen. Das macht aus mir aber noch lange keinen Johnny Cash. Und ein bisschen mit dem Arsch wackeln macht aus einem Peter Kraus auch keinen Elvis. Und ein Peter Maffay wird nie ein Mick Jagger sein. Aber wir als Künstler wollen das ja auch gar nicht, die Kopie von jemand anderem sein. Meistens machen uns die Medien dazu, irgendwelche bekloppten Journalisten. Ein Westernhagen will immer ein Westernhagen sein, ein Lindenberg immer ein Lindenberg. Und ich will immer ein Gabriel sein.
1977
On Broadway Nashville