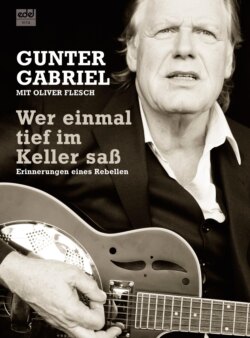Читать книгу Gunter Gabriel - Oliver Flesch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Großvater Heinrich, mein Vater und ich
ОглавлениеBeim Kramen in den Erinnerungsstücken aus meiner Kindheit fiel mir ein altes Foto in die Hände. »September 51« hatte jemand mit Bleistift auf die Rückseite gekritzelt. Es zeigt meinen Vater, wie ich ihn aus diesen Tagen im Gedächtnis habe: In einer Bundesbahnuniform, groß, schlank und ernst. Das Gesicht breit und kantig, auf dem Kopf eine rote Fahrdienstleitermütze. Er war vom Schrankenwärter aufgestiegen zum Fahrdienstleiter. Wenn ich heute durch diese Gegend komme – Bünde, Südlengern, Kirchlengern –, dann passiere ich immer noch die Schranke, für die mein Vater früher zuständig gewesen war. Er drehte die Schranke mit der Hand rauf und runter, musste raus bei Wind, Regen und Schnee. Und dann verschwand er wieder in seinem Schrankenwärterhäuschen. Okay, nun war er also Fahrdienstleiter vom Bahnhof Kirchlengern und hatte eine schicke Uniform. Und plötzlich war er wer.
Meine Mutter war erst achtzehn, als ich am 11. Juni 1942 auf die Welt kam. Das war mitten im Krieg.
Ich wurde gebor'n grad mitten im Krieg
im Sommer 42
die Erde war rot, die Sonne war tot
im Sommer 42
und es stand nicht gut um diese Welt
was wird die Zukunft geben
und jeder riss und biss sich durch
und wollte überleben.
und alle sangen dann
das Lied vom einfachen Mann.
(Aus: Mit dem Hammer in der Hand, 1973)
Großvater Heinrich im Sonntagsanzug
Wie gesagt, meine Erinnerung an meine Mutter ist ganz schwach. Und ich hab nur ein einziges schönes Bild von ihr. Als sie starb, war ich vier und sie war zweiundzwanzig. Alle Leute, die sie kannten, erzählten mir, dass meine Mutter eine warmherzige Frau war. Und das glaube ich auch.
Seit sechzig Jahren steht ein Foto von ihr auf meinem Nachtisch. Ich habe es immer in Ehren gehalten. Nur die Rahmen habe ich im Laufe der Zeit ausgetauscht. Früher war der Rahmen schwarz, jetzt ist er goldfarben. Sie hat ein hübsches Gesicht, das Lächeln der Mona Lisa, und ihre lockiglangen Haare werden von einer Spange gehalten.
Alles was ich über sie weiß, habe ich von meiner Tante Friedchen und meinem Großvater Heinrich. Mein Opa war Klempner von Beruf, ganz so wie es Reinhard Mey in seinem bekannten Song beschreibt. Er war auch Installateur und Heizungsmann – und er war die Heizung für mich und für mein Herz. So habe ich ihn in Erinnerung, so liebte ich ihn, so war er mir wichtig. Er lebte mit seiner Frau Alwine im Erdgeschoss seines Hauses und obendrüber wohnten wir. Dort in Hunnebruck, in der Engerstraße 45, betrieb er auch seine kleine Klempnerei, die mein Spielplatz war. Zwischen Dachrinnenbiegemaschinen und gezinktem Blech kroch ich herum. Die Gerüche von Öl und verbranntem Lötzinn, die Geräusche vom Hämmern und Schweißen habe ich noch heute in Nase und Ohr. Manchmal half ich ihm bei der Arbeit, und wenn mir etwas gelang, nahm er mich in den Arm. Das alles hatte für mich eine ganz besondere Art von Romantik, und es war eine große Auszeichnung, in sein Reich zu dürfen.
Doch das, was mich an seiner Klempnerei am meisten beeindruckte, war der Donnerbalken hinterm Haus. Das hatte auch eine spezielle Romantik, wenn wir Jungs da saßen: Drei Mann nebeneinander, das Toilettenpapier waren Zeitungsfetzen. Im Sommer verbrachten wir jungen Bengels Stunden auf diesem Scheißhausbalken. Denn es stank so herrlich und die Fliegen summten um unsere nackten Ärsche. Das fanden wir klasse.
Ich war gerne bei meinem Großvater, doch meinem Vater passte das überhaupt nicht. Nun, er musste es zwangsläufig dulden, denn ihm fehlte ja eine Frau, die sich um seine Kinder kümmern konnte. Aber meinem Vater passte eigentlich nie irgendwas. Fast täglich gab es Streit, fast täglich setzte es Prügel, fast täglich war er schlecht gelaunt. Und diese Laune ließ er an mir aus. Mit meinem Durchblick von heute würde ich sagen: Sein schlechtes Gewissen und das Bewusstsein, am Tod seiner Frau mitschuldig zu sein, haben ihn zu diesem frustrierten Mann gemacht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Seine zweite Frau Gerda, meine Stiefmutter, sagte mir neulich noch: »Kein Erbarmen für diesen Mann. Es gibt nichts Positives über ihn zu berichten.« Es war immer die gleiche Situation: Wir saßen zu dritt am Abendbrottisch, er stierte missmutig auf seinen Teller. Vollkommen unvermittelt hob er plötzlich den Kopf, fixierte mich aus hasserfüllten Augen und schrie: »Hast du dich wieder den ganzen Tag bei dem Alten rumgetrieben?!« Was sollte ich darauf sagen? Klar, war ich bei Großvater Heinrich gewesen, warum auch nicht? Also schwieg ich und starrte meinerseits auf meinen Teller mit der kümmerlichen Scheibe Graubrot und dem Klecks ausgelassenen Schweineschmalz. »Sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede!« Langsam blickte ich auf. Sein Gesicht sah gefährlich aus. Die Augen aggressiv. Ich ahnte, was kommen würde, wagte nicht zu atmen. Und nun passierte, was mich während meiner gesamten Kindheit begleiten sollte: Mein Vater sprang auf, sein Stuhl krachte nach hinten, er stürzte auf mich los und zog mich an den Ohren hoch. Und dann schlug er zu. Mit der flachen Hand. Immer wieder. Bis ich glaubte, mein Kopf würde zerplatzen. Irgendwann lag ich auf dem Boden und versuchte meinen Kopf mit meinen Ärmchen zu schützen. Manchmal, wenn er besonders schlecht drauf war, trat er mir zum Abschluss noch in den Bauch. Meine Schwester heulte. Das war gefährlich. Vater hasste Heulsusen. »Sei ruhig, Inge«, flüsterte ich, »alles wird gut!« Aber es gelang mir nicht immer, sie zu beruhigen, und somit bekam auch sie die Hand meines Vaters mehr als einmal zu spüren. Anfangs gingen meine Großeltern dazwischen und versuchten, ihn daran zu hindern, uns zu schlagen. Aber das wurde immer seltener, auch sie hatten Angst vor ihm. Abends, wenn Vater noch mal etwas trinken ging, trösteten sie uns. Dabei musste Oma mich häufig verarzten, irgendeine Blessur hatte ich immer: Ein zugeschwollenes Augenlid, eine aufgeplatzte Lippe, eine Beule am Kopf. Es war einfach entsetzlich.
Glücklich war ich eigentlich nur, wenn ich mit meinem Großvater unterwegs war. Wir müssen uns wohl gegenseitig getröstet haben. Er hatte seine Tochter verloren, die er sehr geliebt hat, und ich hatte meine Mutter verloren, die ich sehr geliebt habe.
Meine Großeltern bewahrten mir den Glauben an das Gute im Menschen. Sie waren meine einzige Zuflucht. Jeden Sonntag ging mein Großvater Heinrich mit mir zum Schwimmen an den Fluss, der Else hieß und ganz bei uns in der Nähe war. Er war zehn bis fünfzehn Meter breit, mündet in die Werre und die wiederum in die Weser. Heute ist die Else nur noch ein mickriges Flüsschen, aber damals war sie für mich ein richtiger Strom.
Ich habe mich schon immer gerne im Wasser aufgehalten, das ist noch heute so. Flüsse sind für mich was ganz Besonderes. Ohne Wasser vor der Tür könnte ich gar nicht mehr sein. Deshalb lebe ich auch auf einem Hausboot. Ich stiefelte also wie immer ins Wasser, während es sich Heinrich in seinem dreiteiligen schwarzen Sonntagsanzug und seinen hochgeschnürten Schuhen am Flussufer bequem gemacht hatte. »Schwimm nicht ans andere Ufer! Bleib hier vorne. Dahinten sind Kolke. Die sind gefährlich. Wenn du da reingerätst, ertrinkst du!« Kolke, das wusste ich, sind Vertiefungen, die durch Wasserwirbel entstehen und manchmal zwei Meter tief sein können. Ich wusste von diesen gefährlichen Löchern auf dem Grund des Flusses. Außerdem wusste ich, dass sich in diesen Kolken häufig Aale aufhalten, die ich mit meinem Onkel Kurt, der ein begeisterter Angler war, nachts dort rausholte. Dennoch landete ich in so einem Ding, leichtsinnig wie ich war. Und ich weiß es noch heute, wie ich darin versank, wieder hochkam, wieder darin versank und in Panik wieder hochkam. Und dann passierte etwas, was ich mein ganzes Leben nie wieder vergessen sollte: Mein geliebter, wunderbarer Klempner-Großvater Heinrich sprang in seinem Sonntagsanzug auf mich zu, gerade als ich das dritte Mal unterzugehen drohte. Er war schon bis zur Brust im Wasser, als er mich gerade noch an den Haaren erwischte. Als er mich ans Ufer gezogen hatte, tat er etwas, was ich von ihm gar nicht kannte. Und was wohl auch richtig gewesen ist: Er gab mir einen Arsch voll, wie ich noch nie im Leben einen Arsch voll gekriegt hatte. Doch für die Rettungsaktion liebe ich ihn noch heute. Sonst wäre ich ja auch tot. Und dann passierte das, worüber ich noch heute Tränen der Rührung in die Augen kriegen könnte: Er schüttete seine klitschnassen hochgeschnürten Schuhe aus, er zog sein triefendes Jackett aus, seine Weste, seine Hose mit den Hosenträgern, band seine Krawatte ab, zog sein nasses Hemd mit dem Stehkragen aus und hängte alles neben sich auf einen verrosteten Stacheldrahtzaun. Und so flatterte sein Sonntagsausgehanzug, bis er trocken war, im Wind. Immerhin, es war Sommer und er saß nun da nicht etwa in einer kurzen Beinbekleidung, sondern in einer langen, langen weißen Unterhose. Zum Totlachen. Doch die Leute um ihn herum, die seine beherzte Rettungsaktion beobachtet hatten, applaudierten ihm.
1945
Mein Großvater und ich
Jeden Tag sitzt er auf seiner Bank vor seinem Haus, ein stiller, alter
Mann, den keiner will.
Der Garten mit dem kleinen Bach sieht ganz verwildert aus,
wo früher Kinder spielten, ist es heute still.
Die Augen, die die Welt gesehn, sind schwach und ohne Glanz,
die Hände haben Ruhe nie gekannt,
und leise betet er für sich den Rosenkranz:
So nimm mich, Herr, so nimm mich, Herr,
so nimm mich, Herr, an deine Hand.
(Aus: Der alte Mann und sein großes Haus, 1974)
Dieser Song war übrigens die Rückseite von »Hey Boss, ich brauch mehr Geld«. Damals war ich mit Volker Lechtenbrink eng befreundet, wie Otto auch, war ich sogar Trauzeuge bei seiner Hochzeit. Und oft rief er mich in dieser Zeit an und sagte: »Heute Nacht musste ich wieder weinen bei deinem Song über deinen Großvater.« Denn ihm hatte ich diesen Song gewidmet. Mich macht es bis heute sehr traurig, dass mein Großvater Heinrich meine Entwicklung nicht mehr miterlebt hat.
Großvater Heinrich hatte nicht nur ein großes Herz, das er seiner Tochter, also meiner Mutter, vererbt hatte. Er hatte auch eine wunderbare Angewohnheit, etwas, das ich weidlich ausnutzte: Er rauchte dicke Zigarren, die immer auf seinem Schreibtisch rumlagen. Und davon stibitzte ich mir ab und an welche und rauchte sie hinter seiner Klempnerei. Heimlich, mit meinen Freunden. Erwischt hat er mich dabei, glaube ich, nie. Sonst hätte er sicherlich die Zigarren nicht weiter da liegen lassen. In diesen großen, hölzernen Zigarrenkisten lag auch manchmal etwas Kleingeld. Fünfmarkscheine und Münzen, die ich mir hin und wieder in die Tasche steckte, um ins allseits beliebte Kino BüLi (Bünder Lichtspiele) zu gehen. Bereits damals war ich ein Einzelgänger. Klar, ich spielte mit anderen Jungen, meist Fußball, aber so richtige Freunde waren das nicht. Und da mein reales Leben ziemlich traurig war, flüchtete ich mich einmal in der Woche in die heile Fantasiewelt des Kinos.
Meine Lieblinge waren John Wayne, Rock Hudson und Audie Murphy. Vor allem Western-Filme waren mein Ding. Jeder Film bescherte mir eine Art kleines Erweckungserlebnis. Sobald ich aus dem Kino auf die Straße trat, hatte ich ein geradezu erhebendes Gefühl, ein richtiges Stimmungshoch. Leider hielt das nicht lange an. In einem dieser Filme spielte eine Schauspielerin mit, in die ich mich als junger Bengel Hals über Kopf verliebte. Sie hieß Yvonne de Carlo und hatte einen riesigen Busen über ihrer geschnürten Taille und rotbraune, lange Haare und war das most sexy girl, das ich bis dahin gesehen hatte. Ihren Vornamen gab ich später meiner ersten Tochter: Yvonne. Mit Yvonne hatte ich später einen großartigen Hit, der »Hey Yvonne, warum weint die Mami« hieß. (Ich komme noch darauf zurück.) Und man erzählt sich, dass danach sehr viele neu geborene Mädchen in Deutschland von ihren Eltern Yvonne genannt wurden.
Mein Großvater war mein Held. Jahre später, als wir schon längst nicht mehr in Hunnebruck wohnten, schlich ich mich noch oft zu ihm – trotz der zehn Kilometer Entfernung. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich im Winter auf der zugefrorenen Else in Schlittschuhen zu ihm kam. Weihnachten war das, ausgerechnet Weihnachten. Da hatte es wieder Prügel gegeben bei uns (weshalb ich heute noch Weihnachten und diese ganze geheuchelte Harmonieseligkeit nicht leiden kann). Und so flüchtete ich mit verheulten Augen zu meinem Großvater – über das knirschende und knackende Eis. »Ich will hierbleiben. Ich will nicht mehr zurück. Ich will bei dir bleiben.« Aber das ging natürlich nicht. Mein Vater hätte mich erschlagen.
Großvater Heinrich, meine Heizung, meine Wärmflasche starb 1958 mit zweiundsiebzig Jahren. Friedchen hatte noch das Bett frisch bezogen und ihm ein frisches Hemd angezogen, und sie hielt seine Hand, als er die Augen für immer schloss. Seine letzten Worte waren: »Ich fühle mich schon wie im Himmel.« Was für ein großartiger Satz für jemanden, der in eine andere Welt hinübergleitet.
Aus meiner heutigen Sicht sage ich: Mein Vater muss ein sehr unglücklicher Mensch gewesen sein, dass er so viel Aggressivität und Gewalt in sich trug. Lag es am Krieg, lag es daran, dass er verwundet worden war? Von wem hatte er das, dieses Gewalttätige? Warum konnte er nie sagen: »Ich liebe dich, mein Sohn.« Oder warum konnte er nie sagen: »Ich bin stolz auf dich.« Ein armer Mann, in meinen Augen. Ich wollte nie so werden. Und doch, einiges von ihm ist auch in mir: Die Aggressivität und ansatzweise auch seine Gewalttätigkeit – auch wenn ich nie so brutal war wie er, kam sie doch hin und wieder zum Vorschein. Losgeworden bin ich diese Macke nur durch intensive Therapien bei Psychologen und guten Freunden. Heute weiß ich, dass Gewalttätigkeit ein Zeichen von Schwäche ist. Und ich danke Alice Schwarzer, die mal mein Verhalten in einer Alfred-Biolek-Sendung mit dem Begriff Hilflosigkeit erklärte. Love you, Alice.