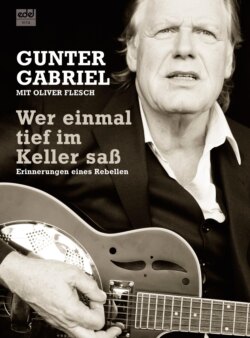Читать книгу Gunter Gabriel - Oliver Flesch - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8 Sonderschule oder Rohrstock
ОглавлениеInsgesamt habe ich fast ein Jahr in Sanatorien und Erholungsheimen verbracht. Körperlich funktionierte ich danach wieder einigermaßen, obwohl die Knieverletzung mir noch Jahre später Probleme machte. Und am Schulsport teilzunehmen war absolut unmöglich. Noch jahrelang trug ich eine Kniebinde, um mich vor Verletzungen zu schützen, so empfindlich war die Haut.
Körperlich war ich also nun einigermaßen wiederhergestellt. Doch als ich nach Hause kam, hatte ich einen ziemlichen Wissensrückstand. Einer hat mich dann allerdings vor dem totalen Untergang gerettet, denn es wurde sogar erwogen, mich in eine Sonderschule zu schicken. Dieser Mann hieß Heinrich Speckmann, ein etwas korpulenter Volksschullehrer aus einem Ort namens Kirchlengern, nahe meiner Geburtsstadt Bünde. Er hatte irgendwie einen Narren an mir gefressen und wohl auch erkannt, wo meine Schwächen und Stärken lagen. Er wusste auch, dass ich in mir irgendwas Aufmüpfiges hatte, etwas Rebellisches und dass ich nicht einfach alles so hinnahm. Und das brachte ihn ab und zu dazu, an den Schrank zu gehen, in dem dieser lange Rohrstock stand. Und den nahm er, wenn ich mich mal wieder rüpelhaft daneben benommen und vielleicht eine Lehrerin als »alte Ziege« bezeichnet hatte. Er sagte dann: »Komm an die Tafel! Bücken!« und hat mir vor der versammelten Klasse so richtig eine runtergezogen. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Ich hätte es nicht wagen dürfen, meinem Vater davon zu erzählen, ich hätte von ihm noch zusätzlich welche reingekriegt.
Dieser Heinrich Speckmann machte mich zum besten Aufsatzschreiber der Klasse. Er hatte einfach mein Talent entdeckt und mir Mut gemacht. Er hat mich natürlich auch kritisiert, wenn ich ins Labern geriet. Und bei Klassenausflügen hat er mich immer an seine Seite genommen und den Arm um mich gelegt. Er hat sich einfach um mich gekümmert. Ich habe ihn in sehr guter Erinnerung und bin ihm sehr, sehr dankbar für alles.
Da gab es aber eine Sache, die er wohl nie verstanden hat und die ich ihm auch nie verraten habe. Und zwar war das die Sechs in Musik, in dem Fach, das wir damals Singen nannten. Ich habe tatsächlich eine Sechs im Singen bekommen. Und er konnte das gar nicht begreifen, weil er wusste, dass ich Musik liebe und dass ich wirklich singen konnte. Das hatte er bei einigen Klassenausflügen ja mitbekommen.
Wie es zu der Sechs kam, ist eine ganz amüsante Geschichte. Mein Musiklehrer war nicht Speckmann, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall: Wir waren eine gemischte Klasse, Jungs und Mädels. Wir saßen an quadratischen Tischen, ich war damals dreizehn oder vierzehn, keine Ahnung. Ich trug, wie es damals Mode war, eine kurze Lederhose aus Bayern, mit Hirschhornknöpfen und vorne einem aufklappbaren Latz. Und dieser aufklappbare Latz – wer wusste schon, was sich gerade dahinter tat. Morgens um acht Uhr, als wir Singen hatten. Wer wusste das schon? Nur ich, aber eigentlich auch nicht richtig. Mein Gott, ich war dreizehn, ich wusste gar nicht, was los war. Wieso das so war. Heute würde sich jeder darüber freuen und darüber lachen, und jeder hätte seine Freude an solch einer prächtigen Zeltstange, wie ich sie damals unter meiner Klappe von meiner Lederhose hatte. Also, der Lehrer, wie auch immer der hieß, sagte: »Komm an die Tafel und sing uns ein Lied.« Es ging um die Zensurenvergabe zum Ende des Schuljahrs.
Aber wie sollte ich aufstehen, ohne dass mein Wiener Würstchen aus der Hose geflutscht wäre? Immerhin gab es zwei Möglichkeiten, wo es hätte hinauslugen können: Entweder aus der Seite der Klappe oder aus dem rechten Hosenbein. Aus dem linken natürlich nicht, ich war ja Rechtsträger. Ich hätte es auch mit der Hand etwas zurechtrücken können, dann wäre es aber oben aus dem Hosenbund herausgekommen. Ich hätte, hätte, hätte.
Wie gesagt, ich war dreizehn, vielleicht vierzehn. Ich hatte einem Mädchen noch nicht mal einen Zungenkuss gegeben, ich wusste gar nicht, was das ist. So blieb ich vorsichtshalber erst mal sitzen. Denn, solange ich saß, konnte erst mal nichts passieren. Mich hätten sie selbst mit ein paar Mann versuchen können, an die Tafel zu schleppen, ich hätte mich nicht gerührt. Und so kam ich zu der Sechs und dieser herrlichen Geschichte.
Mit Heinrich Speckmann verband mich übrigens eine Geschichte bis zu seinem Tod. Auch als ich schon längst berühmt war, hab ich ihn regelmäßig besucht. Noch heute habe ich Kontakt zu seiner Tochter, die in seinem Haus eine Zahnarztpraxis betrieb und inzwischen aussieht wie Räuber Hotzenplotz, aber eine ganz liebe Frau ist.
Durch Heinrich Speckmann kam ich auf einer Klassenfahrt in den Harz in der Jugendherberge Clausthal Zellerfeld zum ersten Mal mit Musik-Performance in Berührung. Der damalige Jugendherbergsvater sang im Treppenhaus zur Gitarre Lieder, die ich noch nie gehört hatte. Und die ich nie wieder vergessen habe. Und die mir damals eine Gänsehaut von oben bis unten bescherten, während wir in unseren doppelstöckigen Betten lagen. Erst später habe ich erfahren, was das für Lieder waren, die er zur Gitarre gesungen hat: Zum Beispiel »Am Brunnen vor dem Tore« aus Schuberts »Winterreise« und das Lied »Ich bin nur ein armer Wandergesell« aus der Operette »Der Vetter aus Dingsda«. Das hat mich damals – das muss so um 1955 gewesen sein – sehr ergriffen und nicht mehr losgelassen. Noch heute singe ich ab und zu diese Lieder, von denen wohl kaum einer erwarten würde, dass ich sie überhaupt kenne.
Mir gelang es nicht, die vielen Fehlzeiten aufzuholen, und so musste ich die Schule am Ende der achten Klasse mit einem Hauptschulabschluss verlassen. Was nun? Ich war vierzehn und hatte keine Idee, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Mein Vater versuchte zwar, mich in einen handwerklichen Beruf zu drängen, aber ich war einfach zu untalentiert auch nur eine gerissene Fahrradkette zu reparieren. Gott sei Dank! Und ich war auch immer noch viel zu schwach für eine Handwerkerlehre. Also wurde beschlossen, nicht zuletzt auf Drägen meiner Stiefmutter, mich auf eine Handelsschule zu schicken.
Langsam wuchs mein Interesse am weiblichen Geschlecht. Mein Erfolg bei Mädchen ließ allerdings zu wünschen übrig. Kein Wunder. Denn mehr, als ihnen aus der Ferne verstohlene Blicke zuzuwerfen, war nicht drin. Mehr gab mein geringes Selbstbewusstsein nicht her. Ich war der klassische Durchschnittstyp – weder der Schönste, noch der Sportlichste, der Witzigste oder gar der Lässigste. Und der Klügste schon mal gar nicht. Was ich mit Ehrgeiz wettzumachen versuchte. Und da gab es nur ein Fach, in dem ich glänzen konnte: Maschineschreiben. Da waren wir nämlich alle dreißig in der Klasse gleich unbeleckt. Meine Sitznachbarin im sogenannten Maschineschreibraum hieß Ingrid. Sie war die Schnellste beim Tippen und hatte Ähnlichkeiten mit der blutjungen Bardot, womit sie schon mal ganz weit vorn lag. Da mir der Mut fehlte, ihr zu zeigen, dass ich sie verehrte, versuchte ich sie durch Leistung zu beeindrucken. Das konnte ich natürlich nur, indem ich genauso schnell schrieb wie sie. Bei den Schnellschreibwettbewerben hörte ich immer, wenn sie nach einer fertigen Zeile schaltete. Wir hatten ja damals noch mechanische Schreibmaschinen. Dann versuchte ich, sie jedes Mal einzuholen. Sie war zwar immer einen Zahn schneller als ich, aber ich war ihr verdammt dicht auf den Fersen. Dreihundertvierzig Anschläge pro Minute war mein Rekord. Und dafür gab es einen Preis: Schnellster Junge der Schule, das war meine erste offizielle Anmerkung, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Am Tag der Preisverleihung – es war im Winter und ich hätte normalerweise morgens mit dem Zug fahren müssen – stand ich ganz früh auf, schlich mich aus dem Haus und lief die zehn Kilometer zu Fuß zur Schule, statt mit der Bahn zu fahren. So aufgeregt war ich. Es war, als hätte ich eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen. Dieses Erfolgserlebnis schmeckte unsagbar süß. Ein Schlüsselmoment, der mein komplettes Leben verändern sollte.