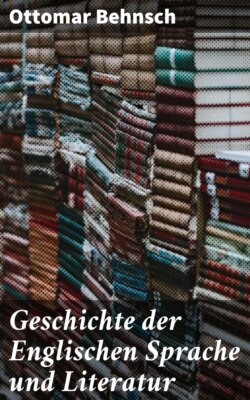Читать книгу Geschichte der Englischen Sprache und Literatur - Ottomar Behnsch - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Die angelsächsische Sprache.51
ОглавлениеGermanische Sprachen. Verwandtschaft und Zusammenhang der angelsächsischen sprache mit den übrigen zweigen des grossen germanischen stammes möchten am besten aus folgender übersicht hervorleuchten:
diagram in plain-text format Alt-Germanisch.52 Alt-Deutsch53 Alt-Skandinavisch54
Die vorväter der germanischen eroberer Britannien’s wohnten an der nordküste Deutschland’s in ihrer ganzen ausdehnung von Friesland bis zur jütischen halbinsel. Die sprache derselben war die niederdeutsche,55 weichere tochter der germanischen mutter in verschiedenen mundarten, welche in England sich zu verschmelzen trachteten, obwohl man ihre unterschiede in alter wie neuer zeit wahrzunehmen vermag. Durch die insulare lage des landes, welche zur einheit drängte, wie durch die berührung mit den romanisirten Britten und Galliern, endlich durch die frühe einführung des bildenden christlichen elementes entwickelte sich in England die sprache und literatur der Angelsachsen zu einer solchen blüthe, wie sie in dieser schönheit und mannigfaltigkeit bei keinem anderen deutschen stamme zu einer so frühen zeit anzutreffen ist. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass das Angelsächsische schon in früher zeit eine gebildete prosa besass; die prosa aber bekundet zugleich die geistige reife des volkes wie seiner sprache, weil es ihr sein wissen und denken vertraut, während in der alten poesie nur sein fühlen zu finden ist.
Das Angelsächsische. Es scheint unzweifelhaft, dass die deutschen einwanderer in der letzten hälfte des fünften jahrhunderts einzelne schöpfungen der nordischen muse nach England mitbrachten. Die ersten denkmäler der angelsächsischen sprache führen uns in die zeit zurück, wo alle literatur noch poesie, und der sänger, dichter und gelehrte eine person war. So wie das leben damals durchaus dichterisch war, so war auch die dichtkunst eine lebendige, das leben schildernde, epische. Im gesange wurden die thaten der urväter, die geschichten der vergangenen tage der mitwelt überliefert, und was diese schuf, wurde sogleich wieder dem liede anvertraut und darin der nachweit aufbewahrt. So wurde im gesange die geschichte und die weisheit des volkes niedergelegt und vererbt auf die künftigen enkel.
Der Scóp. Die gabe des gesanges konnte nicht künstlich erworben werden, sondern stammte von der gottheit und war eine besondere gabe derselben, wie Beda (kirchengeschichte IV, 24) von Caedmon erzählt. Der sänger, scóp (von sceapan, scyppan, schaffen), stand daher in Ehren bei den Sachsen, sein platz war in der halle und an der tafel der fürsten; er begleitete sie in die schlacht und feierte ihre häuslichen freuden. Wie hoch die dichtkunst und der gesang unter den Sachsen gehalten wurde, sieht man aus manchen andeutungen des alten gedichtes Beowulf. Wenn der dichter uns die freude schildern will, welche in der königlichen halle von Heorot herrschte, so darf der sänger nicht fehlen (Beow. v. 987); dagegen ist es ein sicheres zeichen der sorge und des kummers, wenn die gewohnten gesänge nicht gehört werden (v. 4519). Dass die sänger die thaten der helden, mit denen sie lebten, im gesange verherrlichten, geht aus einer anderen stelle Beowulf’s deutlich hervor. Kaum hatte Beowulf den schrecklichen Grendel besiegt, als auch schon der hofsänger Hrothgar’s sich anschickt, den sieg Beowulf’s in verse zu bringen und damit der nachwelt zu überliefern (Beowulf, v. 1728). Zuweilen sang der dichter auch höhere dinge als die thaten der helden; er erhob seine harfe und sang die erschaffung der welt (Beowulf, v. 178). Je nach den umständen mochten auch heitere mit ernsten gegenständen in den liedern des sängers abwechseln. Der sänger wanderte auch fort von der heimath, besuchte fremde länder und sang vor den grossen derselben, welche ihm reichliche ehrengeschenke gaben, die er als zeugen seines ruhmes von der wandersfahrt nach hause brachte, wo er dann seine reisen schilderte. So mag das gedicht entstanden sein, welches unter dem namen Traveller’s Song oder Scopes widsið aus der exeterhandschrift mehrmals abgedruckt worden ist. (Vergl. weiter unten den schluss dieses alten gedichtes.)
Dadurch, dass ein sänger dem anderen die gesänge, welche er empfangen und gedichtet hatte, überlieferte, und dass dieselben durch das öftere hören auch in dem weiteren kreise des volkes bekannt wurden, entstand ein poesiencyclus, welcher, ohne dass ein autor der einzelnen stücke bekannt gewesen wäre, rhapsodisch von geschlecht zu geschlecht forterbte, bis endlich die aufzeichnung einzelner rhapsodien oder grösserer epopöen erfolgte. Der berühmte Codex Exoniensis ist eine solche sammlung späterer aufzeichnungen einzelner rhapsodien des angelsächsischen sangkreises.
Während der langen zeit zwischen dem entstehen der dichtungen und ihrer aufzeichnung durch die schrift, wurden sie ganz allein dem gedächtniss anvertraut und so erhalten. Jetzt, wo die schrift an die stelle des gedächtnisses getreten ist, mag man sich über die kraft und empfänglichkeit des letzteren ungemein wundern. Der aufzeichner von Wilfred’s lebensbeschreibung, Eddius (vita Wilfred. in Gale’s Historiae Britanniae scriptores XV. fol. Oxon. 1691. Seite 52. 53), erwähnt, dass Wilfred als jüngling, während seines aufenthaltes im kloster Lindisfarne, zuerst das psalmbuch nach dem lateinischen texte von Hieronymus, und dann das ganze noch einmal nach dem römischen text (more Romanorum juxta quintam editionem) auswendig gelernt habe. Aus William von Malmsbury (p. 77. Ausg. 1601) geht hervor, dass noch zu seiner zeit im 12. jahrhundert, als die angelsächsische literatur schon im verfall war, viele lieder aus alter zeit im munde des volkes lebten. Die wesentliche folge dieser überlieferung von mund zu mund war, dass die ursprüngliche form der gedichte sich im laufe der zeit änderte. Wenn die späteren sänger sie vortrugen, so geschah es natürlich in der sprache, die sie sprachen und ihre zuhörer am besten verstanden; daher kommt es, dass die handschriften, welche sie enthalten, in dem herrschenden westsächsischen dialekte ihrer zeit abgefasst sind, so dass man eigentlich nicht im stande ist, die allmälige veränderung der lebendigen sprache bis zu ihrer erstarrung in der schrift stufenweise zu verfolgen. Ja selbst die ursprüngliche gestalt des inhalts der gesänge konnte durch auslassungen, zusätze und kleine dem orte und der zeit angepasste veränderungen wechseln, wie sich dies in der that namentlich an Caedmon nachweisen lässt.
Noch zu Alfred’s zeit mochte das gedächtniss das hauptmittel der überlieferung der alten gesänge sein. Er selbst wurde schon im frühen alter angehalten, die dichterischen erzeugnisse seines volkes auswendig zu lernen (Saxonica poemata diu noctuque solers auditor relatu aliorum sæpissime audiens docibilis memoriter retinebat. Asser, vita Aelfr. ed. M. Parker p. 7). Von dem zehnten jahrhundert bis in das zwölfte hinab erfolgten die meisten aufzeichnungen, wie die vielen aus dieser zeit herrührenden handschriften beweisen. Eine sichere nachricht über solche aufzeichnungen findet sich in dem buche de Gestis Herwardi Saxonis (in einem manuscripte des zwölften jahrhunderts), desselben Hereward, welcher mit seinen gefährten in den sümpfen von Ely den scharen Wilhelm’s des eroberers lange zeit trotzte. Der anonyme verfasser des buches erzählt in seiner vorrede, dass er als quelle das werk von Hereward’s priester Leofric, editum a Lefrico diacono eiusdem ad Brun presbitero, benützt habe und fährt dann fort: „Huius enim memorati presbiteri erat studium, omnes actus gigantum et bellatorum ex fabulis antiquorum, aut ex fideli relatione, ad edificationem audientium congregare, et ob memoriam Angliæ literis commendare.“ Leofric mochte der Scop Hereward’s sein und den muth der sächsischen kämpfer durch schilderung der heldenthaten ihrer vorväter kräftigen.56
Der poetische ausdruck der alten gesänge beruht auf dem parallelismus der gedanken, häufigen metaphern und paraphrasen, besonders aber auf der natürlichen lebendigkeit der schilderung. Die poetische figur des gleichnisses kommt sehr selten vor. Im ganzen Beowulf findet sich nur fünfmal eine vergleichung in höchst einfacher form: eines schiffes mit einem vogel, der augen Grendel’s mit feuer, seiner nägel mit stahl, des lichtes in Grendel’s wohnung mit dem sonnenlichte, und des schmelzens eines schwerdtes mit dem des eises. Sylbenmass giebt es in den angelsächsischen gedichten nicht, binnen- wie end-reim nur selten.57 Beide werden durch eine gewöhnlich doppelte hebung und senkung der stimme in je zwei durch alliteration verbundenen hemistichen ersetzt, welche von den englischen herausgebern angelsächsischer poesie in der regel getrennt als besondere verse, von den deutschen meist in einen vers zusammen gedruckt werden. In den handschriften sind die gedichte ununterbrochen gleich prosa geschrieben, jedoch sind die hemistichen meist durch punkte geschieden, was besonders bei langen versen für die verstheilung der Engländer spricht.58 Die alliteration in ihrer regelmässigen form verlangt, dass in dem ersten hemistich die beiden tonwörter mit demselben buchstaben beginnen, welcher dann wiederum der anfangsbuchstabe des ersten tonwortes im zweiten hemistich sein soll. Jedoch finden sich viele abweichungen von dieser regel, welche auch durch spätere interpolationen und durch die ungenauigkeit der abschreiber verletzt worden sein mag. Die alliteration begünstigte, wie in späteren zeiten der reim, die bewahrung der gedichte im gedächtnisse. Man kann dieses daraus entnehmen, dass man sie auch in den predigten benutzte, um dem volke das behalten derselben zu erleichtern. (Vergl. Thorpe’s analecta Anglo-Saxonica seite 74, und Leo’s angelsächsische sprachproben seite 23.)
Beowulf. Das wahrscheinlich älteste denkmal der angelsächsischen vorzeit ist das epos Beowulf, welches der Däne G. J. Thorkelin von dem einzigen, noch dazu im jahre 1731 bei dem feuer im brittischen museum beschädigten manuscripte (Cotton. Vitellius A. 15) 1815 zu Kopenhagen zum ersten male und zwar sehr fehlerhaft herausgab.59
Die handschrift scheint aus dem zehnten jahrhundert zu stammen, bis wohin also das gedicht den mündlichen änderungen der sänger und den irrthümern der abschreiber unterworfen gewesen ist. Obgleich der geschichtliche stoff (aus der mitte des fünften jahrhunderts) und dessen behandlungsweise ersichtlich weit älter sind und in ihren grundlagen von den Angeln aus ihrer alten heimath nach England gebracht worden sein mögen, so hat doch dieses epos im laufe der zeit mannigfache umgestaltungen erlitten, namentlich scheint jede erwähnung der alten gottheiten der Angeln von den späteren christlichen Barden absichtlich in dem gedichte vertilgt worden zu sein. Das epos ist mehr mythus als heldensage, indem es von dem kampfe Beowulf’s zu Heorot, dem schlosse des dänenkönigs Hrothgar, mit zwei mächtigen wassergeistern, Grendel und dessen mutter, seinem hauptinhalte nach handelt und zum schluss den tod Beowulf’s bei der besiegung eines schätze bewachenden drachen und sein begräbniss schildert.
Als der todtwunde Beowulf sein ende herannahen fühlt, befiehlt er sein mal zu errichten (Kemble XXXVIII. v. 5598):
| Ne mæg ic her leng wesan; hatað heaðo-mære hlæw ge wyrcean, beorhtne æfter bæle, æt brimes nosan; se scel to gemyndum minum leodum heah hlifian on Hrones næsse; þæt hit sæ-liðend syððan hatan Biowulfes biorh, ða ðe Brentingas ofer floda genipu feorran drifað. | Nicht mag ich hier lang bleiben; heisset die kriegsberühmten ein mal aufrichten, glänzend nach dem leichenbrande an des (see) randes nase, welches soll zum gedenken meinen leuten hoch emporragen auf Hronesnæs; dass es die seefahrer seitdem heissen Beowulf’s berg, wann die Brentinge über der fluth dunkel weithin treiben. |
Und so wie Beowulf sein grabmal wünschte, so wird es von den seinigen hoch an der küste aufgeführt (XLIII. v. 6268):
| Him ða gegiredan Geata leode ad on eorðan, unwaclicne, helm-behongen, hilde-bordum, beorhtum byrnum, swa he bena wæs: alegdon ða to-middes mærne þeoden haeleð hiofende, hlaford leofne; ongunnon þa on beorge bæl-fyra mæst wigend weccan: wu[du-r]ec astah sweart of swic-ðole, swogende [g]let [woþe] bewunden, wind-blond gelæg oð þæt he ða ban-hus gebrocen hæfd[e], hat on hreðre; higum unrote mod-ceare mændon mon-dryhtnes [cwealm]. | Ihm dann bereiteten die Geatenmänner einen scheiterhaufen auf erden einen mächtigen, helmbehangenen, mit kriegsschilden, glänzenden panzern, wie er gewünscht hatte: es legten dann zu mitten den berühmten führer die trauernden helden, den geliebten herrn; begannen dann auf dem berge den mächtigsten leichenbrand wetteifernd zu wecken: der holzrauch stieg auf, schwarz vom holzverzehrer, rauschende gluth, mit wehklagen umwunden, windwirbel lag (darauf), bis dass er das beinhaus gebrochen hatte, heiss auf der brust; in den seelen bekümmert, im gemüth besorgt betrauerten (sie) des mannherrn tod. |
Hier ist die handschrift lückenhaft. Der schluss des ganzen gedichtes, welcher das aufrichten des Beowulfmals schildert, möge hier nach der von Leo gegebenen übersicht des inhaltes einen platz finden; er enthält die alten heidnischen gebräuche bei der todtenbestattung.
„Da machte das Wedervolk einen todtenhügel, einen hohen und breiten, den die seefahrer leicht von weitem sehen konnten; und in zehn tagen zimmerten sie auf des kriegsberühmten zeichen (becn); mit einem walle umgaben sie es, wie die klügsten es als die ehrenvollste weise angaben. Sie thaten in den todtenhügel ringe und glänzende siegelsteine, aller art rüstzeug, wie es die wildsinnigen männer vorher aus dem schatze genommen hatten; sie liessen die erde halten der edlen zierden, den kies das gold—da liegt es nun noch unnütz wie sonst. Dann ritten um den leichenhügel kampfthiere, edelinge, es waren deren zwölf; sie sprachen und sangen zu seinem preise; sie durchforschten seine edlen eigenschaften, priesen seine heldenthaten, wie es recht ist, dass männer ihren holden herrn mit worten loben, wenn er fort muss aus der leibesumhüllung. So betrauerten die stammhäupter der Geaten ihren theuern herrn, seine heerdgenossen; sie sagten, dass von allen königen der welt er der freigebigste gewesen und freundlichste; dem volke der mildeste und nach edlem begierig.“
In das hauptthema Beowulf’s sind acht zum theil längere episoden eingeflochten. Die dritte und schönste (XVI. XVII. v. 2119-2317), welche ein Scóp bei dem festmahle nach Grendel’s besiegung vorträgt, der kampf Hengest’s und Hnæf’s gegen den Friesen Finn und die eroberung und endliche zerstörung der Finn’s burg,60 ist bruchstückweise in einer andern bearbeitung auf uns gekommen, welche Kemble in seiner ausgabe des Beowulf seite 238-241 mittheilt. Auch der stoff und die erste grundlage dieses gedichtes ist, wie es scheint, von den Angeln von ihren ursprünglichen sitzen nach England verpflanzt worden.
Sängers Reise. Ein anderes, sehr altes gedicht ist der Traveller’s Song, nach dem anfange desselben auch Scopes widsith, sängers weitfahrt, sängers reise genannt. Dieses gedicht befindet sich in der berühmten Exeter handschrift61 aufbewahrt und ist öfters gedruckt worden (in Conybeare’s Illustrations of Anglo-Saxon Poetry, Kemble’s Beowulf, Guest’s History of English Rythms und Leo’s altsächsischen und angelsächsischen sprachproben) und daher sehr bekannt, obwohl sein inhalt dunkel und offenbar durch viele interpolationen entstellt ist. Das einschieben vieler völkernamen lässt das gedicht nicht mehr als eine schilderung der sängerfahrt erkennen, sondern macht es eher zu einer zusammenstellung der in den damaligen poetischen volkssagen vorkommenden helden- und völkernamen, aus welcher sich die ursprüngliche fassung schwer abscheiden lässt. Diese selbst mag sehr alt sein und in die zeit, wo die Angeln noch auf dem festlande lebten, hineinragen. Leo (in seinen alt- und angelsächsischen sprachproben s. 75) sagt über den Traveller’s Song:
„In dem gedicht sind zwei ostdeutsche und zwei norddeutsche heldenkreise, von denen jene um 200 jahre aus einander liegen, verschmolzen. Eormanrîk (Hermanarich) der ostgothenkönig mit den gothenhelden bildet den einen kreis, der auch von deutschen heldensagen vielfach berührt wird. Der zweite ist der Älfvynes (Alboins), des sohnes Eádvynes (Audoins). Beide sind verknüpft durch Ealhhilden, die tochter Eádvynes, die (wie es scheint) fürstin der Myrgingen (wohl Eadgil’s gemahlin) geworden ist, und welche als friedenswerberin den sänger zu Eormanrîk begleitet. Ein dritter berührter kreis ist der der Kûtrûn, denn Hagena (Hagen) und Henden (Heþin), so wie Wâda (Wâte) werden erwähnt; ein vierter ist der des Beówulf, dem Fin Folcvalding und Hrôdvulf (Rudolf) und Hrôdgâr (Rüdiger) angehören. Diese vier epischen kreise mussten offenbar dem sänger schon ihrer historischen grundlage nach in solcher entfernung stehen, dass er bei seinen zuhörern eine chronologische scheidung nicht zu fürchten brauchte; sie waren alle schon sagenhaft; weshalb das gedicht nicht wohl früher als etwa 100 jahre nach Alboin—also nicht vor den letzten zeiten des 7. jahrhunderts verfasst sein kann; vielleicht aber auch später, denn dass die andern sagenkreise im volke fortlebten, ist bekannt, und dass im 8. jahrhundert noch, wie in diesem gedicht, Alboin bei Altsachsen und Baiern gefeiert wurde, sagt Paulus Diaconus. Dass diese epischen stoffe bei den Angelsachsen erst nach ihrer bekehrung zum christenthum, jedenfalls also erst im 7. jahrhundert, so verbunden wurden, macht auch die einmischung der Meder, Perser, Griechen, Idumäer, Hebräer u. s. w. wahrscheinlich. Doch geben wir auch diese späteren elemente und einmischungen alle zu, so bleibt immer noch ein bedeutender stoff übrig, der nur alten an das 4. jahrhundert hinaufreichenden liedern und heldensagen entnommen und zum theil nicht durch spätere landes- und stammkenntniss corrigirt sein kann, sondern so wie er ist von den Angeln mit nach England genommen sein muss.“
Leo hat seinen abdruck des gedichtes aus Kemble’s zweiter ausgabe des Beowulf mit dankenswerthen bemerkungen versehen, welche in das dunkel einiges licht tragen. Eben so Ettmüller, welcher dem gedichte eine besondere bearbeitung gewidmet hat.62
Der schluss des gedichtes lautet:
| 63Swa scriþende gesceapum hweorfað gleomen gumena geond grunda fela, Þearfe secgað, Þoncword spreccað, simle suð oþþe norð, sumne gemelað gydda gleawne, geofum unhneawne, se þe fore duguþe wile dom aræran, eorlscipe æfnan, oþþæt eal scageð leoht and lif somod. Lof se gewyrceð hafað under heofonum heahfæstne dom. | So schreitend mit liedern wandern die sänger der menschen über viele länder, bedürfniss sagen, dankwort sprechen (sie) immer süd oder nord, (wenn) einem sie begegnen liedeskundigen, gaben-unkargen, der vor dem adel will herrschaft aufrichten, würde zeigen, bis alles schüttert licht und leben zusammen. Lob wer erwirkt, hat unter dem himmel hochfeste herrschaft. |
Byrhtnoth’s Tod. Endlich gehört zu den bekannten epischen gedichten, welche der volkspoesie angehören, noch eine romantische schilderung des todes des aldermannes Byrhtnoth, welche ihren stoff aus der wirklichen geschichte geschöpft hat. Im jahre 991 fand der held des gedichtes im kampfe gegen die Dänen den tod, und der ursprung des gesanges dürfte nicht später zu setzen sein, indem der rühmliche tod eines edlen gleichzeitigen sängern hinreichende veranlassung zu einem liede sein mochte. Anfang und ende des gedichtes fehlen. Das Ms. (ehemals Cotton. Otho, A. 12) ist verbrannt. Es findet sich abgedruckt in W. Conybeare’s Illustrations of Anglo-Saxon Poetry, seite 173-183, und Thorpe’s Analecta Anglo-Saxonica, seite 121.
An diese alten volksthümlichen epischen sagen und gesänge schliesset sich ein anderer cyclus von epischen gedichten, welcher auf den mit dem christenthume überkommenen vorstellungen und geschichtlichen stoffen ruht.
Die einführung des christenthums eröffnete den Sachsen ein neues feld der dichtkunst, welches auch alsbald eifrig angebaut wurde. Die sänger vertauschten nun ihre alten sagenkreise mit den erzählungen des alten und neuen testamentes, oder mit christlichen legenden und fanden eifrige hörer. Dabei blieben aber die worte und ausdrucksweise fast dieselben; man änderte nur den stoff.
Caedmon. Der hauptträger der neuen religiösen poesie ist Caedmon, der mönch von Whitby, wie er gewöhnlich genannt wird. Nach Beda’s ausspruch waren Caedmon’s verse von besonderer schönheit und blieben unerreicht von andern dichtern (Bedæ Hist. eccl. IV, 24: „et quidem et alii post illum in gente Anglorum religiosa poemata facere tentabant, sed nullus eum æquiparare potuit“). Dieser umstand mag veranlassung zur erfindung der mit dem namen Caedmon verknüpften legende gewesen sein, wonach derselbe auf ungewöhnliche weise die gabe der dichtkunst empfangen haben soll. Es wäre auch möglich, dass Caedmon der erste gewesen wäre, welcher religiöse dichtungen gesungen hätte, so dass man bei ihm eine besondere göttliche eingebung voraussetzen mochte. Wie dies immer sein möge, so viel ist gewiss, dass die zeit zwischen Caedmon († 680) und Beda († 735) der hervorbringung religiöser poesie ganz besonders günstig war. Beda selbst war (doctissimus in nostris carminibus) in der religiösen poesie der Angelsachsen bewandert.
Die Caedmon-legende, der eine geschichtliche64 grundlage nicht abgesprochen werden soll, wird von Beda in seiner kirchengeschichte (IV, 24) erzählt, wonach ein ehemaliger viehhirt, in der nähe des klosters von Whitby in der mitte des siebenten jahrhunderts lebend, die gabe des gesanges im schlafe vom himmel (divinitus) erhalten haben soll.
Erzbischof Usher kam im anfange des siebzehnten jahrhunderts in den besitz einer angelsächsischen handschrift aus dem zehnten jahrhundert, deren inhalt in vieler beziehung mit Beda’s angabe der von Caedmon behandelten stoffe übereinstimmte. Junius, welcher diese handschrift von Usher empfing, gab dieselbe im jahre 1655 unter Caedmon’s65 namen heraus. Gegenwärtig befindet sich das Ms. in der bodleyanischen bibliothek zu Oxford in einem sehr mangelhaften zustande, indem sogar einzelne blätter herausgeschnitten worden sind. Es zerfällt in zwei theile, von denen der erste ursprünglich fünf und fünfzig abschnitte enthielt, erscheint gegenwärtig aber unvollständig; die behandelten stoffe sind aus dem alten testamente entlehnt. Der zweite theil, in einer jüngeren und nachlässigeren hand geschrieben, umfasst jetzt noch elf abschnitte, welche hauptsächlich die höllenfahrt Christi und dessen sieg über den teufel betreffen.66 Im jahre 1832 gab Thorpe diese dichtungen von neuem unter Caedmon’s67 namen heraus, wodurch sie der kritik zugänglicher wurden. Schon Hickes und später Conybeare hatten auf die verschiedenheit der einzelnen abschnitte in der sprache, auf die völlige zusammenhangslosigkeit des ganzen aufmerksam gemacht, und in neuester zeit ist man ziemlich darüber einverstanden, dass die unter Caedmon’s namen gehenden gedichte, so wie sie sind, nicht von Caedmon herrühren.68 Vielleicht mag ihm keines in der ganzen sammlung, oder doch nur in der überarbeitung eines späteren angelsächsischen dichters angehören. Sagt doch schon Beda, dass viele den von Caedmon zuerst betretenen weg, die heiligen Schriften poetisch zu paraphrasiren, nach ihm gewandelt sind; auch besitzen wir noch eine anzahl ähnlicher dichtungen, obwohl einige in der „Caedmon’s“ sammlung die schönsten und besten der ganzen gattung sind und einen schwung zeigen, dass man zu glauben versucht wird, Milton müsse sie gekannt haben, ehe er sein Paradise Lost dichtete, in welchem ähnliche stoffe behandelt sind.69
Der anfang Caedmon’s lautet:
| 70Us is riht micel, þæt ve rodera veard, vereda vuldorcining, vordum herigen, môdum lufien. | Uns ist sehr recht, dass wir der himmel wart, der heere herrlichen könig, mit worten ehren, mit gemüth loben. |
| He is mægna spêd, heáfod ealra heáhgesceafta,71 freá ælmihtig. Næs him fruma æfre, òr gevorden; ne nû ende cymð èccan drihtnes; ac he bîð â rîce ofer heofenstôlas. | Er ist der kräfte ursprung, haupt aller hochgeschöpfe, herr, allmächtiger. Nicht war ihm anfang jemals, ursprung geworden; nicht nun ein ende kommt des ewigen herrn; sondern er ist immer mächtig auf himmelsthronen. |
| Heágum þrymmum, sôðfæst and svîðfeorm, sveglbôsmas heold, ða væron gesette vîde and sîde, ðurh geveald godes, vuldres bearnum, gàsta veardum. | Mit hohen kräften, wahrhaft und mächtig, himmelsräume hielt er, die gesetzt waren, weit und breit, durch gottes gewalt, den kindern der herrlichkeit, den beschützern der geister. |
| Hæfdon gleám and dreám and heora ordfruman engla þreátas, beorhte blisse væs heora blæd micel; þegnas þrymfæste þeóden heredon, sægdon lustum lôf heora lîffreán démdon drihtnes, dugeðum væron svîðe gesælige. | Sie hatten freude und lust und ihren uranfang der engel scharen; glänzende herrlichkeit war ihre grosse seligkeit: kraftfeste diener priesen den herrn, sagten mit lust das lob ihres lebensherrn, rühmten des herrn, waren in tugenden sehr selig. |
| Synna ne cûðon, firena fremman, ac hie friðe lifdon èce mid heora aldor. Elles ne ongunnon ræran on roderum, nymðe riht and sôð, ærþon engla veard for oferhygde dveal on72 gedvilde. | Sünden konnten sie nicht. (nicht) verbrechen begehen, sondern sie lebten in frieden ewig mit ihrem vater. Anderes begannen sie nicht aufzurichten in den himmeln, als recht und wahrheit, ehe denn der engel wart wegen überhebung ....... irrthum. |
| Noldan dreógan leng heora selfra ræd, ac hie of siblufan godes âhvurfon. Hæfdon gielp micel, þæt hie við drihtne dælan meahton vuldorfæstan vîc, verodes þrymme, sîd and svegltorht. | Sie wollten nicht lang ausdehnen ihren eigenen rath, sondern sie von der kindesliebe Gottes wendeten sich. Sie hatten viel anmassung, dass sie mit dem herrn theilen möchten den herrlichfesten ort, mit heeresmacht, bahn und himmelslicht. |
| Him þær sâr gelamp, æfst and oferhygd, and þæs engles môd, þe þone unræd ongan ærest fremman, vefan and veccean. þâ he vorde cvæð, nîðes ofþyrsted, þæt he on norðdæle hâm and heáhsetl heofena rîces âgan volde. | Ihm da schmerz zustiess, neid und überhebung, und jenes engels gemüth, der diesen unrath begann zuerst zu fassen, weben und wecken. Dann er mit wort sprach, durstig nach bösem, dass er am nordtheil heimath und hochsitz des himmelreiches besitzen wollte. |
| þâ vearð yrre god and þâm verode vrâð, þe he ær vurðode vlîte and vuldre; sceôp þam vêrlogan vræclîcne hâm, veorce tô leáne helleheáfas, hearde niðas; hêht þæt vîtehûs vræcna bîdan, deóp dreáma leás, drihten ure, gâsta veardas. | Da ward Gott ergrimmt und dem heere zornig, das er vorher würdigte mit glanz und herrlichkeit; er schuf jenen verlogenen eine verbannungs-heimath, zum schweren lohne höllklagen, harte strafen, hiess das strafhaus der verbannten bleiben tief, freudenlos, unser herr, der geister warten. |
| þa he hit geare viste, sinnihte beseald, sûsle geinnod, geondfolen fyre and færcyle, rêce and reáde lêge, hêht þâ geond þæt rædleáse hof veáxan vîtebrôgan. | Da er es fertig wusste, mit ewiger nacht versehen, mit schwefel geschwängert, überfüllt mit feuer und mit überkälte, mit rauch und rother flamme, hiess er dann über jenen rathlosen hof wachsen die strafschrecken. |
Judith. Ausser den unter Caedmon’s namen herausgegebenen dichterischen bearbeitungen der heiligen schriften ist noch eine andere erhalten, deren verfasser ebenfalls unbekannt ist. Es ist dieses das bruchstück eines längeren gedichtes, welches seinen stoff aus dem apokryphischen buche Judith entlehnt und mit Judith c. 12, v. 10 beginnt. Die schilderungen und die reden der handelnden personen gehören dem dichter an, welcher nur den stoff und zusammenhang aus der bibel entnommen hat. Das ganze bestand einst aus zwölf abschnitten, von denen jedoch die ersten acht und ein theil des neunten verloren sind. Das erhaltene bruchstück dieses schönen gedichtes befindet sich in demselben Ms. (Cotton. Vitellius, A. XV), welches uns den Beowulf bewahrt hat. Es ist oft gedruckt worden, am besten in Thorpe’s Analecta p. 131, woraus es in Leo’s alt- und angelsächsische sprachproben seite 65 u. f. und in Ettmüller’s scôpas and bôceras seite 140 übergegangen ist.