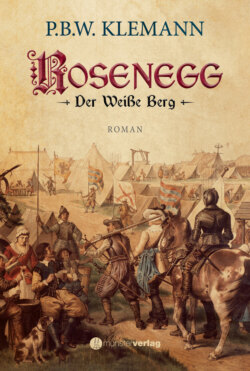Читать книгу Rosenegg - P.B.W. Klemann - Страница 10
Kapitel 1
ОглавлениеAller Anfang
Gott zum Gruße, lieber Leser! Auch wenn ich deine Bekanntschaft wohl nicht mehr machen werde, da ich alsbald das Zeitliche zu segnen habe, denke ich, dass eine Vorstellung meinerseits vonnöten und gleichzeitig der Höflichkeit entsprechend ist. Man nennt mich Bruder Hubertus von Horn, auch wenn ich vormals unter anderem Namen bekannt war, nämlich Kaspar Geißler. Doch wie ich bei meiner “Einkleidung” des gemeinen Mannes Tracht für immer ablegte, den braunen Habit der Kapuziner zu tragen, legte ich meinen elterlichen Namen ab, einen gottgefälligeren anzunehmen.
Und während ich heute den braven Mönch im schönen Mainz gebe, war ich in meinem vorherigen Leben Soldat und Musketierer. Ich tauschte Degen und Muskete gegen Kapuze und Feder, die Freiheit der Welt gegen die Enge meines Kämmerleins. Und wie ich einstmals unter Kaisern und Königen, unter Kriegsherren und Generälen gedient habe, diene ich nunmehr nur noch einem einzigen Herrn; dem guten Gott.
So sitze ich also hier, als alter, grauhaariger Recke, lasse mich Novize schimpfen und muss erneut die Schulbank drücken. Mein lieber Herr Vater – der Herrgott hab ihn selig – brachte mir mit viel Schweiß und Mühe, denn ich war, wie ich zugeben muss, ein lausiger Schüler, das Lesen und Schreiben bei, doch brachte er es mir scheinbar ganz falsch und fehlerhaft bei. Das “hohe Deutsch” oder “Hochdeutsch” müsse man nämlich schreiben und reden, sagt Bruder Martin hier, der mein Novizenmeister und Lesemeister ist, und ein ordentlicher Plackscheißer obendrauf. Ein Deutsch für alle Deutschen gelte es zu etablieren, das alle verstehen und alle sprechen würden, und nichts will er hören von meinem südlichen Kauderwelsch, wie er es nennt, das ja fast so schlimm sei wie das nordische Niederdeutsch. Unzählige Dinge habe ich in meinem Leben geschrieben; schrieb Briefe und Ordern, Avisen und Berichte und dergestalt etliches mehr, und stets habe ich es so geschrieben, wie es gesprochen wurde. Reihte die Buchstaben schlicht dem Klange nach aneinander, und klang es verschieden, schrieb ich es verschieden. Doch nun ist dies alles nicht mehr gültig, nun gibt es ein Richtig und unzählige Falschs.
Hat es Gott so bestimmt?, frug ich ihn mal. Nein, der Mensch natürlich, du Simpel!, schimpfte er mich dann, und ich erwiderte: Ja ist denn mein seliger Vater kein Mensch gewesen? Na freilich sei er einer gewesen, sagte er dann und verdrehte die Augen, aber in diesen Dingen müsse man sich nun mal nach der Mehrheit richten, und wie es die Mehrheit schreibe, so sei es eben richtig geschrieben. Ist ähnlich wie mit dem Glauben, war’s mir durch den Kopf gegangen, aber das sagte ich ihm nicht.
Unentwegt korrigiert er mich, lässt mich Falsches tausendfach richtig schreiben, dass mir die gichtigen Finger schmerzen, und nicht selten juckt es mich, ihm den dürren Hals umzudrehen, doch bin ich wohl zu alt für derlei Späße. Außerdem gibt er sich redliche Mühe mit mir. Fleißig lehrt er mich die Grammatik und die Orthographie, wie es mein Vater einst getan, auf die “richtige” Weise diesmal freilich. Und leicht hat er es wahrlich nicht mit mir, denn mein altes Hirn, wie Bruder Martin es nennt, nimmt alles nur widerwillig auf, vergisst zu schnell und kann von alter Gewohnheit schwer lassen. Übung sei Wiederholung und durch Wiederholung lerne das Hirn, auch wenn meines, wie er mir immer wieder versichert, ein besonders störrisches Hirn sei, weswegen ich desto mehr üben müsse.
Vielleicht lerne ich ja gar nicht mit dem Hirn, sagte ich mal. Vielleicht lern ich mit dem Bauch oder Fuß oder mit dem Arsch. Da wurde er forsch, wie immer, wenn ich ihm gegen den Sinn rede, und schimpfte, dass, mag mein Hirn auch noch so töricht sein, das Hirn nun mal zum Denken da sei, das Herz zum Fühlen und der Arsch zum Scheißen. Da sagte ich ihm: Und der Mund zum Reden! Aber aus seinem käme nur Scheiße, worauf er beleidigt abgezogen.
Wie dem auch sei, lieber Leser, denn meine Ärgernisse haben dich wohl wenig zu kümmern; wisse nur, dass ich mich im Folgenden bemühen werde, das gute, hohe Deutsch zu schreiben, auf dass du mich möglichst gut verstehest, und falls die Grammatik und Orthographie hier und da zu wünschen übrig lassen, so bitte ich dich, geflissentlich darüber hinweg zu lesen, denn nicht die Schreibwerkskunst ist hier von Interesse, sondern einzig und allein die Geschichte, die zu erzählen mich mein altes Herz so hartnäckig drängt.
Die Geschichte, die ich erzählen will, ist eine vom Kriege. Jenem Kriege, den sie heute manchmal den großen Deutschen oder auch den Dreißigjährigen nennen, obwohl es eigentlich mehr als nur ein Krieg war und mehr als nur die deutschen Lande darin verwickelt. Viele Helden hat jener geboren, auch wenn er mit Bestimmtheit, wie wohl alle Kriege, das Tausendfache an Tod und Verderben hervorgebracht hat. In aller Munde sind sie heute, die großen Namen jener Zeit: der eiserne Tilly, der tolle Halberstädtler, der gefrorene Wallenstein oder “der Löwe aus Mitternacht”. Und mancherlei Mär, aber auch mancherlei Wahres steht über sie geschrieben. Doch einen Namen kann man nirgends zu lesen finden, scheint in Vergessenheit geraten, und die wenigen Kundigen und Veteranen, die sich seiner erinnern, sprechen ihn nur leise und verstohlen aus, hinter vorgehaltener Hand, könnte man sagen, und das, obwohl er nicht weniger mutig, nicht weniger toll und nicht weniger schlau war als jeder der Genannten. Von meinem Herrn ist die Rede, dem ich so lange treu diente, bei dessen Geburt ich zugegen war und dessen Tod ich bezeugt. Dem Mann, den ich mehr als alle Menschen verehrte und verehre und zu dessen Füßen ich mich niederwerfen werde, so ich das Zeitliche segne und ihn im nächsten Leben wiedersehe, sei es im Himmel oder eher der Hölle, denn verdammt, so fürchte ich, sind wir von damals alle.
Lange habe ich nachgedacht, wo ich meine Erzählung beginnen soll, und mich schließlich entschlossen, bei mir selber zu beginnen. Zum einen, weil, auch wenn ich freilich nicht der Held dieser Geschichte bin, der Einblick in meinen Werdegang dir, liebem Leser, die Situation jener damaligen Zeit verdeutlicht, dir jene Zustände beschreibt, in denen wir uns befanden, und die Umstände aufzeigt, unter denen ich meinen Herrn zum ersten Mal traf. Zum anderen, weil die Geschichte meines Lebens so eng mit der meines Herrn verbunden ist, dass ich, will ich seine Geschichte erzählen, nicht in den Bereich meiner Phantasie vorstoßen muss, der zudem noch eine reichlich karge Landschaft darstellt, sondern schlichtweg meine eigenen Erlebnisse schildern kann, und du, lieber Leser, dadurch die Geschichte meines Herrn erfährst. Erzähle ich also meine Geschichte, erzähle ich auch seine Geschichte und laufe nicht Gefahr, in Bereiche der Spekulation und der Unwahrheit hinüberzugleiten. Was könnte daher ein besserer Anfang sein als meine Kindheit und die unglücklichen Begebenheiten, die mich zum Waisen werden ließen?
Meine Mutter gebar mich Anno Domini 1601 im Märzen oder Aprilis im kleinen Dorf Horn auf der Höri an den Ufern des Bodensees. Mein Vater war ein Prediger nach der Lehre Zwinglis und Bullingers und entstammte dem Ursprung nach aus dem Thurgau in der Schweiz bei Frauenfeld. Seine strengen Worte sind mir gut in Erinnerung und auch die eine oder andere Schelle, die er mir verpasste, war ich denn unaufmerksam beim Lernen oder kam ich zu spät nach Hause, was nicht allzu selten vorkam, doch insgesamt sehe ich ihn als liebevollen Vater vor mir, der mich seinen “guten Bub” nannte.
Lernen musste ich freilich von klein auf und nicht wenig, lernte das Teutsche oder “Deutsche”, wie man hier sagt, Latein und Italienisch, es zu lesen und zu schreiben. Die nächste Schule war weit entfernt und teuer dazu, weshalb mein Vater sich meiner Bildung persönlich annahm. Mein Wachstäfelchen musste ich öfter glätten als mein Gesicht waschen, den Markus und Matthäus fleißiger rezitieren als die Rüben oder den Kohl ernten. Viel Zeit steckte er in meine Lehrung, vielleicht auch, weil er es schwer hatte in unserer Gemeinde. Calviner nannten sie uns, so sie freundlich waren, und Ketzer, wenn nicht. Er selbst nannte sich weder noch, denn ein Reformer sei er – höchstens noch ein Protestant –, ein Kämpfer des einen, des richtigen Glaubens, und jenen zu seinem Ursprunge zurückzuführen seine Mission. Doch nicht viel übrig hatten sie dort im guten Horn, die alten Katholiken, für seine Ansichten, und manches Ungemach musste er erdulden. Seine kleine Kapelle hatte er eigenhändig gezimmert, verbot doch Pfarrer Reuss, solch Ketzerwerk zu unterstützen, weigerten sich die örtlichen Zimmerleute und Gesinde Hand anzulegen, obwohl man ihnen gutes Geld geboten. So machte er sich selbst daran, brauchte ganze zwei Jahre, bis etwas Brauchbares stand. Bist nun mal ein Mann von Kopf- und nicht von Handarbeit!, hörte ich meine Mutter öfter zu ihm sagen, worauf er meist erwiderte: Ich bin, wie der Herrgott mich braucht!
Noch gut vor Augen hab ich sie, unsere kleine Kirche, kaum mehr als ein Schopf, aus schmalen Holzbrettern und Lehm erbaut, mit knarrendem Boden, wackeligen Bänken und kleinen, ungleichen Fenstern. Wenn es regnete, tropfte es durch die Decke, und wenn es windete, pfiff und sang es durch die Bretterritzen. Mutter tat das Ihre, der Kirche Glanz zu verleihen, schmückte die Wände und Fenster mit Gesticktem und den Altar, der nichts als ein Holztisch war mit einem Holzkreuz vorn angebracht, mit Blumen und Grünzeug. Die wahre Gotteslehre möge keinen unnötigen Zierrat, sagte dann Vater, und sie: Aber die Augen vielleicht schon. Nicht dass es groß jemanden gestört hätte, weder der Schmuck noch die Spärlichkeit, kam ohnehin kaum je ein anderer Besucher als wir zum Gottesdienst, saßen sonntags nur Mutter, ich und Klara – meine kleine Schwester – auf den klapprigen Bänken, lauschten der Stimme Vaters, der auf Deutsch uns vorlas, und kaum je hörte ich ihn eine richtige Predigt halten.
Daheim predigte er dafür umso mehr. Wenn Gleichgesinnte auf dem Weg nach Konstanz und Radolfzell bei uns Halt machten oder die Leute aus der Gegend seine Einladungen annahmen, was nicht allzu häufig und meist sehr diskret passierte, dann verkündete er die wahre Lehre, wie er sie nannte, die reine Lehre: Allein Christus sei der Mensch verpflichtet, allein die Schrift sei die Basis der Lehre, allein die Gnade Gottes könne entscheiden, wer selig sei, und allein der Glaube errette den Menschen. Nichts dürfe zwischen Mensch und Gott stehen, wobei er gerne seine Züricher Bibel griff oder auf sie zeigte, sein wertvollster Besitz. Und wenn er dem Wein einmal zu viel zugesprochen, so schimpfte er schon mal über den törichten Paule Papst, über den ketzernden Maximilian und die fehlgeleiteten Habsburger, dass ich meine Mutter sagen hörte, er werde am Ende noch ins Feuer geschickt. Was Letzteres zu bedeuten hatte, war mir damals nicht verständig, dass nichts Gutes, verstand ich schon. Doch derlei Sorgen tat er immer ab. Vorherbestimmt durch Gott ist alles Dasein, wie töricht, sich dem zu widersetzen suchen! Gott bestimmt, und treulich folgen gelte es, ohne jedes Hadern, ohne jeden Zweifel. Hätte er gewusst, welchen Weg Gott ihm zugedacht hatte oder gar den Weg seines Sohnes, was würde er wohl heute denken?
Beliebt waren wir Geißlers in unserer kleinen Gemeinde jedenfalls nicht, und des einen oder anderen schiefen Blicks und des einen oder anderen unleidigen Kommentars war ich mir wohl gewahr, doch reist mein Geist zurück in meinen Bubenkörper, fühlt er vor allem Freude. Das Kinderherz ist elastischer als das des Mannes, kann besser übersehen und besser verzeihen und bricht nicht gleich, wenn Unrecht es trifft, insbesondere wird es gut gehütet.
Meine Mutter war eine fleißige Frau, die redlich hauswirtschaftete, feines Essen bereitete und gutes Bier braute. Sie sparte nicht mit Küssen auf die Stirn und Streicher des Gesichts, was beides sie gleichmäßig auf mich und meine kleine Schwester verteilte. Unser Hausstand bestand aus einem gut gebauten Haus mit vier Kammern, der Wohnstube und Küche, wo gekocht und am großen Tisch gegessen wurde, dem Studierzimmer meines Vaters, in dem ich Unterricht erhielt, dem Waschraum mit Zuber und Abort und unserer Schlafkammer mit dem großen Bett, in dem wir alle Viere schliefen. Glaubst du mir, lieber Leser, wenn ich dir sage, nie wieder so gut geschlafen zu haben wie zu jenen Zeiten, in jenem engen, grobstrohigen Lager?
Einmal im Jahr brachten Vaters “Brüder”, wie er sie nannte, Geld für unsere Gemeinde, auch wenn sie nur aus unserer Familie bestand, um den guten neuen Glauben zu verbreiten. Viel war es nicht, doch genug zu kaufen, was jahrsüber benötigt wurde, zumal wir uns mit vielem selbst versorgten; pflanzten wir allerhand an, säten und ernteten, trieben gar manchen Handel mit dem Erwirtschafteten, dass ich glaube, dass wir viel mehr Bauern waren als Clerici. In unserem kleinen Schopf nebst kleinem Stall hielten wir Hühner und Gänse und die ein oder andere Sau. War unser Feld auch nicht groß, so reichte es doch, uns mit genug Gemüse zu versorgen, lässt der gute Höriboden doch prächtige Zwiebeln sprießen, die wir “Büllen” nennen, ferner guten Lauch und Kraut, fette Möhren und Erbsen, und unser Apfelbaum und die Himbeersträucher beschenkten uns mit reichlich Süßigkeit. Freilich gab es auch schwere Winter, und wahrscheinlich war es nicht immer so leicht, wie meine Erinnerung mir nun vorgaukelt, doch in Gänze, meine ich, lebten wir gut.
Das traurigste Bild meiner Erinnerung sind die beiden Gräber hinterhofs, in denen meine beiden Brüder begraben lagen, die das erste Jahr nicht überlebt hatten. Thomas und Matthäus stand auf den hölzernen Kreuzen eingeritzt, die mein Vater eigenhändig gezimmert. Pfarrer Reuss verbot, sie bei sich auf geweihtem Boden beizusetzen. “Ketzerbälger” schimpfte er uns alle, und selbst die Beschwerde meines Vaters beim Vogt half nicht. So weihte er die hinterste Ecke unseres Grunds selbst, und gemeinsam betteten wir sie zur letzten Ruhe, auf dass der Herrgott sie bei sich aufnehme.
Einen kleinen Kahn, kaum zwei Klafter lang, nannten wir ebenfalls unser Eigen, und so oft ich Zeit fand und das Wetter stimmte, ruderte ich auf den See hinaus. Von den Fischern im Dorf lernte ich die Fischerskunst, hatte mir alsbald mein eigenes Netz gewoben aus feinem Garn, das mir die Fischer verkauft, und ordentlich staunten meine Eltern, als ich mit den ersten Fischen nach Hause kam. Guten Fisch gibt es im Bodensee, Felchen und Karpfen, prächtige Hechte und Zander, alles mit gutem Bestand, zumindest als ich klein war. In den Flussmündungen konnte man Reusen, die wir bei uns im Süden “Bären” nennen, für Aale und Fische auslegen und flussaufwärts Netze für Forellen stellen. Nichts bereitete mir größere Freude, als die Tage auf dem Wasser zu verbringen, meine Netze und Bären auszulegen und einzuholen und sommers zu schwimmen. Glücklich war ich zu jener Zeit, vermutlich glücklicher als je danach.
Ob meine Eltern glücklich waren, vermag ich nicht zu sagen, lastete die örtliche Ablehnung zumindest auf meinem Vater sehr. Allerhand versuchte er, um die Saat des richtigen Glaubens zu säen, wie er es nannte, erntete zumeist allein Kopfschütteln. Oft grollte er über die Engstirnigkeit, über den Aberglauben, über den frevelhaften Katholizismus und vor allem über Pfarrer Reuss. Welcher wiederum seinerseits keine Gelegenheit ausließ, Unbill auszuhecken, warnte, mit uns zu handeln und Umgang zu pflegen. Sogar von der Kanzel wurde kräftig gegen uns gepredigt. Vielleicht sei unser Glück doch bei unseren eidgenössischen Brüdern zu suchen, hörte ich meinen Vater ein ums andere Mal mit meiner Mutter diskutieren, oder in den Pfälzer Landen, wo Kurfürst Friedrich herrsche, der ein Glaubensgenosse sei. Wenige Freunde besaßen meine Eltern, zumindest wenige wirkliche Freunde, schien doch stets eine Art Misstrauen und Spannung zu herrschen, selbst mit unseren Nachbarn. Unter uns Kindern war es weniger schlimm. Gute Freunde hatte ich damals drei an der Zahl, Erwin Kunz, ein Fischerssohn, mit dem ich viel Zeit auf dem See verbrachte, Hans Reitenmaier, wenn ich mich recht an seinen Nachnamen erinnere, ein Bauernsohn, und Michael Amann, ebenfalls ein Bauernsohn. Wir spielten viel zusammen, verstanden uns meist prächtig, meine ich, und doch kam es auch bei uns zu der ein oder anderen Frage: Warum wir denn nicht zur Messe kämen, etwa, oder wieso wir denn Ketzer seien? Was antwortete ich wohl? Ich weiß es nicht mehr.
All jenem zum Trotze, vielleicht auch gerade unseres Standes wegen, hegten wir wunderbare Familienbande. Vati und Mutti, wie Klara und ich sie riefen, waren lieb zu uns, und wenn sie glaubten, dass wir es nicht sahen, auch lieb zueinander. Ich weiß noch, wie sich Mutter freute, wenn wir unsere Früchte ernteten, Erdbeeren mochte sie am liebsten, wie wir dann zusammen Kuchen backten, den Teig kneteten und mit Früchten drapierten. Wir naschten dann von dem Teig, naschten von den Früchten, dass es manchmal kaum mehr für den Kuchen gereicht. War die Frucht schon überreif, weil der Sommer zur Neige ging, kochte Mutti süßes Gsälz in dem großen Topf, den wir besaßen, backte dazu flache Weizenfladen aus gutem weißem Mehl, die wir dann mit Butter und dem Gsälz bestrichen. Süß ist die Kindheit!
Doch hielt es nicht ewig, unser Familienglück, und so kam schließlich jener vermaledeite Winter anno 1612. Früh hatte er eingesetzt und einiges an Ernte gekostet, Schnee und Kälte brachen über uns herein, wie ich es zuvor noch niemals erlebt. November schon war der See zur Gänze zugefroren, und ohne Schwierigkeiten hätte man darüber ins gegenübrige Steckborn laufen können, gar mit dem Gaul drüber reiten, wie der Egglisperger einst von Konstanz nach Überlingen getan. So bitter kalt war es, dass wir unentwegt das zweite Hemd anbehielten, und wenn wir rausgingen, um Holz zu suchen, kämpften wir uns durch Schnee, der mir bis zur Hüfte reichte. Der teuflische Winter beutelte uns sehr, kostete uns reichlich Vorrat. Alle Hühner mussten wir schlachten, weder Käse noch Speck blieben uns an Reserve, und doch schien es zu reichen, bis schließlich Anfang Jahres, gen Februar, Mutter krank wurde. Klara und mich hatte es zuvorderst erwischt, doch baldigst genasen wir unter guter elterlicher Pflege. Bei Mutter allerdings sah es anders aus. Das Fieber wütete in ihr, ließ sie schwitzen und zittern tagelang. Nach einer Woche ließ mein Vater einen Bader aus Stein kommen. Seinen Namen weiß ich nicht mehr, nur, dass er ein Bruder im Geiste gewesen sei, wie mein Vater es ausdrückte. Jener wusch sie und ließ ordentlich Blut von der Ader, gab ihr allerlei Tinkturen und riet zu reichlich aufgekochtem Wein zur Förderung der guten Säfte. Doch wollte alles nicht helfen. Als sie nach einigen Tagen nicht mehr klaren Verstandes war, lieh sich mein Vater einen guten Gaul, um in Konstanz einen richtigen Medicus aufzusuchen.
Der Schneestand war schon niedriger, vielleicht fußhoch, doch nur Gott allein weiß, wie er es schaffte, bereits tags drauf gen Abend wieder daheim zu sein, den Medicus und einen Gehilfen im Schlepptau. Johann Eberhard hieß der gelehrte Mann, und gut sehe ich ihn noch vor mir, die große hagere Gestalt mit dunklem, schwarzem Haar und sauber gestutztem Bart. Sein Mantel und Hemd waren schwarz und von feinstem Stoff, was die Schneeflocken, die beides bedeckten, nicht verbergen konnten. Den Kragen trug er, wie bei den Wohlhabenden damals Mode war, weiß und breit, und als er den Hut abzog, staunte ich über sein geringes Alter, was ich auf Anfang der dreißig Jahre schätzte. Er maß mich abschätzigen Blickes, und ebenso abschätzig musterte er unser Interieur. Wo ist sie?, fragte er, worauf mein Vater sagte, sie läge im Schlafgemach. Nicht das Weib meine ich, gab der Medicus zurück. Da nickte mein Vater, verschwand in seinem Raum und tauchte kurz darauf mit einem hölzernen Kasten wieder auf. Der Medicus hatte sich an unseren Tisch gesetzt, und Vater stellte den Kasten vor ihm ab. Ich kannte freilich den Inhalt und verstand nun, was sein Preis war, das Wort des Herrn gegen das Leben meiner Mutter. Acht Gulden sei sie im Minimum wert, beschied mein Vater. Seine Arbeit nun mal auch, sprach selbiger, während er das Buch inspizierte. Quartiert uns im Gasthaus ein. Und sorgt dafür, dass etwas Warmes zu Abend bereit steht, mir klappern die Knochen. Die Spesen, meine ich, übernehmt ihr gern. Der mahlende Kiefer meines Vaters zeigte mir, wie es um unser Konto stand, doch wagte er keinen Einwand. Und nun zur Leidenden, verkündete der Heiler und betrat mit seinem Helfer das Schlafgemach. Wir Kinder durften die Behandlung nicht mitansehen und mussten draußen warten, wie auch meinem Vater der Einlass verwehrt wurde, nachdem er von der Dorfgaststätte zurückgekommen war. Schon spät nächtens war es, als der Medicus und sein Gehilfe das Zimmer meiner Mutter verließen, mit stöffernen Masken vor dem Gesicht. Morbus Lenticularis!, verkündete er dann, Fleckfieber genannt, und von schwerster Art. Es herrsche große Gefahr der Contaction, wie er es sagte, weswegen aller Besuch der Kranken abgeraten sei, allen voran meinem Vater, der die Krankheit noch nicht überstanden habe. Unseren Schlafplatz hatten wir ohnehin schon im Wohnraum eingerichtet, doch durften wir ferner auch nicht mehr zu Mutter ans Bett.
Drei Tage blieb der Medicus und pflegte meine Mutter. Das Logis im Gasthaus genoss er indessen in vollen Zügen und zu unserem Leid, denn alle Spesen mussten wir anschreiben lassen. War er ein ordentlicher Medicus? Ich denke schon. Weit gereist war er. Dem Ursprunge nach aus Pommern, was mir damals nichts sagte, war er in die Schweiz und nach Italia gereist zum Studium und nun auf dem Rückweg über Konstanz. Dort hatte er sich beim hiesigen Stadtarzt einquartiert und war zufällig zugegen, als mein Vater eingetroffen. Alles Jammern vermochte den Konstanzer Arzt nicht dazu bewegen, seine warme Stube zu verlassen, und so fasste sich der Eberhard ein Herz, meinen Vater zu begleiten. Freilich nicht, ohne sich zuvor einer Bezahlung zu versichern. Als mein Vater von der Bibel sprach, die er besaß, war es abgemacht.
Gut und lange schien er Mutter zu pflegen, reichte ihr allerlei Arznei. Intermedium dozierte er über die Behandlung, erzählte von seinem Studium in Basel und Padua, doch tat er es stets von oben herab. Gebildet war er freilich und eingebildet auch. Den großen Grynaeus, des Calvins eifrigsten Zögling, habe er in Basel sprechen hören, erzählte er mal, nickte dabei meinem Vater konspirativ zu, weswegen er eine gewisse Neigung in unsere Richtung verspüre. Lutheraner seien sie zumeist in seiner Heimat und hätten wenig Liebe übrig für “euresgleichen”, wie er es sagte. Hassen euch mehr noch als die Papisten, so seine Einschätzung. Und ich weiß noch, wie ich mich darüber verwunderte, gab es in meiner kindlichen Einfalt doch nur Platz für die eine unsrige Partei der neuen Religion und dem entgegen die mächtigen und abergläubischen alten Katholiken. Töricht sei er, meinte Vater dann, der Zwist der neuen Religionen. Fehlbar ist der Mensch!, sagte er. Darin sind wir uns doch eins. Und ist nicht genau dieses, was wir den Papisten streitig machen? Weshalb also nehmen wir erneut des Einen Wort als Sakrosankt, statt gemeinsam zu diskutieren? Die Basis aller Wahrheit sei uns schließlich bei der Hand gegeben, sagte er, wobei er auf die Kiste mit der Bibel deutete, welche der Medicus stets mit zu uns ins Hause führte, als wolle er seinen neuen Besitz meinem Vater unter die Nase reiben. Ha, gut gesprochen!, gab der Medicus zurück und lachte; durchaus hätten die Lutheraner alle Heiligen mitsamt dem Papste obendrauf getauscht gegen einen einzigen neuen, den Doktor Luther selber, doch lasse sich wohl schwerlich bestreiten, dass jener ein verständig Mann gewesen. Verständig wohl, aber Mensch auch!, vermeinte dann Vater, und jener: Na, mit eurem Calvin treibt ihr doch gleiches Spiel! Er selbst, erwiderte mein Vater, sehe sich wohl eher in der Tradition des Zwingli, der ein Eidgenosse gewesen, und nicht des Calvin, dem Franzosen. Und für heilig halte er weder noch; doch richtig sei der beschrittene Weg, man dürfe nur nicht davon abkommen oder sich zu weit voneinander distanzieren. Die neue Religion müsse einiger sich verhalten und agieren. Na ja, mein Lieber, sagte darauf der Arzt. Ihr Schweizer kocht doch gern das eigene Süppchen. Man sehe nur diese Absonderlichkeit von Staat im Herzen Europas, ohne obersten Fürsten oder König, wisse doch ein jeder, dass der stabile Staat einen einzelnen Führer brauche. Was die Protestanten außerhalb der Schweizer Lande trieben, scheine Schweizer Kümmernis nicht zu sein. Und sei zudem nicht zu vergessen, dass der Luther den ganzen Schosen losgebrochen und er es gewesen sei, kein Calvin oder Zwingli, der Gottes Wort in jedermanns Hand und verständlich haben wollte. Das Buch, das ihr dort habt, sagte Vater darauf und deutete erneut auf die Bibel, ist älter noch als jede Lutherbibel! Und ich spürte, was der Verlust ihm bedeutete. Ha! Da täuscht ihr euch aber, lieber Mann!, spottete der Medicus, und Vater ließ es dabei bewenden, schien er ohnehin nur mit halbem Herzen bei der Sache, und wiederholt wanderte sein Blick zur verschlossenen Tür der Schlafkammer.
Als jener uns verließ, schien es Mutter besser zu gehen. Des Öfteren kam sie zu sich, war ansprechbar und sogar stark genug, uns Kindern ein Lächeln zu schenken. Vater war froh, dass der Medicus verschwunden war, zumal wir tief in der Kreide standen. Auch das Wetter wurde nach und nach besser, und sobald das Eis nur noch wenige Klafter ins Wasser reichte, beschloss ich, die Netze auszuwerfen. Ruhig war es, das weiß ich noch, und schön, zogen lichte Nebelschleier über den See, war das Wasser klar und frisch und glatt. Ich genoss die Seeluft, ruderte weit hinaus und ließ mir reichlich Zeit, froh, dem Gefängnis unseres Heims, das mich so lange Monate gefangen gehalten hatte, zu entfliehen. Zurück vom See lief ich nach Hause, war guten Mutes, hatte ich doch immerhin zwei kleine Felchen gefangen. Da sah ich meine Schwester auf der Türschwelle sitzen mit verweinten Augen. Kaspar, Kaspar!, rief sie und kam auf mich zugerannt. Was geschehen sei?, frug ich sogleich, worauf sie mit ihren großen Kinderaugen aufschauend sagte: Der Vati pläred.
Ich rannte ins Haus, ins Schlafgemach, wo mir ein Bild zuteil wurde, welches sich in meine junge Seele brannte und ich bis heute noch in aller Deutlichkeit im Geiste trage. Sah meinen Vater auf dem Bette bei der Mutter sitzen, ihre Hand in der seinen, den Kopf auf ihrer Brust und heulend, wie ich ihn zuvor noch nie erlebt. Ach Eli, jammerte er, ach Eli! Und so starb also meine Mutter, Elisabeth Geißler, zu Beginn des Märzen anno 1613.
Wir begruben sie nebst meinen Brüdern im harten, gefrorenen Höriboden. Meinen Vater traf es schwer, schwerer noch als uns Kinder. Kaum sah man ihn ohne feuchte Augen, war kaum mehr imstande etwas mit sich anzufangen, und bald darauf wurde er selber krank. War es das Gleiche wie bei Mutter? Das Leidbild war ähnlich, doch kam die Krankheit mit ungleicher Wucht. Vielleicht hatte die Trauer ihn geschwächt, soweit Trauer zu schwächen vermag, denn binnen Kurzem schienen alle Kräfte ihn verlassen zu haben. Schüttelfrost ließ ihn zittern und der Schweiß rann ihm vom Gesicht. Nach wenigen Tagen war er bettlägerig. Keine Sorgen solle ich mir machen, der Herrgott werde ihn schon wieder gesunden, er müsse ja schließlich auf uns aufpassen. Höre, Kaspar, ich sag’s dir nur für alle Fälle, sprach er dann zu mir und stöhnte und atmete schwer. Einen Vetter in der Schwyz habe ich noch, so Gott will. Du kennst ihn nicht. In Frauenfeld lebt er. Konrad. Konrad Geißler heißt er. Sollte es zum Ärgsten kommen, sagte er, und ich fuhr dazwischen: Du wirst bestimmt wieder gesund, Vati! Als wollte ich Kommendes nicht hören. Er quälte sich ein Lächeln ab und sagte: Freilich, Kaspar, freilich! Ich sag’s nur zur Sicherheit. Dann sah er mir in die Augen, sein Lächeln diesmal echt. Bist mein guter Bub, Kaspar, weiß Gott!, und tätschelte mir kraftlos die Hand.
Ich pflegte ihn, so gut ich eben konnte, und hütete Klara, die doch alles nicht verstand. Unsere Kasse war bald aufgebraucht, weder Pfennig noch Heller blieb für Unterhalt. Das Jahr war noch jung und nichts zum Ernten vorhanden. Zu fischen schaffte ich wenig, traute ich mich nicht, Klara und Vater lange alleine zu lassen. Ich bat um Hilfe hier und dort bei unseren Nachbarn, doch des harten Winters wegen wurde ich zumeist mit leeren Händen fortgeschickt. Nur ein Bauer, der Amann, Peters Vater, half uns. Er hatte schon mit meinem Vater gut gestanden, war manches Mal gar Gast an unserem Tisch gewesen. Seine Frau, eine fleißige Katholikin, hasste uns allerdings, weswegen ich ob seiner Hilfe umso mehr erstaunte. Ein Säckchen gutes Mehl brachte er uns, ein ordentliches Stück Speck und Butter. Als ich ihm sagte, wie es um unsere Kasse stand, winkte er ab und meinte: Wir rechnen, wenn es dem Vater wieder gut geht. Es ging ihm allerdings nie wieder gut. Ich mühte mich mit seiner Pflege und glaube, dass ich es redlich tat, verabreichte ihm die Reste der Arznei, die noch von meiner Mutter übrig war, und kochte ihm dicke Suppen mit Mehl und Speck und Fisch. Doch als ich eines Morgens aufwachte und die Tür des Schlafgemachs öffnete, schauten seine toten Augen ins Nichts. So starb also auch mein Vater, Hubert Geißler, Ende des Märzen anno 1613.
Seltsam ist, lieber Leser, wie sich in so wenigen Worten so großes Leid beschreiben lässt. Auch jetzt noch stehen mir die Augen voll Wasser, denke ich an den Bub von damals, der doch nicht wusste, was zu tun sei, und so dringlich wollte, dass jemand ihm helfe, den es leider nicht gab.
Ich weckte das Schwesterchen und sagte ihr, wir hätten etwas zu erledigen. Ich wollte nicht, dass sie den Vater auch noch tot sah. Zusammen liefen wir hinüber zu den Amanns, was das Erste war, das mir einfiel. Dort erzählte ich, was geschehen war. Er schickte einen seiner Söhne, nicht Peter, sondern einen seiner vier älteren Brüder, zum Vorsteher, der wiederum den Vogt aus Gaienhofen kommen ließ. Nicht lange dauerte es, da war eine rechte Runde versammelt. Der Vogt Hans Jäger samt vier Knechten, der Ortsvorsteher, Pfarrer Reuss und der eine oder andere Gaffer. Im Garten versammelten sich alle, das Haus zu betreten sei der pestilenzischen Lüfte wegen nicht angeraten. Nur die Knechte wurden mit Tüchern vorm Gesicht hinein geschickt, meinen Vater zu bergen. Sie beerdigten ihn auf meinen Wunsch hin nebst meiner Mutter und den Brüdern.
Was nun mit uns zu geschehen habe, war die Frage und wurde fleißig diskutiert. Zu unsereins in die Schweiz solle man uns schicken, wetterte Pfarrer Reuss, die rechte Strafe Gottes habe die Eltern dahingerafft, da unser Ketzertum hier nichts zu suchen habe. Dieser Bastard im Namen des Herrn, wie gerne wäre ich ihm im späteren Leben nochmals begegnet! Ob wir denn Familie hätten, wurde gefragt, und ich vermeinte, dass es wohl einen Vetter väterlicherseits in Frauenfeld gäbe. Ich wollte aber nicht dorthin, zumal ich ihn weder kannte noch wusste, wo er wohnte oder ob er überhaupt am Leben war. Ich wollte in unserem Haus bleiben, zusammen mit meiner Schwester, wollte bei den Eltern bleiben, auch wenn sie tot waren. Dem wurde jedoch nicht stattgegeben, zumal ich zu jung sei, auf uns aufzupassen, mein Vater zudem in den Schulden stand, die zu begleichen wir nicht in der Lage seien. Die Pacht unseres Hauses sei ebenso noch offen, weswegen es dem Rechte nach dem Vogt zufalle. Ob jemand denn bereit sei uns aufzunehmen, ob als Zögling oder Knecht?, fragte der Vogt. Worauf Pfarrer Reuss kräftig warnte, dass wir verderbt seien und wer uns aufnehme, Gefahr laufen müsse, dasselbe Schicksal meiner Eltern zu teilen. Das Mädel könne wohl bei ihnen bleiben, erbot schließlich Bauer Amann, und an der Reaktion seiner Frau ersah ich, dass er nur für sich gesprochen. An mich gewandt sagte er, mehr könne er nicht tun, habe er doch daheim genügend Mäuler zu stopfen. Ich kann es ihm auch heute noch nicht verdenken, mit seinen fünf Söhnen und dem Gesinde, welchem er Sorge zu tragen hatte. Und so wurde, trotz meines Widerspruchs und Klaras Gejammer, wie folgt beschlossen: Klara habe bei den Amanns zu verbleiben, derweil ich mit dem nächsten Kutscher nach Frauenfeld geschickt werden würde. Die Kosten der Reise erbot sich großzügig der Vogt zu übernehmen. Mitnehmen könne ich, was ich zu tragen imstande sei, der Rest falle an Vogt und Gläubiger. Wenn ich heute drüber nachdenke, hatten sie bestimmt einen guten Schnitt gemacht, denn war auch kaum Vorrat vorhanden, so blieb genügend an Inventar, blieb das Haus, was dem Hausrecht nach noch uns zustand, doch als der Bub, der ich war, verstand ich es nicht.
Tags drauf wurde ich fortgeschickt. Packte in einen Reisesack, so viel ich schleppen konnte, Kleidung, allerlei Geschirr, Schlageisen samt Feuersteinen, Kerzen, Werkzeug und die Reste des Vorrats. Den Überstand und alles, was mir irgendwie von Wert und nutzbar erschien, brachte ich den Amanns. Sollten lieber sie es haben als der Vogt. Als die Zeit zum Aufbruch kam, gab mir der alte Amann die Hand und sprach mit Ernst: Auf dein Schwesterlein pass ich gut auf, Kaspar, darauf mein Wort. Wenn du deinen Weg gemacht hast, komm zurück, und meine Tür steht offen. Worauf er mir zehn Kreuzer in die Hand drückte, doch so, dass keiner es sah. Die arme Klara weinte bitterlich, mitkommen wolle sie und bei mir bleiben, bettelte sie, rief meinen Namen unentwegt, und mein Herz sticht, denke ich daran. Ich nahm sie in den Arm, gab ihr einen Kuss und versprach, baldmöglichst zurückzukommen. Ein Versprechen, das ich brach, vielleicht meine erste wahre Sünde, wenn auch freilich nicht die letzte. Und noch heute lastet die Schuld schwer wie ein Bußstein auf meiner Seele, stelle mir vor, wie sie auf mich wartet, Tag um Tag und stets vergebens.
Da saß ich nun also hinten auf jener Kutsche, zwischen allerlei Post und Ware, welche der Kutscher seines Weges lang zu verteilen hatte, und sollte zu einem Ort reisen, den ich nicht kannte, eine Person suchen, die ich nicht kannte, und fühlte mich so allein, wie ich es in der Tat auch war. Weißt du, wie sich Einsamkeit anfühlt, lieber Leser? Ich sage dir, ich weiß sogar, wie sie schmeckt! Bitter und kalt schmeckt sie. Ein Geschmack, an den man sich gewöhnen kann, doch nie vergisst. Warum ich dann tat, was ich tat, kann ich dir retrospecti kaum erklären. Die Kutsche jedenfalls hielt in einem kleinen Ort vor Stein, und der Kutscher brach auf, seine Sachen an den Mann zu bringen und Neues aufzunehmen. Da packte ich meinen Sack mit Hab und Gut, sprang von der Kutsche und türmte. Ich erinnere mich an die Verwirrung, die in mir herrschte, die mich kaum klar denken ließ, und jenen Wunsch oder Drang, abzuhauen, allein zu sein, fern von allem und jedem. Vielleicht wollte ich einfach die äußeren Gegebenheiten dem inneren Empfinden angleichen. Und so lief ich, so weit die Beine mich trugen, lief weg von Haus und Mensch und allem Menschlichen; lief in den Wald.