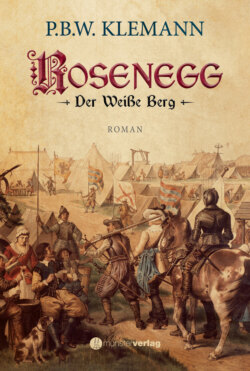Читать книгу Rosenegg - P.B.W. Klemann - Страница 12
Kapitel 3
ОглавлениеVom Leben und Treiben eines Hegauerischen Räubers
Nicht wenig staunte ich, lieber Leser, als wir nach langem Marsch durch dichten Wald endlich an jenem Ort ankamen, den die Ganoven “den Hort” nannten. Gleich seien wir da, wurde zuvor angekündigt, worauf einer der Räuber einen trefflichen Lerchengesang nachpfiff, unser Ankommen zu signalisieren. Ich sah mich um nach allen Seiten, versuchte kleine, schlecht gezimmerte Holzhütten oder notdürftige Zelte zwischen dem Geäst zu entdecken, sah aber weder noch. Wir kamen an einen steilen Hang, zu dessen Grund sich ein schmales Tal längs erstreckte. Ein kleiner Trampelpfad führte hinab, der Boden zertreten und zerstampft vom häufigen Gebrauch. Indessen wir jenem Pfad folgten, ersahen wir die ersten Menschen im Tal, hoben sie die Arme uns zum Gruße, als wir den Grund erreichten. Immer noch sah ich nichts, was einer Behausung glich, gleichwohl man dem Tal die Spuren menschlichen Daseins durchaus ansah. Geäst und Gestrüpp waren kaum vorhanden, und das Bächlein, welches sich durchs Tal schlängelte, umsäumte, dort wo die uns Grüßenden standen, eine Lichtung, die von Menschen erzeugt aussah.
Als wir diese schließlich erreichten, konnte ich kaum glauben, was ich da erblickte. Da staunste, was?, lachte der breite Räuber, der sich mir als Sebastian Singer vorgestellt, und erbot mir Führung an. Und in der Tat redlich gearbeitet hatte die Bande, denn ihre Behausung war in die Felswand hineingeschlagen und gebaut, welche zu großem Teil aus gutem, festen Sandstein bestand, der sich trefflich bearbeiten ließ und welchen sie bis tief unter die Erde ausgehöhlt hatten. Doch hatten sie nicht schlicht eine Höhle gegraben, sondern gleich mehrere Räume ausgehoben, manche groß und weit, dass viele Mann stehend Platz gehabt, manche nieder und kleiner, etliche bis tief unter die Erde, hatten selbige zudem durch Gänge und Flure miteinander verbunden, dass es mir im Ganzen wie ein unterirdischer Palast vorgekommen. Auch waren diese Räume trefflich ausgebaut mit dicken Stämmen als Stützbalken, dicke Holzleisten als Querbalken, ebenso ausgestattet mit aus Holz gezimmerten Türen, mit Schränken, Tischen, Stühlen und allerhand anderem Mobiliar. Und alles war gut eingeteilt, gab es einen eigenen Raum zum Kochen, einen Wohn- und Speiseraum, mehrere Schlaf- und Lagerräume, außen eingelassene Holz- und Feuerstätten, einen Stall, bestückt mit Schweinen und Hühnern, sogar einen Brauraum, in dem ein dickes Fass mit Bier gärte, in summa also ein Unterschlupf, wie ihn sich der Räuber nur träumen kann.
Nun wirst du dich freilich, genau wie ich damals, fragen, wie eine solche Bande Derartiges bewerkstelligen konnte? Da dies ja kaum Usus in der Räuberwelt sein könne. Und die Antwort auf diese Frage lautet: Lutz Wagner. Mag dieser Mann zweifellos ein rechter Schurke und Gauner gewesen sein, ein Dieb und Mörder und vieles mehr, war er doch ein hervorragender Kommandant und Anführer. Dem Ursprung nach kam er aus Bremen, was man ihm deutlich anhörte, ich hier jedoch zu imitieren unterlasse. Seit er fünfzehn Jahre zählte, hatte selbiger als Söldner gedient, in Holland, in Venecia, sogar bis nach Ungarn sei er gekommen. Zuletzt kämpfte er beim Erbkrieg “des Reichen” zu Jülich anno 1609 auf Seiten der Union, wo er, wie er es ausdrückte, es wohl zu prächtig getrieben habe. Der Galgen hätte ihn und seine drei Kameraden erwartet, weshalb zu türmen ihnen das Beste erschienen. Seither führten sie ihr Räuberdasein, und aus den anfänglichen vier Halunken waren, als ich zu ihnen stieß, dreiunddreißig Mann und ein Dame geworden. Die Jahre in der Armee hatten ihn zu führen gelehrt, wenngleich ein entsprechendes Naturell wohl schon von Gott gegeben sein Eigen war. Und während er in der Armee kaum je zum Hauptmann, seiner gewöhnlichen Herkunft wegen, ernannt worden wäre, herrschte er hier wie ein König. Ein fleißiger König, wohlgemerkt, der ohne Unterlass nach Besserung suchte, Proviant und Lagerbestand organisierte, Streifzüge plante, dieses zu bessern und jenes zu unterlassen befahl, dabei oftmals auch selber die Ärmel krempelte. Der untätige Soldat ist ein toter Soldat, sprach er oft und hielt sich tunlichst daran. Selbst im Winter, als der Martini schon längst überschritten war, stellte er allerlei Aufgaben, vor allem zum Ausbau unseres Heims, ließ Fenster und Türen dichten, Böden auslegen und allerlei Haushaltiges wie Schustern, Nähen, Waschen und Putzen. Freilich wurde mal gemurrt und gestritten, wollte der eine dieses, der andere jenes nicht machen, doch wagte keiner, sich seinem direkten Befehl zu widersetzen. Zumal er die Leute gut nach ihrer Fasson arbeiten ließ und ihren Fähigkeiten entsprechend. So gab es zum Beispiel Egon Reichenbacher, der zuvor lange Bäcker gewesen und nunmehr unser Küchenchef war; die Brüder Werner und Andreas Linz hatten als Jägerskinder den Posten der Jagdmeister inne; der Sebastian, mein erster Vertrauter und im Späteren mein Freund, der zu schmieden gelernt, durfte sich dementsprechend betätigen. Ferner hatten wir einen Werner als Schreiner, einen Willfried als Schneider, einen Emil als Wasenmeister und dergestalt noch viele mehr, dass uns an keinem Können etwas ermangelte. Eine Hierarchie gab es freilich auch, welche im Groben besagte, wer länger dazugehörig, der auch im Range höher. Und war solche Regel auch mal mehr, mal weniger streng ausgelegt, so in ihrer obersten Maxime jedoch, wer nämlich an unserer Spitze stand, ohne jeden Kompromiss. Der Wagner unser Hauptmann und seine drei Kriegskameraden Hans Schuhmann, Volker Brand und Gustav Stätter unsere Korporale, wie wir sie nannten.
Nun kann sich der Leser sicherlich vorstellen, wie es um mich die erste Zeit bestellt war, konnte ich doch kaum mit vortrefflichem Wissen oder Können aufwarten, war zudem das neueste Mitglied und obendrein noch jung an Jahren. Bücher gab es freilich keine, die ich hätte vorlesen können, musste daher anderweitig sehen, wie mich zu Nutzen zu bringen. Hinzu kam ein anfänglich gehöriger Respekt vor diesem wilden Haufen, so dass ich einfach fleißig alles tat, was mir aufgetragen, nie wagte, mich querzustellen. In Folge musste ich also mächtig buckeln, musste hier in der Küche, dort beim Ausbessern helfen, Unrat hinaus- und Holz hineinbringen und solcherlei vieles mehr, dass ich kaum mehr zur Ruhe kam. Amon, der Finsterling, Elbers mit Namen, der mir auch nach besserem Kennenlernen nicht sympathischer wurde, gehörte zu den übelsten Tyrannen, und er war es auch, der auf den gar witzigen Einfall kam, mich “Lakai” zu taufen, was vom Rest der Bande bald übernommen. Lakai, mach dieses, Lakai, tu jenes, erklang infolge unentwegt, dass ich schließlich auf Lakai wie auf meinen Namen reagierte.
Harte Arbeit war ich allerdings schon von meiner Zeit alleine im Walde gut gewöhnt, dass ich, nachdem meine Angst vor diesen Gesellen sich etwas gelegt, mich recht gut einlebte. Speis und Trunk war von weit besserer Qualität, als was ich vormals genossen, und wurde ich auch ordentlich gedrillt und gescheucht, gewann ich alsbald auch Freundschaften. Nebst Sebastian, den hier alle Bastian nannten und welcher sich wohl zum Ziel gemacht, mir beizustehen, zumal sein Zutun mich der Bande beigesteuert, kamen bald sein Kamerad Richard Wengenroth, Küchenmeister Egon, dem ich so fleißig zur Hand ging, unsere Jägersbrüder und Ottilie Zahner, die Dame unserer Gesellschaft.
Auch wenn ich hier nicht alle Personen ausführlich behandeln kann, mit welchen ich in jener Zeit Quartier hielt, da dies zum einen wohl zu viel der Information für dich lieben Leser wäre, zum anderen der größte Teil keinen größeren Einfluss auf diese Historie haben wird, will ich dir doch über jene mir wichtigsten Charaktere Zeugnis geben sowie Erklärung, was sie mit mir zusammen in den Wald verschlagen.
Zuvorderst sei Bastian hier gezeichnet, ein wie geschildert kräftiger Bursche, drei Jahre älter als ich, ein ordentliches Stück größer, vor allem aber breit wie ein Ochse, mit mächtigem Brustkorb und dicken Armen. Sein pausbäckiges Gesicht, was der Jugendlichkeit noch nicht gänzlich entwachsen war, wurde von einem kümmerlichen Bart von rötlichem Blond bedeckt, während sein Haupthaar eher ins Bräunliche ging. Von Wesen zumeist fröhlich, fast unbeschwert, konnte er doch, so ihn jemand zu reizen vermeinte, aufbrausend, gar hitzig werden und scheute in solcher Gemütslage keine Auseinandersetzung. Die meiste Zeit aber war er der angenehmste Zeitgenosse, redete gern und viel und wurde schnell gut Freund mit jedermann. Als Sohn von Tagelöhnern entschied sich der junge Bastian, einem handfesten Berufszweig nachzugehen, begab sich dergestalt bei einem örtlichen Schmied in die Lehre, der selbst kinderlos geblieben. Jenes schickte sich wohl auch trefflich an, und nicht ohne Begabung und Leidenschaft ging er jenem Handwerk nach. War sein Lehrmeister auch vornehmlich ein Huf- und Nagelschmied, übte sich Bastian alsbald ebenso an der Kunst der Waffenschmiederei, probierte sich an Messern und Dolchen, an Schwertern und Hauben und manchem mehr. Einen altertümlichen Bidenhänder hatte er sich selber geschmiedet, mit guter, gerader Klinge und ledernem Griff, den er stets bei sich trug und sorgfältig pflegte. Aus Resten hätte er ihn sich zusammengeschmiedet, sei der Stahl daher nicht gerade der beste, werde er sich eines Tages aber einen ebensolchen aus feinstem gutem Stahl schmieden, kündete er. Manchen Spott erntete der Bastian damit. Fragte ihn dann etwa einer, was er denn mit solchem Kuhschlächter anfangen wolle?, oder ein anderer, ob er damit zum Holzhacken gehe? Der Bastian allerdings zuckte jedes Mal nur mit den Schultern und sagte etwas wie: Benutzt ihr nur eure Zahnstocher. Wenn ich zuschlag, will ich sicher sein, dass mein Gegenteil nimmermehr aufsteht. Wenn er einstmalen sich einen ordentlichen Brustpanzer hergestellt habe, dann sollen sie nur kommen mit ihren Degen und Rapieren, vermeinte er selbstbewusst. Die Schmiedekunst blieb seine Leidenschaft, und gern gab er seine Meinung kund zu Degen oder Dolchen, zu Hauben oder Harnischen und allem andern, welches einer Schmiedewerkstatt entspringt. So gut wie alles könne er schmieden, so er denn die erforderliche Ausstattung habe, gab er sich selbst Zeugnis. Und da derlei Kunstfertigkeit zu allen Zeiten sich guter Nachfrage erfreut, wäre diese Vitae freilich eine sichere Wahl gewesen, hätte Bastian nicht beschlossen, nebst seiner Lehre den eigenen Verdienst ein wenig aufzustocken. So verdingte er sich mit einigen anderen Burschen seiner Umgebung, darunter auch genannter Richard Wengenroth, als Pferdedieb. Kurz und gut, die Sache flog auf, wurden die beiden während eines Raubzugs gesehen und erkannt. Der örtliche Vogt, ein räudiger Hundsfott, wie Bastian sagte, erfuhr von der beiden Namen, und als er seine Schergen aussandte, sie festzusetzen, sahen sie ihr Heil in der Flucht, was zweifellos ein weiser Entschluss gewesen, denn kurz danach erfuhren sie, dass drei ihrer alten Freunde den Hals gestreckt bekamen. So schlossen sie sich jedenfalls unserer Räuberbande an, hatten sie schon zuvor, während der Ausübung genannter Tätigkeit, Lutz Wagner kennengelernt, der sie nun freudig aufnahm, standen sie doch guten Fußes mit den hiesigen Pferdetreibern und Pferdehändlern, denen sie vormals ihre Beute verkauft.
Als Nächster sei hier der alte Egon beschrieben. Alt nannten wir ihn, zumal er alt war, denn gut fünfzig Jahre hatte er auf dem Buckel, was mir, wenn ich heute darüber nachdenke, nun gar nicht mehr so alt vorkommt. Damals erschien er mir in jedem Falle uralt, mit seinem grauen Haar, seiner großen Glatze und dem faltigen Gesicht. Ein breiter, buschiger Backenbart zierte sein Gesicht, wie es damals in den bayrischen Landen Mode war. Egon entsprang einer alten Bäckerfamilie aus Ulm und praktizierte entsprechend viele Jahre lang jenes Handwerk. Dies tat er nicht ohne finanziellen Erfolg, was vornehmlich daran lag, dass er die Kunst beherrschte, aus wenig Mehl viel Brot zu backen. Das Geheimnis dieser Kunst, was er bereitwillig allen Fragern mitteilte, bestand in dem Verfeinern des Mehles durch Zumischen verschiedenster Ingredienzien, allen voran sehr fein gemahlenes Sägemehl. Des Weiteren streckte er Weizen mit Gerste, Hafer mit Roggen und dergestalt einiges mehr, und freilich stets zu seinem Vorteil. Dieses Spielchen trieb er etliche Jahre lang, bis er schließlich doch erwischt und endlich vor den Richter musste. Zur Ehrenstrafe wurde er verdonnert, drei Tage an den Schandpfahl gebunden und ihm sein Handwerk gelegt, verlor alle Rechte seiner Zunft. So stand er plötzlich ohne alles da, und da er weder Frau, von welchen er zwei beerdigt, noch Kind, von welchen er die gleiche Zahl beigesetzt, besaß, hielt ihn nichts in seiner Heimat. Als Tagelöhner zog er durch die Lande, von einem Ort zum nächsten, und alles, was er verdiente, er in Bier und Wein in den Wirtshäusern investierte. In einem solchen lernte er eines Tages auch den Hauptmann kennen, und selbigen Abends noch schloss er sich im Rausche seines Angesichts diesem an. Zum Küchenmeister wurde er bald befördert, und die Küche wurde zu seinem Herrschaftsgebiete. Alsbald hatte er einen ordentlichen Backofen in den Fels gehauen, breit und flach, in dem er treffliche Brote und Fladen backte, wobei ich ihm oftmals behilflich war. In großen Töpfen kochte er uns Suppen und Eintöpfe aus guten Zutaten, mit Fleisch und Rüben und Zwiebeln, würzte gut mit Salz und Schmalz. Im Sommer gab es oft Wildbret, gab es Reh und Wildsau und manchen Vogel, am liebsten aber war ihm Hase, den er mit Zwiebeln und Möhren lange garte, der schmeckte, dass mir noch heute das Wasser zusammenläuft im Maul und mich an seine Art solchen zu essen gedenken lässt, wie er die Knochen nagte, dass kaum etwas übrig geblieben. Zur Schlachtzeit holten wir uns frisches Schwein und Blutwurst, was er dann im großen Kessel kochte, mit reichlich Kraut dazu. Angerichtet ist’s, Jungens!, sagte er dann immer, und Jungens nannte er uns alle, selbst den Wagner. Ein guter Koch war er, und gerne denke ich an jene nahrungsreichen Zeiten zurück, sehe uns an unserem großen Tisch beisammen sitzen und von unseren hölzernen Tellern speisen und sehe sein fröhliches, rotes Antlitz vor mir, wenn man das Essen lobte.
Nun seien die Jägerbrüder vorgestellt, Werner und Andreas Linz. Brüder waren sie freilich, wenn auch von zwei Müttern, denn Werner, dem Älteren, seine starb bald nach seiner Geburt. Weshalb sich wohl auch ihr gänzlich verschiedenes Aussehen erklären lässt, war der Ältere braunhaarig und kräftig, von guter Konstitution und hohem Wuchs, derweil der Jüngere blonden Haares war, eher zierlich und schlank, mit glatten, sanften Gesichtszügen. Treffliche Jäger waren sie beide, und oftmals nahmen sie mich mit, lehrten mich das Fallenstellen, Strickfallen für Hase und Fuchs, Stock- und Peitschfallen für Reh und Sau, lehrten mich die Fährten lesen, die Spuren der Tiere erkennen und ihren Dung unterscheiden, ferner das Bogen- und Armbrustschießen und noch vieles mehr, was die Jägerskunst erfordert. Und begierig nahm ich alles auf, hatte mich doch die Zeit allein im Walde gelehrt, wie nützlich derlei Wissen ist. Unsere Bande kannten die beiden schon geraume Zeit, bevor sie sich ihr selber angeschlossen, waren den Räubern bei ihren Streifzügen durch den Wald das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Das erste Mal, so erzählten sie mir, hätten sie freilich geglaubt, nun ordentlich gefleddert zu werden oder gar Schlimmeres, doch der Hauptmann habe sogleich Befehl gegeben, den guten Jägersleuten sei kein Haar zu krümmen. Im Gegenteil stellte er sich gut zu ihnen, kaufte fortan häufig Wildfang ihnen ab zu gutem Preis, dass sie in Folge, so sie guten Fang gemacht hatten, ihn gezielt der Räuberbande anboten. Solcher Umgang mit dem hiesigen Volk war ein Usus, welchen der Hauptmann häufig praktizierte, getreu dem Grundsatze, dem Nachbar besser Freund als Feind zu sein. Das Verhängnis, das den beiden Jägersleuten zuteil geworden, war eines, das vielen ihrer Zunft schon widerfahren, denn so sie auch leben konnten von dem ihnen zustehenden Weidwerk, vornehmlich Hasen, Enten, Rebhühnern und Wildsauen, fiel es ihnen doch schwer, das gute Reh oder gar den schönen Hirsch zu verschmähen, so sie dessen Wege kreuzten. In dem kleinen Örtchen zu Fuße des Hohentwiels, wo beide Heimat hatten, herrschten zu jener Zeit die Württemberger, und zwar mit strenger Hand, insbesondere was die Einhaltung des Jagdrechts anbelangte, weswegen, als sie in flagranti vom Burgjagdmeister beim Zerteilen eines prächtigen Zwölfenders gesichtet wurden, die schlimmsten Strafen zu erwarten waren. Sie eilten heim, verabschiedeten sich dort von ihren anderen zwei Brüdern und dem kleinen Schwesterlein, gaben der Mutter einen Kuss und marschierten schnurstracks zum Wagner, um Asyl zu bitten, was dieser gerne gewährte.
Als Letztes sei der Werdegang der einzigen Dame hier beschrieben, Ottilie Zahner, von allen nur die Witwe oder Wittib genannt und nebst unserem Hauptmann, dessen Name sich in der Hegauer Gegend schon gewisser Bekanntheit erfreute, die berühmteste Person der Unsrigen. Sie entstammte aus einem kleinen Dorf bei Tuttlingen, Neuhausen ob Eck genannt, und war die Frau eines erfolgreichen Ziegelbrenners. Zwei Kinder hatte sie diesem geschenkt, einen Bub und ein Mädel, erfreuten sich guten Wohlstands, so gut, dass sie acht Knechte und vier Mägde als Gesinde aushielten. Ich habe ihre Geschichte aus ihrem eigenen Munde vernommen, wenngleich ich sie schon zuvor in den haarsträubendsten Varianten von anderen erhört hatte, wurde die Historie doch unter den Räubern mit Freude erzählt und ausgeschmückt, besonders Neuankömmlingen gegenüber, die sich über die Frau verwunderten. Eines Tages jedenfalls, so erzählte mir die Witwe, kam sie von ihrem Elternhaus früher heim, hatte sie irgendwas vergessen oder dergleichen, sah durch das Küchenfenster und fand ihren Mann mit einer jungen Magd inmitten des Küchentischs beim Liebesspiel. Alles habe sie ihm gegeben!, wie sie, die Witwe, es sagte, allein das Sprichwort missachtet: “Stellt der Mann ein Mägdlein ein, so sollt dies besser hässlich sein!” In die Küche sei sie gestürmt, ihn zur Rede zu stellen. Doch statt den bußfertigen Sünder zu geben und auf getrockneten Erbsen gen Canossa zu ziehen, bedachte dieser die Gehörnte mit abfälligem Sprüchlein und ordentlicher Maulschelle obendrauf. Schlecht muss der Leichtfertige sein eigenes Weib gekannt haben! Der Witwe Reaktion jedenfalls fiel ungleich heftiger aus. Schon hatte sie das nächstbeste Hackebeil gegriffen und verfuhr mit dem Treulosen wie der Fleischer mit der Herbstsau. Holzkopf hab ich ihn immer genannt, sein Schädel aber ließ sich leichter spalten als jeder Schweins- oder Kalbskopf, sagte sie mal. Ihren Liebhaber derart traktiert zu sehen, habe das Mägdlein zu schreien angefangen, dass man es im Nachbardorfe noch gehört haben mag. Erst da sei der Witwe klar geworden, was ihr nun bevorstand, welche Tat sie begangen. So flog sie aus, so, wie sie war, ohne Hab und ohne Plan, und wurde vor Ort niemals wiedergesehen.
Dass ihre Historie endlich die gewaltigen Wellen schlug, die sie schlug, und der Witwe regelrechte Berühmtheit in ihren Landen bescherte, indessen sie alleine durch die Wälder streifte, mag durchaus am Zeugnis jener Magd gelegen haben, welche nämlich folgend steif und fest behauptete, nur ganz zufällig in gemeldete Küche gelangt zu sein und dort zu ihrer schrecklichsten Überraschung die Witwe beim Zerlegen ihres Mannes erwischt habe. Nicht lange dauerte es, da wurde die Witwe als Hexe und Teuflerin verschrieen und ausgerufen, ihre Geschichte immer weiter verfeinert und ausgeschmückt, wie bei derlei Historien nun mal zumeist und mannigfaltig geschieht; dass sie ihren Mann verzaubert und verhext habe, seine Leiche zu verspeisen gedachte oder gar ihren Gästen vorzusetzen, dass sie ohnehin schon immer verdächtig und wunderlich gewesen, man sie bei dieser Zauberei und jenem seltsamen Verhalten gesehen habe. Und solcherlei noch etliches mehr, dass man sich in summa also bald einig war, was selbige doch für ein absonderliches und liederliches Hexenweib gewesen sei. Von Ort zu Ort wurde ihre Geschichte getragen, dass sie schließlich fast zur Legende wurde in unseren Hegauer Landen. Hochtrabende Namen erhielt die Witwe: das Satansweib, die Schlächtertilie, die Teufelswitwe und dergleichen mehr. Ein Kopfgeld wurde ausgesetzt, und Tuttlinger Schergen visitierten Häuser, Wald und alles, wo sie die Witwe zu finden hofften, beließen dabei kaum einen Stein unumwendet. Die Witwe aber hielt sich fern von ihrer alten Heimat, war gewarnt durch die vielen Zeitungen über ihre Person, schlich durch die Wälder von hier nach dort, bis sie schließlich von unserer Räuberbande aufgegabelt wurde. Wagner nahm sie in die Bande auf und bald darauf auch in sein Bett, was ihr sicherlich zugute kam, denn der eine oder andere Schurke mag gierig auf das Kopfgeld gewesen sein, hernach bekannt geworden, wer sie in persona. So aber schützte sie der Wagner, der schnell redlichen Gefallen an ihr fand, an ihr selbst wie an ihrem Renommee.
Eine schöne Frau war sie, wenngleich ihre Schönheit erst auf den zweiten Blick sich offenbarte, um die vierundzwanzig Jahre muss sie damals gezählt haben, als ich zu ihnen stieß, mit glatter Haut und kantigen Gesichtszügen, goldenem Haar und blauen Augen. Ich frug sie mal, ob sie bereute, was sie getan, worauf sie mich lange ansah und dann sagte: Bist der Erste, der mich das fragt. Sie dachte eine Weile nach. Vielleicht hätte sie dem Dirnchen noch selbige Behandlung zukommen lassen sollen wie ihrem Mann, vermeinte sie dann im Spaß, um gleich darauf ernst hinzuzufügen, um ihre Kinder dauere sie es sehr wohl. Sie nicht mehr sehen zu können, sie nie wieder sehen zu können. Vielleicht waren es ihre mütterlichen Gefühle, die sie so große Sympathie für mich hegen ließen, denn sie gab gut Acht auf mich und schaute stets, dass mich die anderen nicht zu arg traktierten. Und von Gewicht war ihr Wort unter den Räubern, genoss sie ordentlich Respekt, und keiner wagte, sie zu kommandieren.
Obzwar ihre Version des Geschehenen unter uns Räubern durchaus bekannt war, vermeine ich, dass mancher sich dennoch fragte, ob nicht mehr dahinter stecke, ob nicht am Ende doch stimme, was die Magd und das Volk so erzählten, und endlich auch, ob nicht, wie es in unserer Zeit so gerne vermutet und auch angenommen wird, der Teufel seine listigen Finger im Spiele habe. Und so schaute mancher gewiss zwiespältig auf die Witwe, und des einen oder anderen Mals wurde ich gewahr, wie hinter ihrem Rücken getuschelt wurde und auch jenes eine Wort fiel, das so leicht ausgesprochen und umso viel schwerer zurückgenommen ist: “Hexe!” Und ich muss gestehen, dass ich selber anfänglich mir gleichfalls die Frage stellte, ob es bei ihr nicht doch mit dem Teufel zugehe.
Noch gut kann ich mich an den Fall erinnern, als einst die Witwe einen Neuling zum Küchendienst abkommandieren wollte, dieser aber vermeinte, Weiberarbeit sei solches, warum daher die Witwe Befohlenes nicht selber verrichte. Da zog sie ihr langes Messer, das sie stets an der Seite trug, hielt es ihm vor das Gesicht und vermeinte, dass sie als Weib freilich gerne koche, am liebsten Zunge, weshalb sie wohl in der Nacht ihn um die seine zu erleichtern gedenke, damit die anderen kosten mögen, wie solch räudige Zunge schmecke, und damit zog sie ab. Oje, meinte darauf einer der Korporale, Hans Schuhmann war’s, mit besorgtem Ton: Da hast dir aber üble Suppe eingeschenkt. Worauf die anderen eifrig nickten. Der Neue meinte trotzig, dass er doch keine Angst vor einem Weibe habe. Ob er denn nicht wisse, mit wem er sich da eingelassen?, fragte man ihn, was dieser verneinte. Worauf sie ihm erzählten wer die Witwe sei, was ihr zu Lasten gelegt und was man über sie so erzählen würde. Unterließen dabei freilich nicht, ihre Berichte auf das Prächtigste auszuschmücken und auf das Bildlichste zu schildern und obendrauf mit allerlei Grausamkeiten zu würzen, dass Menschenfleisch zu kredenzen ihre größte Freude sei, dass keiner wirklich sagen könne, wie viele sie schon geschlachtet und verfressen, und dieser Art noch vieles mehr, versuchte ein jeder die Geschichte seines Vorredners an Graus und Schrecken noch zu übertrumpfen, dass der arme Kerl endlich ganz weiß um die Nase geworden. Ja ob denn keiner etwas gegen die Hexe zu unternehmen gedächte?, vermeinte dieser darauf. Gegen die Witwe?, erwiderte der Schuhmann und streckte die Handflächen von sich. Bin doch nicht des Lebens müde! Mit der will ich keinen Händel. Musst die Suppe, die dir eingebrockt, schon allein löffeln. Man sah ihn noch eine Weile sitzen in Gedanken versunken, doch bald erhob er sich und ging wortlos in den Hort. Na, wo ist er auch hin?, fragte dann einer spöttisch, und der Schuhmann erwiderte: Meinen rechten Arm, dass ihn in der Küche findest. Worauf wir alle lachten.
Übertrieben hatten sie freilich und sich ihren Spaß gemacht, und dennoch war der Respekt ernst gemeint, zumal sie gern mit ihrem Ruf kokettierte, die Witwe, war er Schild und Drohung zugleich, und lachen muss ich, denke ich an den Burschen, wie er die nächsten Nächte geschlafen haben muss, die beiden Hände vor das Maul geschlagen. Doch sei dem Leser hier versichert, denn ich lernte sie gut kennen und viele Jahre war sie an meiner Seite, dass alles Gerede und üble Unterstellung kein Fünkchen und kein Korn an Wahrheit enthielten, so wahr mir Gott helfe, sie e contrario ein trefflich Weibe war und gute Kameradin. Gottesfürchtig war sie zudem, besaß sie einen hölzernen Rosenkranz, den sie versteckt im Beutel immer mit sich führte, habe ich sie oft heimlich beten sehen und jenen küssen, so die Zeiten schwierig waren, ob im neuen oder alten Glauben habe ich nie erfahren, auch nie gefragt.
Mit den genannten und weiteren Gesellen fristete ich also mein Dasein, lernte schließlich auch das Räuberhandwerk, und kaum einen besseren Lehrer als den Wagner hätte ich mir wünschen können. Auch diesem will ich hier in kurzen Zügen ein Bildnis zeichnen, auch wenn genannter Steckbrief schon gute Vorarbeit geleistet hat. Verwegen war sein Antlitz, dies Wort trifft es gut, denn Abenteuer und Draufgängertum standen ihm ins Gesicht geschrieben, mit jenen kleinen stechenden Augen, den spitzen Brauen und schwarzen Haaren, das Gesicht kantig und symmetrisch, nur durch die Schmarre linkerseits entstellt, was ihm jedoch nicht zum Nachteil geruhte, sondern im Gegenteil das Wilde seines Charakters zu unterstreichen vermochte. Ein Andenken aus Ostende, nannte er seine Narbe, die ihm ein Spanier während der Belagerung jener Stadt hinterließ. Er lachte viel und gern, hatte ihn das harte Soldatenleben nicht der Lebensfreude berauben können, wobei sich sein breiter Knebelbart, den er trug, wie es damals die Mode war, dann zu beiden Seiten nach oben bog. Großen Wert auf Äußerlichkeiten legte er bei sich, eitel mag man es nennen, rasierte sich oft und zwirbelte den Bart sich spitz, fand Gefallen an schöner Kleidung, wie weiten und farbigen Pluderhosen und gut genähten Röcken mit weit geschnittenen Ärmeln und breitem, rüschigem Kragen, besaß er eine große Truhe voll teurer Kleidung. Der Umfang seines breitkrempigen Hutes suchte seinesgleichen und die Länge seiner Feder konnte es mit der manchen Edelmannes aufnehmen. Seine ledernen Stiefel liebte er sauber und eingefettet, eine Aufgabe, mit der er fortan mich betraute und gehörig die Leviten las, so ich sie nicht zu seiner Zufriedenheit erfüllte. Ein langer Spanischer Degen, ebenfalls Kriegsbeute, während seiner Zeit bei den Holländern, schwang an seiner Seite, und trefflich damit umzugehen verstand er. Er mochte mich, so glaube ich, und ich auch ihn, sucht der junge Geist sich doch den starken Charakter aus zur Orientierung. Wie ein Edlendiener schwänzelte ich um ihn herum, war stets zur Stelle, so er etwas brauchte, freute mich, wenn er mir lobend den Kopf tätschelte, und grämte mich, wenn er mich schimpfte. Und gefallen ließ er sich mein Dienertum, behandelte mich ordentlich und lehrte mich dabei auch allerhand.
Jener selbst war es, der mich im Umgang mit den Waffen unterwies, lehrte mich ein wenig Fechten, auch wenn mein Talent, wie ich gestehe, nicht übermäßig war. Besser stellte ich mich mit der Muskete an, die er mich auch zu nutzen lehrte, wenngleich wir uns nur mit kleinster Ladung zu schießen trauten, macht eine Muskete doch, wie der Leser vielleicht weiß, einen gewaltigen Knall. Er zeigte mir, wie mit einer Lunte umzugehen, wie sie zu halten und die Glut versorgen, dass man sie an beiden Enden anzuzünden habe, damit, falls die Lunte beim Schuss ausgehe, man sie verkehrt herum aufziehen könne. Lehrte mich die Pfann gut zu füllen mit Zündkraut, Pulver und die Kugel ordentlich zu stopfen. Ermahnte mich des fleißigen Ausblasens von Pfann und Rohr, dessen Unterlass schon manch einen Leben oder Augenlicht gekostet hat. Übte mich, wie das schwere Gewehr zu halten und zu legen sei, zeigte mir, wie damit zu zielen. Auch durfte ich mich an seiner schönen Pistole probieren, einem prächtigen Stück mit fein gearbeitetem Schlosse, das er einem Edelmann abgenommen.
Sobald der Winter vorüber war und das Wetter sich besserte, ging ich mit los auf Streifzug. Mit ungefähr zwanzig Mann zogen wir dann aus für einige Tage, kümmerte sich der Rest indessen um den Hort oder trieb Handel mit den umliegenden Dörfern. Es war allen streng verboten, in naher Gegend Räuberei zu betreiben, sondern im Gegenteil hatte der Hauptmann bestimmt, dass sich gut zu benehmen sei; keinem Bauern wurde auch nur ein Korn gestohlen, keinem Händler zu nahe getreten, keiner Magd nachgestellt. Ordentliche Preise wurden gezahlt und zu guten Preisen verkauft. Was Folge hatte, dass unsere Bande sich keines allzu schlechten Rufes erfreute, gute Kontakte und Handel pflegen konnte, teils sogar bewundert und beschützt wurde vor der Obrigkeit. Kaum waren wir aber eine Tagesreise von daheim entfernt, begannen wir unser Tagewerk, welches schwerlich rühmlich gelten kann. In Gruppen schwärmten wir aus entlang gut befahrener Waldwege, hielten Ausschau nach Reisenden, nach Kutschen und Konvois. Hier lernte ich, wie zu kommunizieren über Pfeifgesang, die Lerche, sich zu sammeln, die Amsel, wenn man Beute fand, die Drossel, so Gefahr im Verzug, wie zu orientieren im Walde, die Himmelsrichtungen bestimmen über Sonne und Moos, Fährten und Geräusche deuten. Viel half mir damals meine vorherige Lehrzeit im Wald, die mich gut anstellen ließ und mir manches Lob einbrachte.
Endlich lernte ich auch, wie ein Überfall vonstatten ging, und gut kann ich mich des Kitzels entsinnen. Eine Händlerkolonne sollte meine Premiere sein. Zwei Kutschen waren es samt einigen Maultieren im Anhang. Von Weitem hatten wir sie kommen sehen, und eiligst wurde in Fahrtrichtung eine Barrikade aus Holzstämmen und Gestein aufgestellt, hinter einer Biegung verborgen. Als die Kutschen um die Biegung kamen, muss ihnen schnell klar gewesen sein, dass Unheil drohte, doch schon sprangen die Unsrigen hinter den Bäumen hervor, verstellten die Kutschräder mit Holzklötzen, dass die Wagen weder vor noch zurück konnten, und drohten mit den Waffen. Ich wurde als Späher eingeteilt mit dreien Weiteren, den Weg zu sichern, zu schauen, sollte jemand kommen, und zu verhindern, sollte jemand zu fliehen suchen. Mit lauter Stimme rief der Wagner dann seinen Spruch, den er, wie ich noch lernen sollte, in gleicher Manier bei allen Überfällen vorzutragen pflegte. Nicht nach dem Leben würden wir den guten Leuten, wie er es sagte, trachten, sondern nur nach deren Gut, und wären sie bereit, Letzteres herzugeben, solle ihnen auch Ersteres gelassen werden. Die Leute wurden aufgefordert, von den Kutschen abzusitzen und sich in Reihe aufzustellen, worauf sie durchsucht und gefleddert wurden und anschließend, von den Unsrigen bewacht, zuschauen durften, wie ihre Ladung geplündert wurde. Alles von Nutzen oder Wert wurde auf die Pferde geschafft, die, von den Kutschen befreit, uns als Lasttiere dienten. Die Maultiere wurden, wie sie waren, weggeführt. Zuletzt verkündete der Hauptmann noch, dass wer wage, uns zu verfolgen, sein Leben verlieren müsse, worauf wir abzogen.
Nach jenem Überfall war es auch, dass mir meine erste Beute zugesprochen wurde, ein schönes langes Messer samt lederner Scheide. Nichts Besonderes war es, hatte eine gute Klinge mit gut gearbeitetem hölzernen Griff, bestand die Scheide schlicht aus zwei Lederstücken, die zusammengenäht waren, doch mächtig stolz war ich darauf. Der Hauptmann gewährte mir die erste Wahl bei der Beuteverteilung, durften nach jedem Überfall sich die Beteiligten etwas aussuchen von den Gütern, die wir ergattert, von den Waffen, vom Schmuck oder der Kleidung, der Hauptmann als Erster in der Regel, die Korporale danach, der Rest nach abgesprochener Reihenfolge, wobei Letzteres mal besser, mal schlechter klappte und häufig auch manchen Streit zur Folge hatte. Doch jenes eine Mal durfte ich zuerst zugreifen, selbst vor dem Hauptmann noch, und so erwählte ich mein Messer. Und gute Wahl war es, will ich meinen, denn gut gedient hat es mir viele Jahre lang.
In der beschriebenen Art jedenfalls liefen die Überfälle meistens ab, und, ob du es nun glaubst oder nicht, lieber Leser, nur seltenst musste Gewalt angewendet werden und in meiner ganzen Zeit im Hegau musste kein Einziger der Überfallenen sein Leben lassen. Ich glaube, das Geheimnis bestand in Wagners ruhiger Art, die Sicherheit vermittelte, die Beraubten nicht das Schlimmste befürchten ließ. Er sprach ruhig, aber bestimmt, dass es als Wahrheit galt. Zudem sorgte er mit Strenge für die ordentliche Behandlung der Beraubten, wandte nur Gewalt an, so sich einer besonders widerborstig gab. Selbst handeln ließ er teils mit sich, denn oftmals begannen die Händler oder Bauern zu jammern und zu klagen, ob sie denn nicht dieses oder nicht jenes behalten könnten, da wurde der Wagner zuerst streng und forsch und stauchte sie ordentlich zusammen, das Maul zu halten sei, er ihnen die Zunge rausreiße oder Ähnliches, dann aber lief er auf und ab, scheinbar sinnierend, und gab schließlich seinen Kompromiss ab. Dass nur die Hälfte von jenem zu nehmen oder der dritte Teil von diesem zu lassen sei, und so fort. Nur die Pferde nahmen wir stets, duldeten hier keine Verhandlung, hinderte es die Beraubten, schnell Hilfe holen zu können, so wir fort waren, war zudem immer gutes Handeln mit den Tieren.
Manchen grämte es, wenn er sich großzügig zeigte, doch war es gute Strategie, verhinderte es doch, dass zu großer Groll entstand, dass uns zu hartnäckig nachgestellt wurde von der Obrigkeit. Dementsprechend ging unser Hauptmann besonders ehrerbietig mit Edelleuten um, so uns welche im Wald in die Netze gingen, was eher selten der Fall war, da diese häufig mit zu großer Knechtschaft zu verreisen pflegten und wir uns vor Bewaffneten meist hüteten. Geschah es aber doch, dass wir eine schöne Kutsche erspähten mit mäßigem Begleitschutze, so überfielen wir auch diese, und dann präsentierte sich der Wagner von seiner nobelsten Seite. Grüßte die Bedrohten mit größter Liebenswürdigkeit, zog den Hut und bat um Verzeihung für die kommenden Unannehmlichkeiten, um sie folgend von ihren Wertsachen und Pferden zu erleichtern. Sogar manch Kompliment entsprang dann seinen Lippen, beschied etwa einmal einer alten, hässlichen Gräfin so herrliche Schönheit, dass der Verlust ihrer goldenen Ohrringe und der Kette dem kaum Abbruch haben könne. Die alte Schachtel nahm es gar mit Entzücken.
Nun mag sich hier der Leser vielleicht gedenken, welch nobler, edler Räubersmann hier geschildert ist, welch gutmütige Seele hier vorgestellt, so gut und edel, dass sie kaum mit der Wahrheit korrespondieren könne, denn Räubertum ist Grausamkeit, ist Raub, ist Mord, ist Schändlichkeit. Und recht und unrecht hätte er zugleich, denn obzwar der Wagner wie beschrieben seine edlen Seiten besaß, sich seine Gaunereien in der Tat derart zugetragen haben, er meist verständig und vernünftig war, gab es auch die andere Seite in seinem Charakter, die herrische, bestimmende und sogar grausame. Tatsächlich scheint mir dieses ein Charakteristikum zu sein, das viele Männer seines Schlages eint, zwei Herzen in der Brust, das sorgende und gebende sowie das herrschende und fordernde. Auch in meinem Herrn vermeine ich Ähnliches erkannt zu haben, genauso wie im Maximilian, im Friedländer oder manch anderem großen Mann, den ich im Laufe der Zeit kennenlernen durfte, der hier im Späteren noch beschrieben sein wird.
So sei auch Zeugnis abgelegt von diesem Wesenszug des Wagners, dass du, lieber Leser, dir ein ganzes Bild machen kannst. Einmal etwa überfielen wir einen Grafen, der mit kleiner Eskorte reiste, vier Knechte an der Zahl. Hatten sie gut gestellt, an einem Weg, der beidseitig durch Felswände umsäumt war und keine Möglichkeit der Flucht hergab. Die Knechte wurden entwaffnet, und als es an die Plünderung ging, trat ein Graf mit Frau und Tochter aus der Kutsche. Wie es seine Art war, grüßte sie der Hauptmann freundlich und sagte seine Sprüchlein auf, da spuckte ihm der Graf mitten ins Gesicht und sagte: Treib nur dein Spiel, du Schuft, und dann bete, dass ich dich nicht in meine Finger kriege! Lange sah ihm der Wagner in die Augen, wich seinem Blick um keine Haaresbreite aus und wischte sich den Speichel ab. Nun wird deine Tochter den Preis für dein Maulwerk zahlen!, sprach er dann und befahl, den Grafen gut festzuhalten. Worauf er das junge Mädel packte, sie bäuchlings auf einen Felsen niederdrückte und sie vor den Augen des tobenden Vaters und der jammernden Mutter schändete. Ich blickte zur Witwe, in Sorge, wie sie es nehmen würde, sah sie allein herzlich grinsen. Danach fledderten wir sie bis auf das letzte Hemd, steckten ihnen zuletzt noch die schöne Kutsche an.
Mit besonderer Härte ging der Hauptmann gegen andere Räuberbanden vor, ließ nicht zu, dass sich eine andere Bande auch nur in der Nähe unseres Waldes niederließ. Als solches mal erfolgte, wir erfuhren, dass eine Bande von zwölf bis fünfzehn Mann sich im Wald aufhielt, brachen wir mit voller Mannschaft und kräftiger Bewaffnung auf. Wir stellten sie bei ihrem Unterschlupf, hatten sie gut von allen Seiten umzingelt. Dann trat der Wagner vor sie hin und fragte, was sie in seinem Wald zu schaffen hätten und wer ihr Anführer sei? Ein großer, furchteinflößender Bursche meldete sich als Anführer, ein mutiger Kerl zweifellos, denn er zeigte keine Spur von Angst, trat selbstbewusst auf den Wagner zu und sagte, dass im Wald ja wohl genug Platz sei für beide Parteien. Jener nickte nur langsam, als sei er der gleichen Meinung, zog dann mit fließender Bewegung seine gute Pistole und schoss dem Gegenüber mitten ins Gesicht, dass mächtig Blut und Hirn aus dem Hinterkopf spritzten. Danach sah er sich um, als sei nichts geschehen, sah von einem zum anderen, als habe er eben die trefflichste Unterhaltung geführt, und sagte schließlich, wer von den Übrigen sich seinem Kommando unterstellen wolle, dem stehe dies frei, der Rest habe noch zu gleicher Stunde seinen Wald zu verlassen. Die Mehrzahl schloss sich uns an.
Auch wenn der Kommandant meist freundlichen Fußes zu allen seinen Untergebenen stand, sich mal hier, mal dort nach dem Befinden erkundigte, Mut zusprach und Lob austeilte, konnte er, so der Anlass es erforderte, auch hier sein anderes Gesicht aufsetzen. Gut in Erinnerung ist mir die Szene geblieben, als der Wagner mit der Witwe und mir im Gefolge von unserem Pferdegatter heimwärts lief – hielten wir die Gäule nämlich entfernt vom Hort, da diese zu laut und auffällig seien und deswegen zu leicht entdeckt werden könnten, wie der Wagner bestimmte – und wir den Amon bei zwei anderen Kameraden große Reden schwingen hörten. Welch Natter sich der Hauptmann da ins Bett geholt, tönte dieser lautstark; dass ihres armen Mannes Schicksal bald das selbige des Wagners sein werde, prophezeite er. Ich glaub, ich sollt mal ein Beil nebens Bett legen, dann ist der Hauptmann bald ein anderer, spottete der Amon zuletzt. Das folgende Lachen blieb ihm freilich gut im Halse stecken, als er den Wagner hinter sich erblickte. Oh, du göttlicher Augenblick! Dieser schritt daraufhin auf Amon zu und packte mit der einen Hand des Gegenübers Nacken und zog dessen Gesicht fingerbreit an seines ran. So, so, und du willst dann wohl meine Nachfolge antreten, was?, fragte er dann. Nein, nein, stammelte der Amon, er habe es doch nicht derartig gemeint. Du kannst dir vorstellen, lieber Leser, dass ich herzlich genoss, den Finsterling so reuig zu sehen, der mich so fleißig geschunden, und sehr bedaure ich, das folgende Schauspiel verpasst zu haben, das ich nur aus Wiedergaben schildern kann. Der Amon jedenfalls wurde so kräftig geprügelt und gedrillt, dass er an die zwei Wochen brauchte, um sich zu erholen. Und magst du nun glauben, dass jener hernach bittere Rache schwor, den Wagner fortan kräftig hasste und nur noch Zetermordio schrie, so sei dieses hier widerlegt, denn e contrario gab es nach jenem Vorfall wohl kaum einen demütigeren Fürsprecher des Hauptmanns als eben diesen.
Was mich dem Schauspiel fern gehalten, war die Witwe gewesen, war diese nämlich, als wir jene Reden hörten, davongelaufen. Ich lief ihr hinterher und fand sie auf einem Baumstamm sitzend und weinend, ein Bild, das durchaus ungewöhnlich war, denn kaum je ist mir eine wackerere Frau begegnet, konnte sie es an Mut mit jedem Manne aufnehmen. Als sie mich sah, zwang sie sich ein Lächeln ab. Was los sei?, frug ich besorgt. Erst sagte sie nichts und wischte sich nur die Tränen ab, was mir die Zeit gab, mich neben sie zu setzen. Ach weißt, sagte sie dann. Ich liebt ihn doch so, und schaute betreten zu Boden. Ich wusste nicht recht, was damit anfangen. Den Wagner? Da sah sie mich an, als sei ich blöd. Doch nicht den, antwortete sie, den Holzkopf mein ich, meinen Mann, und begann wieder kräftig zu weinen.
Dieser Art jedenfalls herrschte unser Hauptmann, gab mit der einen Hand, um mit der anderen zu peitschen: So wird Politik gemacht! Und mit Erfolg, denn in jenen ersten beiden Jahren, die ich als Räubersmann verbrachte, litten wir kaum je des Hungers, verloren nur zwei Männer an Krankheit und wuchsen stetig an Mannschaft, dass schließlich unser prächtiges Heim kaum reichte, alle zu beherbergen.
Ich erinner mich an schöne Zeiten, die wir verbrachten, wenn wir abends nach getanem Tagewerk beisammen saßen und über offener Flamme Fleisch brieten, nach Soldaten Art, wie wir es nannten, und dazu selbstgebrautes Bier tranken. Dann erzählten die vier Kriegsknechte, der Wagner und die Korporale, von ihren Abenteuern und Kriegen, und wir anderen hörten zu und machten große Augen. Wie eine andere Gattung erschienen sie mir dann, Helden aus einer anderen Welt, mit ihren Geschichten von Schlachten und von Kämpfen, von fernen Ländern und mächtigen Fürsten. Und nicht nur mir ging es so, auch die anderen sahen zu ihnen auf, waren es doch Bauern und Handwerker, Tagelöhner und Gesindel allesamt. Harte Männer, ungefragt, doch nun mal keine Soldateska, und so wurde allgemein versucht, diesen großen Vieren nachzueifern, sei es in der Art sich zu kleiden und zu schmücken – konnte kaum eine Hose weit genug geschnitten, mussten die Stoffe so bunt als möglich sein –, und hart wurde gestritten um die prächtigsten Hüte, den schönsten Schmuck und die edelsten Waffen, die wir auf Raubzug ergatterten. Ferner in der Art zu sprechen, wie es in der Armee Usus ist, ging es zum “Fouragieren” und auf “Patrouille”, den “Wachdienst” verrichten und ans “Visitieren”. Der Kriegsdienst wurde gepriesen und bewundert, und oftmals hörte man den einen und den anderen schwören, sobald die Trommler sich vernehmen ließen, man sich melden werde; denn Krieg lag in der Luft, schien schon damals nur eine Frage der Zeit, wann die Großen zu den Fahnen riefen, und Zeitung von kommendem Unheil gab es überall.
Kaiser Matthias war müßig zu jener Zeit, hatte sich nach erfolgreichem Bruderzwist, als er seinen Bruder Rudolf ausgestochen, an seinen Hof zurückgezogen, aus Altersgründen wohl, doch wenn das Oberhaupt der Macht der Machtausübung entsagt, so finden sich stets jene Menschen, die begierig sind, sich ihrer zu bedienen. Bruder Martin hier sagte mir mal, denn ein schlauer Fuchs ist er und weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen, dass Macht stets nach ihrer Ausübung strebt und, so die Mächtigen sich ihrer verweigern und sie nicht zu nutzen wissen, sie sich anderweitig bedient. Er sprach von ihr, als sei sie ein eigenes Wesen, habe Verstand und Willen. Und so käme es, dass, wenn die gottgewollten Herrscher zu alt oder zu jung oder zu dumm sind, die Macht sich anderweitig bediene, entstünden all jene großen Männer, die begierig die Ruder ergriffen, käme es zu einem Olivares in Spanien, einem Buckingham in England und einem Richelieu in Frankreich, welche im Namen der Könige und Prinzen handeln und ihrer statt die Politik bestimmen, was freilich nicht gut Zeugnis hinterlässt für unsere Herrscher. Khlesl war damals der Mächtige im Dienst des Kaisers, und gewiss wirst du den Namen schon vernommen haben, doch hinter ihm lauerten noch Eifrigere, noch Gierigere und noch Gefährlichere, die letztlich den Krieg beschworen, lauerte ein Erzherzog Ferdinand, der spätere Kaiser, ein Maximilian, der listige Bayer, und manche mehr, die sich den alten Glauben auf die Fahne geschrieben, ihn zum Siege zu führen.
Damals im Wald verstand ich noch nichts von Politik und Welt, waren es alles böhmische Dörfer für mich, kannte zwar wie die meisten die großen Namen jener Zeit, doch wie sie verstrickt und was ihr Begehr, davon wusste ich so wenig wie vom Kriege selber, und erst viel später lernte ich das Spiel der Mächtigen deuten, wobei mein Herr mir trefflicher Lehrmeister war. Meinen schurkischen Kameraden ging es ganz ähnlich, träumten sie nur davon, zu kämpfen und zu kriegen, auf wessen Seite und für wen war den meisten egal. Nur die Brüder Linz nannten sich offen Lutheraner. Nicht mal ihnen vertraute ich an, was ich des Ursprungs mal gewesen. Ja, gewesen sag ich, denn was ich im Walde war, das weiß ich nicht, dachte ich nicht darüber nach und ging auch freilich nicht zur Kirche. Gott war mir fern damals, so glaube ich, war verstritten mit ihm, und auch wenn ich mein Kreuz machte und oftmals ein Gebet aufsagte, in schwerer Lage, war in meinem vernarbten Herzen kein Platz für ihn, und erst viel später fand ich zu ihm zurück und ließ ihn ein; ich fürchte leider zu spät.