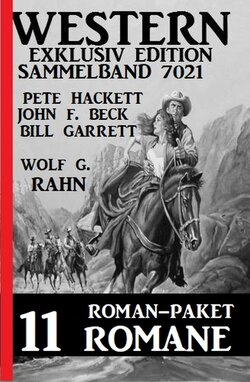Читать книгу Roman-Paket Western Exklusiv Edition 11 Romane - Sammelband 7021 - Pete Hackett - Страница 36
12
ОглавлениеEin paar Minuten später war er im Sattel seines Braunen auf der Spur der Cheyennes unterwegs. Scobeys erschrockener Protest hatte ihn nicht halten können. Nein, es war keine Zeit gewesen, auf die mehrere Meilen entfernten Soldaten zu warten. Wenn Rhett noch lebte, wenn es noch Rettung für ihn gab, dann zählte jede Sekunde. Ein grausames Schicksal stand ihm sonst bevor.
Clays Magen verkrampfte sich, wenn er daran dachte. Die Strapazen, die hinter ihm lagen, waren vergessen und wie ausgelöscht. Ungeduldig trieb er immer wieder sein Pferd an. Joana hatte ihn mit keinem Wort und keiner Geste zu halten versucht. Sie wusste, dass er so handeln musste. Sie billigte es. Schweigend hatte sie ihm die Zügel der Kutschenpferde aus der Hand genommen und ihm die Winchester gereicht. Das Gewehr steckte nun wieder geladen in seinem Sattelfutteral. Der einzige Trumpf, den er besaß.
Clay brauchte eine Stunde, bis er die Indianer zu Gesicht bekam. Die Szene brannte sich ihm unauslöschlich ein. Er zügelte sein Pferd auf einem fichtenbestandenen Kamm. Sie ritten unter ihm durch ein grasbewachsenes Tal. Fünf Mann. Ihre Mustangs gingen im Schritt. Am Sattel des vorausreitenden Kriegers war ein Lasso befestigt, an dem Clinton hing.
Das Seil war um seine Handgelenke gewickelt und zog ihn mit. Er hatte kaum mehr die Kraft, sich auf den Beinen zu halten. Er stolperte und schwankte. Er war barfuß. Das einzige Kleidungsstück, das er noch besaß, war die zerrissene Hose. Blutrinnsale bedeckten seinen Oberkörper. Sein Kopf war gesenkt, das Haar hing ihm über die Augen.
Clay dachte nicht mehr daran, was dieser Mann ihm angetan hatte. Er sah nur mehr den Menschen, der seine Hilfe brauchte. Dem niemand mehr helfen konnte, wenn die Krieger, die ihn mitschleppten, zu ihrem Haupttrupp stießen.
Clay presste die Lippen zusammen. Leise schnurrte die Winchester aus dem Scabbard.
Vielleicht würde schon der erste Schuss ein Dutzend weitere Indianer zum Schauplatz rufen. Doch Clay war entschlossen, es darauf ankommen zu lassen. Das war er sich, Joana und Scobey schuldig, nachdem sie ohne Rhetts Eingreifen verloren gewesen wären. Es spielte keine Rolle, dass Clinton dabei in erster Linie vielleicht nur daran gedacht hatte, von der Kutsche mitgenommen zu werden.
Mit steinerner Miene lenkte Clay sein Pferd zwischen den Bäumen den Hang hinab. Fichtennadeln und Moos dämpften das Pochen der Hufe. Die Indianer ritten hundert Yards vom Waldrand entfernt auf eine Hügelkerbe zu. Deckungslose Fläche war zwischen ihnen und dem großen hageren Weißen. Clay hörte ihre kehligen Stimmen. Sie lachten, als Clinton stürzte. Der, an dessen Pferd der Gefangene gebunden war, trieb sein Tier rascher an. Das Seil straffte sich und schleifte Clinton wie ein Stoffbündel mit. Da tauchte Clay zwischen den Fichten auf.
Seine erste Kugel traf das Pferd des Cheyenne Anführers in den Kopf. Es brach wie vom Blitz getroffen zusammen. Clinton blieb im zertrampelten Gras liegen. Die Köpfe der Indianer flogen herum. Verblüfft starrten sie auf den Weißen, der sein Pferd aus dem Schatten der Bäume auf sie zuspornte. Einen Moment zögerten sie, auf das Auftauchen weiterer Feinde gefasst. Dann rissen sie mit schrillen Schreien ihre Waffen hoch und stürmten ihm entgegen. Mündungsfeuer blitzten.
Clay jagte ein Dutzend Yards weiter, stoppte jäh und sprang ab. Eine seltsame, geradezu tödliche Ruhe erfüllte ihn. Er verspürte weder Furcht noch Hass. Da war nur die Entschlossenheit, das Äußerste zu versuchen, um das Leben des Mannes zu retten, der einmal sein bester Freund gewesen war.
Während Kugeln und Pfeile an ihm vorbeizischten, zielte er kaltblütig. Wie eine Horde brüllender Dämonen brausten die Angreifer heran. Clay schoss nicht auf sie, sondern auf den Krieger, der sich von seinem zusammenbrechenden Mustang weggerollt hatte und nun mit geschwungenem Tomahawk auf Clinton zustürzte.
Clays Kugel stieß den Cheyenne im letzten Augenblick von dem Gefesselten weg. Clinton hatte sich auf die Knie gestemmt. Halb betäubt und ungläubig beobachtete er das Geschehen. Die Indianer sprengten auf Clay zu, als wollten sie ihn unter den Hufen ihrer Mustangs zermalmen.
Clay ließ sich auf ein Knie nieder. Mit zwei blitzschnellen Schüssen holte er die beiden mittleren Angreifer von ihren Gäulen. Dann waren die beiden anderen links und rechts von ihm. Clay schleuderte sich seitwärts ins Gras. Eine Lanze stieß knapp an ihm vorbei. Clay warf sich auf den Rücken, schoss, und wieder war der Sattel eines Cheyennepferdes leer. Der vierte Krieger schwang mit einem Wutschrei seinen Pinto herum. Das hochsteigende Tier rettete ihm das Leben. Es bekam das Blei in die Brust, das Clay sofort hinterherjagte.
Clay lag noch auf dem Rücken, als das Pferd vor ihm wegkippte und der halb nackte Krieger sich mit einem Panthersatz aus dem Sattel rettete. Hastig hebelte Clay die nächste Patrone in den Lauf. Da war der Indianer mit geschwungener Kriegskeule schon vor ihm. Clays Mündungsblitz stach an ihm vorbei. Clay rollte sich zur Seite. Die wuchtig niedersausende Keule prellte ihm die Winchester aus den Fäusten. Dann lag der Cheyenne auf ihm, statt des Schädelbrechers nun ein Messer in der Faust. Clay erwischte gerade noch sein Handgelenk.
Die tödliche Klinge schwebte knapp über seiner Brust.
Da tauchte ein Schatten neben ihnen auf. Ein Hieb mit einem Gewehrkolben fegte den Indianer zur Seite. Schwankend, mit grausig entstelltem Gesicht, blickte Rhett Clinton auf Clay hinab. Mit dem Tomahawk des von Clay zuerst niedergeschossenen Kriegers hatte er sich die Fesseln zerschnitten.
»Wie in alten Zeiten, was?«, krächzte er. Sein Versuch, zu grinsen, gab Clay einen Stich.
Clay sprang auf. Jetzt, aus der Nähe, sah er schaudernd, wie schlimm Rhett zugerichtet war. Das Gewehr rutschte ihm aus den Fingern. Die Beine sackten ihm weg. Clay konnte ihn gerade noch auffangen. Behutsam bettete er ihn ins Gras. Clinton atmete flach und stoßweise. Bitter erkannte Clay, dass er nichts mehr für ihn tun konnte, außer bei ihm zu bleiben, bis sein Atem erlosch.
Mit trüben Augen blickte der Verwundete ihn an.
»Hat Joana dich geschickt?«
Clay zögerte nicht. Er nickte.
»Sie ist in Sicherheit. Bald werden Soldaten hier sein.«
Er stockte. Eiskalt lief es ihm über den Rücken. Seine Befürchtungen waren nur zu rasch wahr geworden. Drüben in der Kerbe zwischen den bewaldeten Hängen waren Reiter aufgetaucht. Indianer in vollem Kriegsschmuck, in bunte Decken gehüllt, mit Gewehren und Lanzen vor sich auf den Pferden. Die Schüsse hatten sie hergelockt.
Clinton bemerkte nichts davon. Mit letzter Kraft griff er nach Clays Arm. Seine verlöschende Stimme bannte Clay. Er brachte es nicht über sich, jetzt aufzuspringen, zu seinem Pferd zu rennen, zu fliehen. Schweigend spähten die Cheyennes herüber. Immer mehr tauchten in der Hügelfalte auf.
Clay hörte die Stimme des Sterbenden wie von weit her.
»Sag Joana, ich hab eingesehen, wie falsch alles von mir war! Sag ihr, dass es mir leidtut. Versprich mir das, Clay!«
So war Clay damals auch bei Talbot gekniet. Nun gab er seinem einstigen Partner dieselbe Antwort: »Ich verspreche es.«
Aber das hörte Clinton schon nicht mehr. Seine Rechte war herabgesunken. Er lag da wie schlafend.
Als die Indianer ihre Pferde mit gellendem Geschrei anspornten, schnellte Clay hoch. Drei Sätze, dann war er bei seinem Braunen. Er flog in den Sattel, und die letzte Jagd begann.
Zwei Meilen weiter drehten die Verfolger jäh ab. Eine Kette blauuniformierter Reiter kam über den Höhenzug in Sicht. Joana war bei ihnen.
ENDE