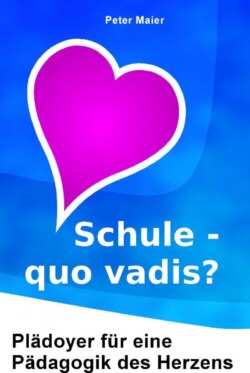Читать книгу Schule – quo vadis? - Peter Maier - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
(3) Strukturreformen: Schüler – quo vadis?
ОглавлениеAll die Reformanstrengungen, die seit dem Pisa-Schock in den einzelnen Bundesländern gemacht wurden, gingen fast ausschließlich von oben aus, das heißt von den Kultusbehörden. Die eigentlich Betroffenen wurden oft gar nicht dazu gehört: die (meist verbeamteten) Lehrer und die Schüler. Diese beiden Gruppen müssen das annehmen, umsetzen, hinnehmen oder sogar ausbaden, was eifrige Reformer von oben her inszeniert haben und weiterhin inszenieren. Geht eine Reform dann schief, wird argumentiert, dass man es immerhin probiert habe. Sowohl geglückte als auch missglückte Reformversuche werden aber auf dem Rücken von Lehrern und vor allem Schülern ausgetragen.
In der ganzen Bildungsdiskussion, die seit dem Pisa-Schock tobt, kommen viele Experten oder die, die sich dafür halten, zu Wort. Selten hört man jedoch auf die Betroffenen selbst. Nur wenige Lehrer haben den Mut, etwa über ein Buch zur Diskussion beizutragen – immerhin als Experten für Pädagogik in der Praxis. Dieses Buch möchte daher solch eine Lehrerstimme in der gegenwärtigen Bildungsdiskussion sein. Was aber ist mit den Schülern? Gibt es überhaupt Plattformen, auf denen diese Hauptbetroffenen zu Wort kommen können? Werden Schüler gefragt, welche Schule sie sich denn wünschen würden, wenn sie entscheiden könnten?
Schülerkongress „Basis 15“
Genau in diese Richtung geht auch folgender Zeitungsartikel, der den Schülern eine Stimme geben will: „Alle reden immer über uns. Aber niemand fragt uns.“26 Hierbei geht es um die bayerische Landesschülervereinigung, die Anfang März 2015 in Nürnberg das Schüler-Symposium „Basis 15“ für mehr Mitsprache organisiert hat. Dazu haben sich 400 Schüler aus ganz Bayern getroffen. Der einhellige Wunsch: Schule soll demokratischer werden. Die Vorsitzende ist Luka Fischer, 17, Schülersprecherin am Gymnasium Tutzing. Sie erläutert in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung kurz vor Kongressbeginn die wichtigsten Anliegen ihrer Schüler-Organisation.
Bei den Streitthemen G 8/G 9 oder der Gemeinschaftsschule sollen die Schüler mehr mitbestimmen können: „Alle reden immer über uns, das Kultusministerium, die Eltern und die Lehrer auch. Aber niemand fragt uns oder spricht mit uns. Dabei können wir Schüler doch am besten sagen, was uns fehlt, was wir brauchen, womit es uns gut geht, womit nicht.“27
Luka Fischer beklagt, dass im gegenwärtigen Schulsystem zu wenig Zeit bestünde, echtes Wissen zu vertiefen. Damit schlägt sie indirekt in die gleiche Kerbe wie der Kulturkritiker Liessmann, der durch die Kompetenzorientierung der Lehrpläne echte Bildung und echte Wissensvermittlung verschwinden sieht. Auf die Frage, was die ideale Schulform für sie wäre, antwortet die Schülersprecherin: „Eine Schule für alle, die viele Möglichkeiten bietet, damit jeder seine Stärken entwickeln kann. Die den Schülern Zeit gibt, herauszufinden, wo ihre Stärken liegen. Lernen sollte aktiver vom Schüler ausgehen. Uns wird der Stoff vor allem vorgesetzt, wir haben keine Zeit, uns Wissen in den Gebieten zu erarbeiten, die uns interessieren. Es gilt immer nur die nächste Prüfung. Bulimielernen eben.“28
Besonders bemerkenswert finde ich, was Luka Fischer zum Thema „Demokratische Schule“ vorbringt – das Hauptanliegen des Symposiums „Basis 15“: „Wir wollen, dass die Schule demokratischer wird … Wir möchten, dass auch das staatliche Schulsystem ein bisschen mehr in die demokratische Richtung geht und nicht alles so strikt ist. Der Grundgedanke unserer Schulpflicht ist Chancengleichheit, die als Grundstein der Demokratie gilt. In unserem jetzigen Schulsystem wird man zu einem passiven stummen Bürger erzogen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Auch deswegen organisieren wir Basis 15.“29
Vielleicht handelt das Schüler-Symposium im Geiste Mahatma Ghandis, ohne sich dessen aber bewusst zu sein. Er sagte, dass Mittel und Ziel eines Prozesses untrennbar zusammen gehören. Man kann ein gutes Ziel nur erreichen, wenn man dazu gleichzeitig gute Mittel einsetzt, die mit dem Ziel korrespondieren und in denen das Ziel bereits „vorvorhanden“ ist. Auf den Wunsch der Schüler nach mehr Demokratie in den Schulen angewandt, könnte dies dann bedeuten: Wenn man unsere Schüler zu jungen Demokraten erziehen will, müssen auch die Methoden und Mittel des Bildungssystems demokratische Strukturen haben, in denen das Demokratieverständnis eingeübt werden kann. Ich jedenfalls vertrete die Meinung, dass den Ideen und Vorschlägen der Hauptbetroffenen, der Schüler, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden soll – gerade wenn es um Reformen im Bildungsbereich geht.
In jedem Fall ist bemerkenswert, dass dieser Schüler-Kongress „Basis 15“ überhaupt stattfand und dass am letzten Tage zur Ergebnis-Präsentation fast alle in den bayerischen Landtag gewählten Parteien sowie Lehrerverbände Vertreter geschickt hatten. Abgesehen davon, dass der Kongress selbst ein Beispiel für eine basisdemokratische Entwicklung neuer Ideen im Bildungsbereich geben könnte, halte ich die Forderungen der Schüler für bedenkenswert. Sie wünschen sich echte Partizipation und wollen bei bildungspolitischen Themen in Zukunft mehr Einfluss nehmen können, wie ein Bericht nach dem Kongress zeigt: „Bei der Gestaltung des Lehrplans sowie des Unterrichts oder der Beurteilung von Lehrproben im Referendariat wollen die Schüler mitreden … Außerdem forderten die Jugendlichen mehr Pädagogik im Lehramtsstudium, ein flexibleres System, etwa um kreativ zu arbeiten oder aktuelle Themen im Unterricht zu besprechen, und eine längere gemeinsame Schulzeit.“30
Die Lehrer stehen den Schülern näher
Mit dem letzten Zitat wird bereits die Art des Schulsystems berührt, das in mehreren westlichen Bundesländern seit Jahren in der Dauerdiskussion ist. Dabei geht es zur Zeit fast ausschließlich um den „richtigen“ Schulrahmen, also um die „geeignete“ Schulstruktur achtjähriges (G 8) oder neunjähriges Gymnasium (G 9). Es wäre klug, dazu auch Pädagogik-Verbände zu befragen. Ein Verband vertritt zwar in erster Linie die Bedürfnisse seiner Mitglieder: in diesem Falle die der Lehrer. Sie aber sind es, die täglich mit den Schülern arbeiten. Daher sind sie Experten, wenn es um Fragen der Lernfähigkeit und Lernbereitschaft oder um die sozialen und emotionalen Bedürfnisse ihrer Schüler geht – vor allem in der Pubertät.
Am Beispiel des mitgliederstarken Bayerischen Philologenverbandes soll dies näher aufgezeigt werden. Sein Vorsitzender, Max Schmidt, hat sich 2014 engagiert in die Diskussion um das „richtige“ Bayerische Gymnasium eingebracht. Im Namen seines Verbandes hat er bereits im März 2014 Eckpunkte für eine Rückkehr zu einem modifizierten neunstufigen Gymnasium vorgestellt. Seine Argumente könnten meiner Ansicht nach auch für die Bildungsdiskussion in anderen Bundesländern von Bedeutung sein: „'Das achtjährige Gymnasium hat uns zwei Dinge gelehrt ... Erstens, dass die Zeit zum Erwachsenwerden nicht qua Verordnung reduziert werden kann und zweitens, dass theoretische Überlegungen, die im Hauruckverfahren eingeführt werden, jahrzehntelangen Ärger zur Folge haben.'“31
So werden in diesen Eckpunkten die Schüler und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt. Die Gymnasiasten sollen entlastet werden, um wieder mehr Zeit für Persönlichkeitsentwicklung und außerschulische Lernerfahrungen zu haben. „Pro Woche sollen die Jugendlichen nicht mehr als 30 bis 32 Stunden Pflichtunterricht haben. Es soll mehr Zeit für Vertiefung, Festigung und Förderung geben; außerdem ein 'vielfältiges Wahlangebot im musisch-ästhetischen Bereich.'“32
Diese Stimme des Bayerischen Philologenverbands stellt eine wohltuende Abkehr von überstürzten und am grünen Tisch entworfenen Reformen im Schulbereich dar. Schüler sind keine Ware, keine Dinge, keine Produkte und keine Schachfiguren, die man beliebig herumschieben kann. Sie sind junge Menschen in der Entwicklung – auf dem Weg zu sich selbst. Der Bayerische Philologenverband hat dies erkannt und versucht, sich in der gegenwärtigen Bildungsdiskussion um das G 8- oder G 9-Gymnasium kompetent einzubringen.33
In den Kultusbehörden mancher Bundesländer hat man nämlich in der Vergangenheit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet – beeindruckt vom Pisa-Schock und von Forderungen von Wirtschaftsverbänden, die möglichst viele Gymnasialabsolventen in möglichst kurzer Zeit für Berufsausbildung oder Studium haben wollen. Reformen im Bildungsbereich waren notwendig, weil sich alles in der Welt mit hoher Geschwindigkeit weiterentwickelt. Die Schulen, die ja unsere Jugendlichen „fit for the job“ machen möchten, müssen sich dieser globalen Entwicklung auch in Zukunft stellen, gerade weil Deutschland das „Land der Ingenieure“ bleiben will, um es einmal plakativ zu formulieren. Deutschland ist ein Bildungsland und muss Schritt halten können mit der Weltentwicklung – mit der Entwicklung in den anderen Industrieländern oder in Schwellenländern wie etwa China, dem aufstrebenden Riesen.
Wenn dabei aber etwa mit einem unausgegorenen Turbo-Gymnasium die eigentlichen Bedürfnisse der Schüler übersehen oder gar die Seele der Jugendlichen verraten wird, hat dies mittel- und langfristig fatale Konsequenzen. Jugendliche brauchen genügend Freiraum für ihre Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Schülern in der Unter- und Mittelstufe ist vor allem die Beziehung zum Lehrer wichtig, erst in zweiter Hinsicht geht es um das Fach, das er vertritt. Die Verantwortlichen in Gesellschaft, Wirtschaft und Bildungspolitik hingegen haben offensichtlich nur ein Ziel: Sie wollen die Schüler in möglichst kurzer Zeit an unsere Leistungs- und Konsumgesellschaft heranführen. Um eine Persönlichkeitsentwicklung oder gar um eine Herzensbildung geht es immer weniger, auch wenn überall von „individueller Förderung“ die Rede ist.
Persönlichkeitsentwicklung braucht Zeit
Anders als etwa in Bayern wurde in Hessen 2013 eine landesweite echte Wahlmöglichkeit zwischen dem G-8- und dem G-9-Gymnasium eingeführt. Die Hessische Landesregierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ermöglichte diesen Schritt, weil sie Stimmenverluste bei der Landtagswahl 2013 befürchtete.34 Die Leiterin der Schillerschule in Frankfurt, Karin Hechler, die zunächst mit großer Begeisterung das Gymnasium G 8 eingeführt hatte, ist mit ihrer Schule als eine der ersten wieder zum G-9-Gymnasium zurückgekehrt. Ihre Argumente dafür sind von Bedeutung, weil sie wieder ganz die Schüler und ihre Bedürfnisse in den Blick nehmen:
„Wir mussten lernen, dass man in acht Jahren nicht dasselbe machen kann wie in neun Jahren – selbst dann nicht, wenn die Kinder auch nachmittags an der Schule sind und die Zahl der Unterrichtsstunden aufgestockt wird. Vieles, etwa die zweite Fremdsprache, wurde im G 8 nach vorne verlagert. Dadurch mussten die Kinder in der fünften bis siebten Klasse plötzlich viel mehr Stoff bewältigen. Die Kinder wurden gestopft und reiften nicht. Und zur Bildung gehört eben auch ein Reifungsprozess ... Wir haben festgestellt, dass die Schüler im G 8 fast nur noch auf die nächste Prüfung gelernt haben. Die Nachhaltigkeit hat sehr stark gelitten. Nach der Prüfung war vieles sofort wieder vergessen ...
Die Schüler haben sich immer seltener für kreative Fächer angemeldet, die nicht Pflicht waren. Es gab eine regelrechte Abhak-Mentalität. Die Schüler haben nur noch das gemacht, was unbedingt erforderlich war, und zwar nicht aus Interesse, sondern um es hinter sich zu bringen. Die Schulkultur ist dadurch sehr glatt gebügelt worden ...
In einer Umfrage haben sich die Schüler beklagt, dass sie keine Zeit mehr für Sport und Musik außerhalb der Schule haben, dass selbst an den Wochenenden keine Zeit bleibt, Freunde zu treffen ... Sehr viele Kinder wünschen sich freie Zeit für sich, in der sie autonom bestimmen können, was sie tun.“35
Frau Hechler hat sich zusammen mit ihrem Kollegium Gedanken gemacht, was das eigentliche Ziel von Bildung und Schule sein sollte und was ein Jugendlicher braucht, um in der immer komplexer werdenden heutigen Welt leben und bestehen zu können: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schule Bildungsreichtum vermitteln muss. Hochschulreife bedeutet, über den Tellerrand hinauszuschauen. Aber um das zu vermitteln, braucht man Zeit.“36 Dennoch ist Frau Hechler der Meinung, dass sie nicht zurück zum G 9, sondern vorwärts zum G 9 gegangen ist, weil viele positive Erkenntnisse aus dem G-8-Modell beibehalten wurden – zum Beispiel die intensive Hausaufgabenbetreuung.
Achtjähriges Gymnasium – eine Schule der Angst?
Zu diesen Überlegungen über die Schulstruktur und ihre Konsequenzen soll noch eine ganz andere Stimme zu Wort kommen: die des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Im März 2014 titelte die SZ anlässlich des 20. Jugendkongresses des BVKJ in Weimar: „Schule der Angst. Achtjähriges Gymnasium – der Druck macht immer mehr Schüler krank ... Depressionen seien schon häufiger als Masern und Mumps ... Fast jeder dritte Schüler hat Kopfschmerzen, Schlafprobleme oder Niedergeschlagenheit.“37 In diesem Zusammenhang wird auch der Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler Klaus Hurrelmann zitiert, der einen deutlichen und engen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Störungen vieler Schüler im psychischen und psychosomatischen Bereich mit dem System Schule sieht: Die verkürzte Gymnasialzeit und der damit verbundene gestiegene Leistungsdruck führen zu immer mehr Verhaltensauffälligkeiten und eben zu Erkrankungen.38
Lehrermangel, Inklusion und vor allem das Gymnasium G 8 sind auch nach Meinung vieler Ärzte des BVKJ die Hauptursachen, dass das seelische Leid der Schüler immer mehr zunimmt. Viele von ihnen sind wie in einem Hamsterrad gefangen und können nicht mehr richtig abschalten: Die Gedanken kreisen dann womöglich zwanghaft um den nächsten Termin, die nächste Klausur, die nächsten Noten. Viele Schüler machen sich diesen Druck selbst, weil sie gut sein und ihre Eltern nicht enttäuschen wollen. Sie wollen sich auf keinen Fall als Versager fühlen – nicht selten ein Teufelskreis von Leistungsdruck, Angst und infolgedessen von psychosomatischen Symptomen. Für die Kinder- und Jugendärzte des BVKJ sind dies alarmierende Zeichen. Zudem kämpfen landesweit Elternverbände seit Jahren um die Abschaffung des G 8, weil ihre Kinder in diesem Schulsystem mit mehrfachem Nachmittagsunterricht zu wenig Freizeit haben, um sich entspannen und ihre Persönlichkeit besser ausbilden zu können.39
In dem G-8-Gymnasium ist es die Regel, dass Schüler etwa der Mittel- und Oberstufe an zwei oder sogar an drei Nachmittagen die Woche herkömmlichen (!) Unterricht haben. Dabei kann es passieren, dass sie an einem Tag acht, neun oder sogar zehn Unterrichtsstunden bewältigen müssen, unterbrochen nur durch eine 45-minütige Mittagspause. Viele Schüler sind dann in den Nachmittagsstunden nicht mehr in der Lage, den unterrichteten Stoff wirklich gut aufzunehmen und sind abends nur noch total erschöpft. Wenn sie so lange in der Schule verweilen, bräuchten Sie Freizeit, Ausgleich, Sport, Hausaufgabenbetreuung, aber nicht immer neuen Stoff – auch am Nachmittag. Diese Art von Schulsystem kann noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, höchstens eine Übergangsphase, die noch einer sinnvollen Weiterentwicklung bedarf. Die Gefahr ist groß, dass solch ein Schulsystem zunehmend nur noch rational ausgerichtete „Hirnkinder“ hervorbringt, denen eine wirkliche Herzensbildung fehlt.
Außerdem gerät das zweite schulische Bildungsziel neben der reinen Stoff- und Kompetenzvermittlung gerade im G-8-Gymnasium immer mehr unter die Räder: die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler sowie der Prozess ihrer Initiation, das heißt ihres Erwachsenwerdens. Dies braucht Zeit, die es für viele Jugendliche im G 8 nicht mehr oder nicht ausreichend gibt. Die Hauptintention dieses Buches ist es, vor allem diesem vernachlässigten zweiten Bildungsziel Raum zu geben und in den nachfolgenden Kapiteln den eigentlichen Schlüssel der Pädagogik zu finden. Doch zunächst sollen in diesem ersten Kapitel noch einige Aspekte der berühmten „Hattie-Studie“ genannt werden, die in einem Buch über Schule nicht fehlen darf, weil sie eine wichtige Orientierung in Bildungsfragen geben und ein wohltuendes Korrektiv zur gegenwärtig so aufgeheizten Bildungsdiskussion darstellen kann.