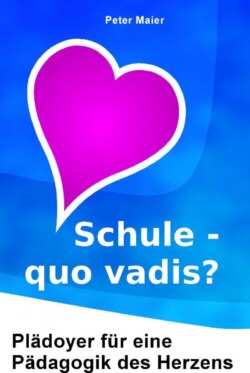Читать книгу Schule – quo vadis? - Peter Maier - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
(5) Zusammenfassung
Оглавление1.
Der österreichische Kulturkritiker Konrad Paul Liessmann übt beißende Kritik an der gegenwärtigen Bildungspolitik. Seiner Ansicht nach werde Bildung heute nur noch an wirtschaftlicher Effizienz ausgerichtet, sie hat keinen Wert mehr in sich.
2.
Liessmann kritisiert zudem, dass Schulbildung heute nur noch durch die Brille des Kompetenzbegriffs gesehen wird – eine fatale Entwicklung, die sich spätestens an der Universität bitter rächt. Denn nach wie vor ist fachliches Wissen selbst gefragt, nicht nur die bloße Fähigkeit, es sich anzueignen.
3.
Herr Liessmann bemängelt, dass Schulen von staatlichen Behörden immer mehr zu bildungspolitischen Experimenten auf dem Rücken von Lehrern und Schülern missbraucht werden. Außerdem glauben heute viel zu viele tatsächliche oder nur selbsternannte Experten von außerhalb, in der Schulpolitik mitreden zu können.
4.
Schüler sind in erster Linie Menschen, nicht Lernmaschinen. Darum dürfen sie niemals zu bloßen Nutzobjekten der Bildungspolitik gemacht werden. Die Fachlehrpläne sollten daher nicht nur auf Kompetenzen und auf wirtschaftlichen Nutzen ausgerichtet sein. Schulen sollten auch in Zukunft Orte der Bildung sein, an denen die Schönheit des Wissens eine Rolle spielt.
5.
Der Pisa-Schock von 2001 hat von Seiten der Bundesländer und ihrer Schulbehörden eine umfangreiche Reformtätigkeit ausgelöst – in der Schulstruktur und in den Unterrichtsmethoden. Wesentlich verstärkt wird diese Entwicklung durch die zunehmende Digitalisierung, die auch vor den Schulen nicht Halt machen darf.
6.
Es ist jedoch ein fundamentaler Fehler, wenn im ganzen Reformgetöse in der Bildungspolitik übersehen wird, dass sich die Schüler in einer beständigen Entwicklung ihrer Persönlichkeit befinden. An ihnen und an ihren Bedürfnissen muss jede Reform ausgerichtet sein.
7.
Auf den Lehrer kommt es an! Diese Forderung nach einer personalen Wende in der Schulpolitik erhebt der Pädagoge Michael Felten. Nicht das Methodische, sondern das Beziehungshafte und das Psychologische ist im Unterricht entscheidend.
8.
Persönlichkeitsentwicklung braucht Zeit. Daher müssen Wissens- und Kompetenzvermittlung einerseits und Charakterbildung und Werteerziehung der Jugendlichen andererseits auch in Zukunft gleichwertige Bildungsziele in der Schule bleiben.
9.
Die Forschungsergebnisse des Neuseeländers John Hattie in seinem Werk „Visible Learning“ stellen eine wohltuende Orientierung im gegenwärtigen bildungspolitischen Dschungel dar. Durch die sogenannten Hattie-Faktoren wird offensichtlich, welche Einflüsse die verschiedenen Reformmaßnahmen auf den Lernerfolg der Schüler wirklich haben.
10.
Die Klarheit der Lehrperson, sowie die Lehrer-Schüler-Beziehung stehen im Ranking der Hattie-Faktoren ganz oben. Das Unterrichtsprinzip „Erziehung durch Beziehung“ hat auch in einer globalisierten und digitalisierten Welt seine Bedeutung nicht verloren.