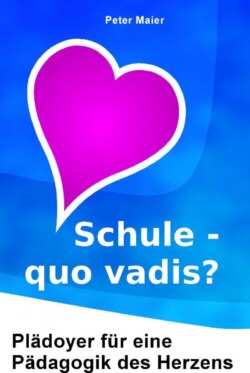Читать книгу Schule – quo vadis? - Peter Maier - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
(1) Warum ich Lehrer wurde
ОглавлениеSchüler auf dem Land
Geboren bin ich 1954 in einem kleinen Marktflecken in Ostbayern mit damals ca. 800 Einwohnern. Mein Vater hatte sich zum Ziel gesetzt, praktisch aus dem Nichts einen großen Bauernhof zu schaffen und damit den lange gehegten Wunsch einer Reihe von Vorfahren zu erfüllen. Mein Leben schien damit vorgezeichnet zu sein: Als Erstgeborener sollte ich einmal diesen Hof übernehmen, der aus Sicht meines Vaters einen nicht zu überbietenden archaischen Wert darstellte. Mit Feld und Vieh war man jemand, man wurde im Dorf anerkannt, man hatte eine vermeintlich sichere Existenz, man konnte zu Wohlstand und Ansehen kommen.
Daher fuhr mir der Schreck ziemlich in die Glieder, als mich mein Volksschullehrer an einem Vormittag im Mai 1965 unvermittelt fragte, ob ich im kommenden Schuljahr auf das Gymnasium gehen wolle. Denn der Anmeldetermin laufe bereits in drei Tagen ab. Gymnasium? Das nächste lag 31 Kilometer entfernt in der Kreisstadt des Nachbarlandkreises – eine völlig fremde und ferne Welt für mich, der noch nie wirklich aus seinem Dorf hinausgekommen war. Nie hatte ich auch nur im Traum daran gedacht, auf eine höhere Schule zu gehen. Ich wollte doch Landwirt werden wie mein Vater. Wieso sollte ich eine höhere Schule besuchen? Ich war vollkommen mit dem Bauer-Sein identifiziert. Und ich wollte natürlich immer zu Hause bleiben – bei Hof, Vieh und Äckern.
Da ich die Frage des Lehrers nicht beantworten konnte, schickte der mich sogleich während des Unterrichts nach Hause, um meinen Vater zu fragen. Dieser hatte, wie ich erst jetzt erfuhr, einige Tage zuvor bei einem zufälligen Treffen mit meinem Lehrer auf der Straße den Wunsch geäußert, mich aufs Gymnasium zu schicken. Davon hatte ich aber selbst als der eigentlich Betroffene nichts mitbekommen. Mein Vater hatte mir nichts von seinem Ansinnen gesagt.
Zufällig war mein Vater zu Hause. Er fragte mich Elfjährigen, was ich denn in drei Jahren nach der Schulentlassung beruflich werden wolle – Maurer, Metzger, Bäcker, Zimmermann oder Schreiner?55 Ich war entsetzt. Wieso sollte ich solch einen Handwerksberuf erlernen, wenn ich doch der zukünftige Hoferbe sein würde? Da erst rückte mein Vater mit seiner Wahrheit heraus, die mir Angst machte: Er fühle sich noch viel zu jung und vital und wolle den Hof möglichst lange nicht an einen Nachfolger übergeben. Daher habe er vor, ihn einmal an meinen um fast vier Jahre jüngeren Bruder zu vererben. Damit war ich nach den Plänen meines Vaters aus der Erblinie des Hofes bereits ausgeschieden, bevor ich überhaupt eine Chance hatte, hineinzukommen. Vehement lehnte ich alle Handwerksberufe ab, weil ich mich nicht als zukünftigen Hoferbe so einfach „rauskegeln“ lassen wollte. Daraufhin meinte mein Vater: „Ja wenn du keinen solchen Handwerksberuf ergreifen willst, kannst du ja gleich aufs Gymnasium gehen.“
Mit dieser Botschaft im Gepäck fuhr ich wieder zur Schule zurück. Daraufhin meldete mich der Lehrer als einzigen meiner Klasse am benachbarten Landkreis-Gymnasium an und vier Wochen später saß ich mit vielen anderen, mir völlig fremden Jungen und Mädchen, in der Aufnahmeprüfung. Drei Tage lang mussten wir jungen Kandidaten die schriftlichen Tests in Mathematik, Deutsch und Sachkunde bestehen und wurden danach auch noch mündlich auf Herz und Nieren geprüft.
Ich beherrschte nur einen bayerischen Dialekt
Ich schaffte die Prüfungen und konnte im September 1965 mit der höheren Schule beginnen. Neun Jahre lang war ich nun täglich 62 Kilometer auf der Strecke – je 31 Kilometer hin und zurück mit Fahrrad, Bummelzug und zu Fuß. In meiner Klasse waren zunächst 44 Kinder. Davon waren zwei Drittel Fahrschüler wie ich, nur ein Drittel der Klassenkameraden stammten aus dem Schulort selbst. Diese fühlten sich sicherer, einige von ihnen waren sogar richtig arrogant und begannen uns Jungen aus den entfernteren Bauerndörfern zu mobben. Zudem musste ich feststellen, dass mich der Deutschlehrer beständig kritisierte, weil ich nur Dialekt sprechen konnte – Oberpfälzer Dialekt.56 Der Lehrer, der mich in der fünften Volksschulklasse in meinem Dorf unterrichtet hatte, hatte viel Wert auf Mathematik und Sachkunde, weniger auf das Schriftdeutsch gelegt. Daher hatten wir nie Schriftdeutsch zu sprechen und auch nicht wirklich zu schreiben gelernt. Das rächte sich jetzt furchtbar am Gymnasium und da begann meine große Not...
Mittwoch, 1. Dezember 1965. Elternsprechtag. Wir hatten schulfrei. Mein Vater hatte sich diesen Tag Zeit genommen, um die Lehrer der Kernfächer zu besuchen. Der Mathematiklehrer berichtete ihm, dass ich in seinem Fach gut mitarbeiten würde. Dann kam mein Vater zum Deutschlehrer. Dieser bat meinen Vater sofort eindringlich, mich umgehend, am besten noch heute, wieder vom Gymnasium zu nehmen, da ich keine Chance hätte. Als Beweis legte der Lehrer meinem Vater die soeben korrigierte erste Deutschschulaufgabe vor – einen Aufsatz, genauer gesagt einen Erlebnisbericht. Darin gab es auf den vier kleinen Seiten keine einzige Zeile, in der nicht mehrere Wörter rot angestrichen waren. 40 (!) Rechtschreibfehler und zusätzlich 20 (!) sogenannte „Ausdrucksfehler“ wies meine Arbeit auf.
Nach diesen Ausführungen war mein Vater ziemlich betroffen und ich, der während des Besuchs beim Deutschlehrer vor der Türe gewartet hatte, war richtig entsetzt. Ich verstand die Welt nicht mehr. Denn mutig war ich das Thema „Ein unvergessliches Erlebnis“ angegangen und hatte voll Freude und Spontanität von den Erlebnissen bei der aufregenden Kartoffelernte mit dem Bulldog, dem neuesten Kartoffelroder und all den Taglöhnern berichtet, die kürzlich bei uns gearbeitet hatten. Dabei hatte ich so geschrieben, wie ich die Wörter und Ausdrücke eben von meinem Dialekt her im Ohr hatte – der einzigen mir damals bekannten Sprache. Hier ein Beispiel: „Da die Erdäpfel zeidi waren, wurden sie mit dem Erdäpfelroder aus dem Boden geholt“. Mir waren bis dahin die Wörter „reif“ statt „zeitig“ („zeidi“) und „Kartoffel“ statt „Erdäpfel“ einfach völlig unbekannt. Also hatte der Lehrer diese Wörter als „Ausdrucksfehler“ angestrichen. Für meinen Vater und vor allem für mich brach in diesem Augenblick eine Welt zusammen. Große Unsicherheit und Angst fuhren in mein Gemüt. Sollte denn das geforderte Hoch- oder Schriftdeutsch etwa eine ganz andere Sprache als meine Muttersprache sein, in der ich mich doch bis jetzt sehr sicher gefühlt hatte?
Mein Vater wollte mich daraufhin gleich beim Direktor von der Schule abmelden. Der Vollständigkeit halber wollte er aber vorher noch zum Englischlehrer gehen. Vielleicht konnte der etwas Besseres über mich berichten – einfach um den Gesamteindruck an meinem letzten Schultag zumindest moralisch ein bisschen aufbessern zu können. Der Englischlehrer war jedoch an diesem Tage krank. Der Schuldirektor selbst vertrat den Englischlehrer und hatte auch die aktuelle Note der vor kurzem geschriebenen und bereits korrigierten ersten Englisch-Schulaufgabe vor sich liegen. Da ich dafür sehr viel gelernt hatte, hatte ich die Note Eins bekommen. Diese Note und der Umstand, dass der Englischlehrer fehlte, retteten an diesem Tag meine Schulkarriere.
Denn der Direktor hatte ein großes Herz für Landschüler wie mich, die damals eben oft nur Dialekt sprechen konnten. Aufgrund der guten Englischnote erkannte er sofort das Potential, das wahrscheinlich in mir steckte. Er setzte sich vehement für mein Bleiben an der Schule ein und konnte meinen Vater davon überzeugen, mich trotz der schlechten Deutschnote hier zu behalten. Zudem versprach er, mit dem Deutschlehrer zu reden. Da ich in allen folgenden fünf Klassenarbeiten in Deutsch jeweils „Ausreichend“ mit einem beinahe unendlich langen Minus-Balken hinter der Note Vier bekam, obwohl fast genau so viel wie in der ersten Arbeit rot angestrichen war, vermute ich heute, dass der Deutschlehrer nicht frei in seiner Notengebung war: Wahrscheinlich gegen seinen Willen und gegen seine ehrliche und tiefe Überzeugung durfte er mir „Land-Bub“ aufgrund der ausdrücklichen Vorgabe des Direktors während des ganzen ersten Schuljahres offensichtlich höchstens die Note Vier verpassen. Ich glaube, ich hätte damals tatsächlich in allen Deutsch-Schulaufgaben jeweils die Note sechs verdient gehabt.
In der folgenden Klasse bekam ich einen anderen Deutschlehrer und meine Noten in diesem Fach wurden – auch ohne die vermutete Intervention durch die Schulleitung – deutlich besser. Dennoch wusste ich noch nicht wirklich, wie ich meine Deutschkenntnisse verbessern könnte. Vor allem fühlte ich mich völlig allein mit dem Problem, wie ich – ausgehend von der Muttersprache „Oberpfälzer Dialekt“ – das Hochdeutsch oder zumindest das Schriftdeutsch völlig neu erlernen sollte. In der siebten Klasse musste ich mir daher endlich eingestehen, dass ich neben Englisch und Latein auch noch Deutsch als schwerste dritte Fremdsprache zu bewältigen hatte, die völlig von meiner Muttersprache „Oberpfälzisch“ abwich. Zu Hause konnte ich keine Hilfe bekommen, da meine Eltern ausschließlich Dialekt sprachen. Mit meinen besten Freunden redete ich ebenfalls nur Dialekt.
Als ich zu Beginn der siebten Klasse in einer Klassenarbeit in Erdkunde nur Note Drei bekommen hatte, packte mich plötzlich die Wut. Ich wollte es allen zeigen, was in mir steckte – den Lehrern, meinem Vater und vor allem den arroganten Stadtkindern in meiner Klasse. Ich lernte nun wie ein Verrückter und bekam dafür bald die Rechnung serviert: überall gute Noten, außer im Fach Deutsch. Als einziger in der Klasse begann ich daher, Deutschregeln aus einem Buch zu pauken, das mir mein Vater beschafft hatte. So wurden die Rechtschreibfehler und die sogenannten Ausdrucksfehler immer weniger. Dann bekamen wir in der 11. Klasse einen neuen Deutsch- und Geschichtslehrer. Er wurde mein großes Vorbild. Von ihm sog ich alles auf, was ich erfahren konnte. Die Konsequenzen ließ nicht lange auf sich warten.
Denn als ich bald darauf in der ersten Deutsch-Schulaufgabe, einem Besinnungsaufsatz, zwölf große Seiten geschrieben und dafür als einziger die Note Eins in der Klasse erzielt hatte, wollte ich damit sofort zu dem Deutschlehrer laufen, der mich sechs Jahre zuvor fast von der Schule geworfen hätte, und ihm diese Deutsch-Arbeit zeigen. Leider musste ich feststellen, dass dieser mittlerweile als Auslandslehrer in der Türkei tätig war. Ich hätte ihm so gerne mit Wut und Genugtuung meinen Deutschaufsatz unter die Nase gehalten. Spätestens jetzt hatte ich ein Schultrauma überwunden, das mich all die Jahre nicht losgelassen hatte. Nun hatte ich den sichtbaren Beweis erbracht, dass ich auch das Schriftdeutsch gut beherrschte.
Rückblick
Wenn ich heute auf meine eigene Schulzeit zurückblicke, kann ich feststellen, dass neben meinem Vater einige Lehrer mich durch ihr Verhalten in unterschiedlicher Weise beeinflussten und so äußerst wichtig für meinen weiteren Weg waren:
mein Vater durch seine autoritative und unerwartete Entscheidung, mich bereits 1965 gegen alle Tradition in meinem Dorf auf eine höhere Schule zu schicken;
der weitsichtige Volksschullehrer, der mich zur Aufnahmeprüfung am Gymnasium angemeldet und mir Mut gemacht hatte, obwohl ich nur Dialekt sprechen konnte;
der Deutschlehrer der 5. Klasse, der mich vom Gymnasium werfen wollte – eine ganz falsche Einschätzung aus späterer Betrachtung, wohl aber eine verständliche Haltung aus seiner damaligen Sicht; ihm habe ich es zu verdanken, dass ich mich dann vehement dafür engagierte, mit dem Schriftdeutsch eine ganz neue Fremdsprache zu erlernen, um überhaupt am Gymnasium bleiben zu können;
der weitsichtige Schuldirektor, der meine Potentiale erkannte und mich am Gymnasium hielt;
der Deutsch- und Geschichtslehrer ab der 11. Klasse; mit ihm verstand ich mich vom ersten Tag an gut und sog alles von ihm an Wissen und Kompetenzen auf, was ich angeboten bekam.
Es dauerte jedoch über 40 Jahre, bis mir bewusst wurde, dass gerade dieser Pädagoge es war, der mir mein Schriftdeutsch-Trauma vollkommen genommen, meine Leistungen und Fähigkeiten anerkannt, mich letztlich in meiner Persönlichkeitsentwicklung bestärkt und mich geistig am meisten beeinflusst und gefördert hatte.
Warum aber erzähle ich diese persönliche, alte Geschichte überhaupt, die nun fast 50 Jahre zurückliegt? Heute gibt es selbst im dialektgefärbten Bayern kaum noch Schüler, die das Schriftdeutsch nicht beherrschen würden. Oder doch? Meiner Meinung nach gibt es eine sehr aktuelle Parallele zu meiner damaligen Situation von 1965: Auch am Gymnasium sind immer mehr Schüler mit Migrationshintergrund anzutreffen. Sie haben heute mit der deutschen Sprache oft ähnliche Schwierigkeiten wie ich damals als dialektsprechender Junge vom Land. Dieses Argument bekommt durch den enormen Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2015, die in unsere Gesellschaft integriert werden müssen, noch eine zusätzliche, sehr aktuelle Note und Brisanz.57 Und die Lehrer und Schulleitungen haben die Aufgabe zu erkennen, ob solche Schüler bei entsprechender individueller Förderung genügend Potential für eine gymnasiale Bildung haben, selbst wenn sie anfangs noch in großen Sprachschwierigkeiten stecken sollten. Hier sind Weitsicht und Fingerspitzengefühl von uns Lehrern gefragt.
Zudem haben mehrere Pisa-Studien ab 2001 ergeben, dass in Deutschland bis zu 25 (!) Prozent der Schüler deutliche Rechtschreibschwierigkeiten und Leseschwächen haben. Meine damaligen Probleme heute nur in neuer Form? Sprachschwierigkeiten nicht mehr bei Landschülern, sondern bei Kindern mit Migrationshintergrund? Und wie hängen diese Schwierigkeiten mit den sozialen Verhältnissen zusammen, aus denen die Schüler stammen? Ich jedenfalls hoffe, dass ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen immer ein offenes Herz für lernbereite Schüler habe, auch wenn sie zunächst Schwierigkeiten haben sollten. Liegt nicht gerade darin eine zentrale Aufgabe für uns Pädagogen?
Entscheidung für das Lehramtsstudium
Doch wie ging meine eigene Geschichte damals weiter? Mit guten Ergebnissen absolvierte ich 1974 mein Abitur und wurde gleich danach zu den Sanitätern bei der Bundeswehr eingezogen. Dadurch kam ich zum ersten Mal von zu Hause weg und machte an verschiedenen Standorten der Bundeswehr wichtige Schritte zu einem selbständigen Leben: in Regensburg, Amberg und in München. Dennoch ließ mich während all der Monate bei der Bundeswehr eine wichtige Frage nicht los. Da mein jüngerer Bruder studieren wollte, mein jüngster Bruder aber erst sechs Jahre alt war und soeben in die Grundschule kam, wusste mein Vater, dass er sich verkalkuliert hatte. Ich, der im Herzen immer „der“ Bauer gewesen war, war drauf und dran, von zu Hause wegzugehen und zu studieren. Durch sein eigenwilliges Manöver im Jahre 1965, mich gegen meinen Willen aufs Gymnasium zu schicken, hatte er womöglich einen potentiellen Hoferben verloren.
Daher probierte es mein Vater an den Wochenenden während meiner Bundeswehrzeit immer wieder, mich als Hoferben zurückzugewinnen. Er wollte es mir schmackhaft machen, jetzt doch bei ihm in den Betrieb einzusteigen. Denn er hatte hochfliegende Zukunftspläne. Er wollte weitere Äcker kaufen und den Hof vergrößern. Dazu brauchte er jedoch unbedingt meine Hilfe und zwar sofort.
Dieses Ansinnen meines Vaters erzeugte in mir große Schuldgefühle. Sollte ich also doch Bauer werden, was mein ursprüngliches Ziel war? Aber wozu dann die neunjährige Büffelei am Gymnasium? Noch zehn Jahre zuvor hätte ich mir ja gar nichts anderes vorstellen können. Zudem wusste ich noch nicht, was ich werden sollte, wenn ich den Bauernhof ausschlug. Ich kannte ja nur einen weiteren Beruf aus eigener Anschauung: den Lehrerberuf als echte und realistische Alternative. Diese Tätigkeit zog mich auch deshalb an, weil ich ja neun Jahre lang in meiner eigenen Klasse hautnah viele verschiedene Lehrer erlebt hatte. Einige von ihnen, besonders der Deutschlehrer der Oberstufe, hatten mich durch ihre Fachkenntnisse, ihr Engagement und durch ihre Integrität völlig überzeugt. Das Berufsbild „Gymnasiallehrer“ wurde mir so immer mehr vertraut und stellte nun eine wirkliche Alternative zum Berufsbild des Landwirts dar. Welche Fächer aber sollte ich studieren? Fragen über Fragen.
Ich redete mit vielen Bundeswehrkameraden. Was sollte ich nach Ende des Wehrdienstes tun? Durfte ich denn überhaupt studieren? Oder hatte ich als Erstgeborener nicht eine Art von uralter „archaischer Pflicht“, den von Eltern und Großeltern als „heilig“ deklarierten Bauernhof doch zu übernehmen, obwohl ich mittlerweile sehr viel Freude an geistigem Wissen gewonnen und ein gutes Abitur hingelegt hatte.
Ein zehnwöchiger Sanitätskurs während der Bundeswehrzeit in München gab dann den Ausschlag. Die wunderbare Großstadt München mit ihrem pulsierenden internationalen Leben, neue Freunde, die ich dort kennenlernte, sowie einige Ausflüge in die traumhafte Landschaft der Alpen und der Oberbayerischen Seen brachten mich „Ländler“ in eine völlig andere, „höhere Schwingung“. Bei einem der wenigen Wochenendbesuche zu Hause während dieses Kurses fragte mich mein Vater erneut, was ich nach Ende der Bundeswehrzeit zu tun gedenke und ob ich ihm nicht doch auf dem Bauernhof helfen wolle.
Da antwortete ich ihm, für mich selbst überraschend, Folgendes: „Lieber Vater, ich möchte mich lieber mit Menschen beschäftigen und nicht mit Feld und Vieh!“ Dieser Satz war wie ein Donnerschlag für meinen Vater und auch für mich. Ich weiß bis heute nicht, woher diese Worte kamen. Aus meinem bewussten Verstand, der beständig im Grübeln und Abwägen war, kamen sie jedenfalls nicht. Sie stiegen offensichtlich aus einer bis dahin nicht geahnten, mir unbewussten tieferen Seelenschicht hoch und führten zur Entscheidung: Im November 1975 begann ich mein Studium in Regensburg für das Lehramt an Gymnasien, genauer gesagt für die Fächer Physik und Katholische Religionslehre.
Reflexion
Wieder können Sie, lieber Leser, zu Recht fragen, warum ich diese alte Geschichte von mir denn überhaupt erzähle. Sie stammt doch aus einer ganz anderen Zeit. Das stimmt sicher. Aber meine damalige Lage nach dem Abitur und während der Bundeswehrzeit kann durchaus exemplarisch auch für die Situation heutiger Abiturienten gelten: Viele von ihnen wissen nicht, was sie nach ihrem Abitur machen sollen. Und wenn sie dennoch gleich ein Studium nach dem Abitur beginnen, brechen viele von ihnen es wieder ab, weil sie sich eingestehen müssen, dass sie sich in der geschützten Atmosphäre der Schule alles anders vorgestellt hatten. Die Abbruch-Quote in den sogenannten MINT-Fächern an der Uni liegt sogar bei etwa 50 Prozent!58
Die bewusste Entscheidung für eine Ausbildung oder für ein Studium kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich beneide die jungen Leute nicht, die bisweilen unter einem großen Druck stehen, die richtige Entscheidung über ihren zukünftigen Beruf treffen zu müssen, den sie oft noch gar nicht kennen oder von dem sie höchstens vage Vorstellungen haben. Erst kürzlich habe ich einen ehemaligen Abiturienten getroffen, der seit fünf (!) Jahren rumhängt, mehrere Studiengänge angefangen und wieder abgebrochen hat und noch immer nicht weiß, was er werden will. Darum werde ich nicht müde zu betonen, dass man als junger Mensch zuerst wissen muss, wer man ist, um dann eine tragfähige Entscheidung darüber treffen zu können, was man werden oder beruflich machen will. Hier sind wir beim Thema „Initiation“ angelangt, das einen Schwerpunkt in diesem Buch darstellen wird.59
Doch nochmals kurz zurück zu meiner damaligen Situation als junger Abiturient. Die 15-monatige Bundeswehrzeit war für mich wie ein Moratorium. Während dieser Zeit konnte und musste ich nachdenken, viele Aspekte in meine Überlegungen einbeziehen und zuerst wichtige Erfahrungen machen. Dann aber kam eine Entscheidung ganz aus meinem Inneren, die sich später als tief fundiert herausstellte. Vordergründig wollte ich damals Lehrer werden, weil ich dem engen „Arbeitsreich“ meines Vaters entkommen wollte. Gleichzeitig war mir geistiges Wissen während der eigenen Gymnasialzeit viel wichtiger geworden als die Arbeit als Landwirt. Vor allem in dem Deutschlehrer in der Oberstufe hatte ich ein mit meinem Vater konkurrierendes Vorbild erhalten. Außerdem war ich sehr neugierig auf meine beiden Fächer, die ich für das Lehramtsstudium gewählt hatte: Physik und Religion – eine herausfordernde und zugleich höchst interessante Kombination.
In der Tiefe ging es bei dem ganzen damaligen Konflikt für mich jedoch noch um eine andere Frage: Zwei wirklich fundamentale und archaische Werte konkurrierten in mir miteinander: Hoferbe und Landwirt zu werden und damit eine lang gehegte Sehnsucht in meinem Familiensystem zu erfüllen; oder als Pädagoge so etwas wie ein „geistiger Bauer“ zu werden, der Wissen und Werte sät, Jugendliche begeistert und sie auf ihrem Weg durch die Pubertät und hin zum Erwachsensein begleitet. Über ein Jahr lang kämpfte „es“ in mir, ich wurde von Schuldgefühlen gequält, die mich an die Scholle binden und mich nicht in die neue, unbekannte Welt des Wissens und der Pädagogik ziehen lassen wollten.
Dann setzte sich offensichtlich die stärkere Stimme in mir durch und ich begann mit dem Studium.
Unterstützung bekam ich von meinen Eltern nicht mehr. Jetzt war ich mir selbst überlassen. Ich musste meiner eigenen Kraft vertrauen, das Studium zu schaffen und danach eine Stelle als Lehrer zu bekommen – eine wirklich jahrelange existentielle Herausforderung für mich. Auch für meine damalige Situation gibt es heute genügend aktuelle Parallelen:
Söhne, deren Eltern ein Unternehmen oder einen Handwerksbetrieb haben, wollen oft nicht in das Geschäft der Eltern einsteigen, sondern etwas ganz anderes machen – gegen den Willen ihrer Eltern.
Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund müssen sich im deutschen Schulsystem trotz Sprachschwierigkeiten durchbeißen, ohne dass ihnen ihre Eltern noch helfen können.
Kinder von Handwerkern oder Arbeitern sollen als erste Generation eine höhere Bildung bekommen. Damit sind sie in einer ähnlichen Situation wie ich damals.
Viele Abiturienten wissen nicht, was sie studieren sollen und müssen ebenfalls innere Kämpfe mit sich ausstehen. Daher reisen viele von ihnen erst einmal für einige Monate oder für ein ganzes Jahr ins Ausland, um sich selbst zu finden und zu erspüren, wo ihre wirklichen Stärken und Neigungen, auch beruflich, liegen könnten.