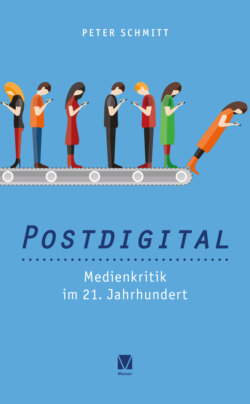Читать книгу Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert - Peter Schmitt - Страница 10
Kapitel 2 Emotionen Mediale Emotionen
ОглавлениеDer entscheidende Moment in der Lieblingsserie, die euphorische Sequenz im Game, die Verfolgung des viral gehenden Posts wird jäh unterbrochen von einem dringenden Anliegen einer realen Person. Die mediale Emotion steht urplötzlich in direkter Konkurrenz mit den Affektkonventionen der realen Welt. Und obwohl das echte Bedürfnis der realen Person im unmittelbaren Umfeld objektiv gesehen als wichtiger einzuordnen ist als die eigene mediale Sentimentalität, kann man sich – für den Moment zumindest – emotional vom Medium nicht lösen. In den meisten Fällen folgen die Überwindung und das dämmernde Pflichtbewusstsein der realen Interpersonalität. Das scheint aber oft nur oberflächlich vonstatten zu gehen. Man gibt zwar dem Insistieren nach, das emotionale Sicheinlassen will aber nicht wirklich gelingen.
Das hat seinen Grund: Mediale Emotionen können zum einen sehr mächtig sein und zum anderen die in der Realität erzeugten Emotionen verdrängen und verhindern. Heutige Erkenntnisse aus der Emotionsforschung bestätigen die Idee der sich selbst verstärkenden medialen Emotionen. Die emotionale Aufladung der medialen Situation – egal ob romantischer Liebesfilm im Fernsehen oder der spannende Ego-Shooter – erzeugt ihr Korrelat im Menschen. Je intensiver und regelmäßiger die Immersion, desto radikaler und nachhaltiger die morphologische Veränderung neuronaler Netzwerke im Gehirn.18 Zur Gewöhnung an eine neue virtuelle Umwelt in Social Media bspw. entstehen neue Gefühlsnuancen, die für sich stehen können und auch müssen.19 Die mediale Sentimentalität entwickelt eine Eigendynamik, wobei hier medienspezifische Gedächtnisinhalte eine zentrale Rolle spielen. Ein einfaches Prinzip lässt sich hierbei erkennen: Je mehr mediale Emotionen, desto mehr bedingen die früheren medialen Erfahrungen dabei Anknüpfungspunkte und somit weiterführende und sich intensivierende Affekte. Die Überlegung mag simpel sein, verweist jedoch auf die höchst komplexe Plastizität unseres psychischen Apparats. Gefühle sind keine unveränderbare Dimension des Menschen. Sie sind dehnbar, einschnürbar, in verschiedenste Richtungen lenkbar. Und doch ist man ihnen ausgeliefert. Die in der Vergangenheit liegenden verschiedenen Dehnungen und Einschnürungen, genannt Konditionierungen, machen jeden zu einem individuell Fühlenden. Sie geben dem Einzelnen seine emotionale Identität.
Medien spielten in diesem Zusammenhang auch auf überindividueller Ebene schon immer eine essentielle Rolle. Denn »Medien beeinflussen Formen der Raum-, Gegenstands- und Zeitwahrnehmung. Sie sind aufs Engste mit der Sinnengeschichte der Menschheit verbunden […]. Und es gilt: Wie die Menschen sehen und was sie sehen, ist alles andere als selbstverständliche Physiologie, vielmehr handelt es sich um komplexe Kulturprozesse, die vielfältigen gesellschaftlichen und medientechnischen Innovationen unterliegen, Prozesse, die sich in unterschiedlichen Kulturen spezifisch ausgeprägt haben«20. Die unterschiedlichen Kulturen, die heute über den Erdball verteilt sind, sind derzeit dabei, sich technisch zu synchronisieren. Die digitale Monokultur führt gerade auf emotionaler Ebene zu einem Verlust an Identität nicht nur bei Einzelpersonen, sondern ganzer Kulturkreise. Emotionen werden zwar nicht absorbiert, sie sind nicht einfach weg. Sie verlagern sich und entwickeln sich dynamisch fort. »Die Ankoppelung der Emotionen an die Medialität der technisch-apparativen Audiovisionen, die Bindung der Gefühle an mediale Produktionen, technische Bilder und Töne, die audiovisuelle Form« verändern »die Emotionskultur tiefgreifend«21. Dabei werden die medialen Emotionen auf der einen Seite intensiver. Auf der anderen Seite lassen sie aber auch nach und verlieren sich in den Weiten der Angebote. Das Verlieren bestimmter Affekte beim Medienkonsum veranschaulicht Günther Anders anhand eines »marionettenhaften Auto-Rennens« im Fernsehen, bei dem »selbst der tödliche Unglücksfall gar nicht so schlimm wirkte: zwar weiß man, dass, was man da soeben mit-erlebt hat, sich wirklich soeben, im selben Augenblick, da man es auf dem Schirm sah, abgespielt hat; aber man weiß es eben nur; das Wissen bleibt doch ganz unlebendig; das winzige Bild, mit dem irgendwo dort hinten Geschehenden, das hiesige Jetzt mit dem dortigen in Kongruenz zu bringen, also das Jetzt als wirklich gemeinsames, als ein und dasselbe dort-und-hier-Jetzt aufzufassen, gelingt nicht; also bleibt auch die Erschütterung klein und imaginär; beträchtlich kleiner sogar, als Erschütterungen, in die uns fiktive, auf der Bühne stattfindende Katastrophen versetzen.«22
Verblüffend aus heutiger Sicht ist zunächst die unbestreitbare Gültigkeit dieser Analyse. Die gesamtgesellschaftliche Gewöhnung an medial aufgearbeitete Katastrophen muss als Element einer flächendeckenden Abstumpfung verstanden werden. Das hat auch einen einfachen emotionsökonomischen Grund: Wir können es uns aus quantitativen Gesichtspunkten nicht mehr leisten, beim Anblick einer beliebig aus dem Weltgeschehen gegriffenen Katastrophe jedes Mal wirklich emotional affiziert zu sein. Die Menschen würden in permanenter Betroffenheit durch die Gegend taumeln. Wie wir weiter oben gesehen haben, stimmt aber die gegenteilige Behauptung der emotionalen Aufladung des Alltags auch: Die Menschen werden über die digitalen Kanäle unablässig emotionalisiert – der heitere Klingelton, das emotional besetzte Hintergrundbild, die exaltierte Sprachnachricht, der unendliche Schwall sentimentaler Popmusik, das farbenfrohe Display … Wie unter einem Brennglas verdeutlicht der YouTube-Algorithmus die ambivalente Lage. Die aufgefahrene Nebeneinanderstellung von beliebigen Inhalten hat ihre höchst diffuse Wirkung. Da erscheint ein putziges Kätzchen-Video neben dem in Zeitlupe feilgebotenen Sturz eines Menschen aus einem der Türme des World Trade Center, ein Volkswagen-Werbeclip vor der Hitler-Dokumentation. Die völlige Disparatheit der Inhalte erfährt über die personalisierten Algorithmen im Internet eine Klimax, die den Einzelnen auf der einen Seite in eine emotionale Schockstarre versetzt. Gleichzeitig laden sie ihn emotional auf und nötigen ihn zur permanenten Sentimentalität.
Mediale Emotionen sind meistens solistisch empfundene Sentimentalitäten, die sich auf kein reales Ereignis beziehen, das in direktem Bezug zur betroffenen Person steht. Der Einzelne erfährt sich über Medien oft hochgradig emotionalisiert und gleichzeitig banalisiert. Der Gamer, der nach zehn Stunden Spiel gefühlsleer die Konsole herunterfährt, hat seine Lebenszeit nicht etwa mit der Verschwendung von Emotionen verbracht, sondern mit einer hoch emotionalen Tätigkeit, die in keinem Verhältnis zu einem realen Gegenstand steht. Schlecht fühlt er sich aufgrund der Banalität der eigenen emotionalen Höhenflüge. Der Konsument romantischer Popmusik in der Straßenbahn wäre ein anderes Beispiel für einen hoch emotionalisierten und gleichzeitig abwesenden, also solistisch sentimentalen Menschen. Die besungene Sehnsucht, die orgiastischen Refrains, das akustische Lametta hat nicht nur keinerlei Bezug zur realen Situation in der Straßenbahn, sondern hebt den Einzelnen mit seinen Kopfhörern emotional in Sphären, die für einen Menschen im Mittelalter wahrscheinlich nicht ohne kardiologische Folgen geblieben wären. Die reale Situation selbst ist unverändert dröge und langweilig. (Den vielen positiven Aspekten von romantischer Musik in der öden Straßenbahn soll hier nicht prinzipiell widersprochen werden.) Die Dimension der medialen Emotionalität wird erst in der Summe zu einem Problem. Der Popsongmix in der Straßenbahn, die gruselige Serie auf Netflix, das nervenaufreibende Game, die lustigen Posts und Kommentare auf Instagram, der nervöse Austausch über WhatsApp. die euphorischen Selfies: die Menge der medialen Emotionen macht die Thematik erst so schwierig und widersprüchlich.