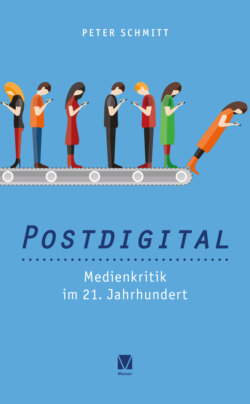Читать книгу Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert - Peter Schmitt - Страница 6
Prolog
ОглавлениеDer Leiter des Persuasive Tech Labs der Stanford Universität stellte kürzlich folgende Prognose via Twitter ins Netz: »A movement to be ›post-digital‹ will emerge in 2020. We will start to realize that being chained to your mobile phone is a low-status behavior, similar to smoking«1.
›Postdigital‹ verweist in dieser Prognose nicht auf eine nachdigitale Zeit ohne Computer und Internet – im Gegenteil. Es geht um ein neues Verständnis des Digitalen und ein damit zusammenhängendes neues Selbstverständnis der Anwender. Bildung (respektive »High-status«-Verhalten) der Zukunft wird zu einem beträchtlichen Teil auf dem kritischen Umgang mit den Bildschirmen beruhen. Das »Low-status«-Verhalten hingegen wird sich bei denen weiterhin festigen, die sich nicht auf die Entwicklung hin zu mehr kritischer Auseinandersetzung einlassen. Zwei grundlegende Charakteristika werden dem Postdigitalen vorausgesagt: ein technisches – das Verschwinden der Computer als Apparaturen und deren Implementierung in die Umwelt – und ein geistiges – das zu sich kommende Bewusstsein einer Gesellschaft über die unwahrscheinliche Lage, in die sie sich manövriert hat. Letzteres ist Thema des vorliegenden Buches. Es versammelt die wichtigsten Aspekte einer zeitgemäßen Medienkritik.
Der kritische Umgang selbst ist sicherlich keine Neuheit, in weiten Teilen der Gesellschaft jedoch unterschiedlich ausgeprägt und akzentuiert. Er folgt zumeist einer vagen Vermutung, einer diffusen Ahnung, dass etwas nicht stimmen könnte. Das ist nicht zufällig so, denn der Verdacht, dass etwas grundlegend falsch läuft, wird genährt durch die allgegenwärtigen und zur Normalität avancierten Absurditäten des digitalen Alltags: Das gruselige Bild der massenhaft gesenkten Köpfe über den Bildschirmen, die vereinheitlichenden Massenapps, die endlose und leere Selbstbespiegelung ihrer Anwender, der Wegfall von informationeller Autonomie, die black-box-artigen Hochleistungsrechner in den Händen von Heranwachsenden und nicht zuletzt die Echtzeitvernetzung gewaltbereiter Milieus: sie verweisen letztlich auf einen Trend, an den sich viele – höchst nachvollziehbar – nicht gewöhnen wollen. Ziel dieses Buches ist aber nicht primär die Verurteilung, das Monieren eines negativen Zustandes. Vielmehr geht es um den unverstellten Blick, das genaue Hinsehen und die nachvollziehbare Analyse. Die Wirkungen der verlockenden und gleichzeitig unheimlichen Apparate, die wir so tief in unser aller Leben integriert haben, müssen rational beurteilt werden. Es geht also nicht primär darum, etwas (wie das Rauchen oder die Smartphonesucht) als schlecht darzustellen. Das wäre zu einfach. Keine Verteufelung der uns umgebenden Technik und keine ängstliche Schutzhaltung werden empfohlen, sondern eine fundierte kritische Haltung. Denn erst im Zuge einer tiefen Auseinandersetzung lässt sich eine selbstbewusste Einschätzung vornehmen, die uns als Menschen und als Gesellschaft weiterbringt.
Die Artikulation von Kritik selbst ist aus medientheoretischer Sicht vor allen Dingen eines: die Parteinahme für unser primäres Medium, die »Sprache«. Sie befindet sich schon seit einiger Zeit in der Defensive. Ein Grund ist der Siegeszug der binären Codierung. Diese umgibt uns heute wie eine zweite Natur und ihre Wirkung ist in allen Bereichen der Gesellschaft, bis in unsere intimsten Regungen hinein, zu spüren. Aus ihr folgt die Auflösung von semantischem Gehalt. Begriffe gehen nicht mehr in einer bestimmten Bedeutung auf. Die digitale Verrechnung löst zum Beispiel »das Besondere« auf und streut es überall hin. Paradigmatisch hierfür sind – wie in jeder Phase der kulturellen Umbrüche – die Künste: »Musik heute ist wie Gas, Wasser oder Strom. Wir drehen den Hahn auf und haben, was wir wollen. Der Gedanke, dass etwas interessant ist, weil es selten ist, verschwindet. Fast nichts ist besonders.«2
Erst langsam, dann immer schneller werdend rotieren Besonderheiten aller Art um ein hochfrequent rechnendes Vakuum, das alles zerkleinert und zur Zahlenkolonne schreddert. Emotionen verlieren sich darin, Freiheit wird zu invertierter Freiheit. »Jeden Tag erleben wir mehr Vielfalt als jemals zuvor. Aber sie ist nicht wirklich vielfältig.«3 Nicht nur Musik, sondern alles medial Aufgearbeitete wird zwar virtuell facettenreicher, verliert real aber gleichzeitig an Kontur und Substanz. Als würde die Entwicklung sich selbst überspielen wollen, strahlt und schreit alles grell und laut aus den Bildschirmen und Lautsprechern. Vielfalt stürzt in ihr Gegenteil. Sie ist zwar da, aber eben nur als Ergebnis von Rechenleistung. Analoge Besonderheiten gibt es auch noch (und sie werden bleiben), verlieren aber in der Verrechnung automatisch an idiosynkratischer Qualität. Individualität steht zur Disposition, Gedächtnisleistung, Erkenntnis, Liebe.
Die totale Computerisierung entwickelt schon seit Jahren eine mahlstromartige Dynamik. Sie ist aber mittlerweile so unnachgiebig wie ein Schwarzes Loch. Sie zerrt uns alle in eine Existenzweise hinein, für oder gegen die wir uns nicht entscheiden können. Inhalte und die Wahrnehmung selbst wirbeln darin unaufhaltbar in die 0-te Dimension. Die Möglichkeiten sind darin unendlich und zugleich negiert. Nichts ist in ihr von Bestand. Der Satz lässt sich in Zeiten von juristischen Erwägungen zu maschinellem »Vergessen« aber auch umkehren. Einmal hochgeladen, bleibt es für immer bestehen. In solchen Widersprüchen bündelt sich die Gewalt des Umbruchs. Kann man überhaupt noch semantisch fassen, was passiert? Viele Begriffe verweisen mittlerweile sogar auf ihr Gegenteil: Gefühl wird zur Logik, Information zur Desinformation, Freiheit zum Zwang, Technik zum Mythos, Individualität zur Anpassung. Was hat das zu bedeuten?
Im Folgenden wird diese in vielerlei Hinsicht denkwürdige Entwicklung unter die Lupe genommen. Hierbei soll keine verstiegene Sprachphilosophie anvisiert werden. Es geht um die konkrete Situation des Einzelnen und der Gesellschaft mit den zu jeder Zeit perfekt funktionierenden Maschinen. Letztere werden nicht nur genutzt. Ihre Programme werden nicht nur angewandt. Sie haben – auch wenn viele von uns das nicht wahrhaben wollen – einen massiven Einfluss auf unser Denken und Fühlen. Sie wirken mit ihrer bloßen physischen Präsenz. Sie prägen mit ihrer inneren Struktur. Sie machen uns, ohne dass wir es wollen, zu technoiden Wesen. Wichtig (oder mittlerweile vielmehr überlebenswichtig) ist es, hier, so oft es geht, einen Schritt zurück zu machen und sich das gesamte Bild anzuschauen. Die psychologische wie emotionale Notwendigkeit dieser Distanzierung macht die Erarbeitung einer fundierten Medienkritik wichtiger denn je.
Der Begriff »Medienkritik« selbst erscheint wie ein Relikt aus der Vergangenheit. Er wird gegenwärtig reduziert auf die populistische Verurteilung von Medienhäusern. Insofern üben Donald Trump und die AfD Medienkritik, wenn sie die Berichterstattungen großer Medienhäuser rügen.4 Das eindimensionale Verständnis wird hier zum Anlass genommen, in die Tiefen der eigentlichen Bedeutung von Medienkritik vorzudringen. Dies beinhaltet den Rückbezug auf primäre Medien wie Sprache, Bilder und Musik. Dabei geht es nicht so sehr um die Inhalte, sondern um das eigentümliche Verhältnis des Menschen zu seinen Medien. Medienkritik – wie hier vorgestellt – bewegt sich in einem freien Feld zwischen Medientheorie, Anthropologie, Emotionsanalyse und Gesellschaftstheorie. Sie versteht sich als progressiv, obwohl (oder gerade weil) sie dort konservativ ist, wo es um die letzten Residuen von Freiheit geht. Was bedeutet eigentlich Freiheit im Zeitalter der fremdbestimmten Datenwolken?
Medienkritik ist Rückzugspunkt aus dem umfassenden digitalen Abhängigkeitsverhältnis, das heute jedem apriorisch zukommt. Sie ist Aufforderung zum Neinsagen. Sie ist Einladung zur genauen Analyse, zum gedanklichen Verweilen vor der Unwahrscheinlichkeit der Situation. Sie ist auch humanistische Philosophie und getragen von der Neugier auf die verborgenen Qualitäten des menschlichen Geistes selbst. Die werden leider immer mehr von dem computerisierten Wahnsinn, der uns umgibt, verdrängt. Ohne es zu wollen, befindet sich der sensible Einzelne im permanenten Kampf mit der Maschinerie. Der Kampf, die Tragik selbst werden überstrahlt von den stets verabreichten, bunt bewegten Verheißungen. Dabei geht es um nicht weniger als die Verteidigung des Menschen als souveränes und aufgeklärtes Wesen. Denn die umfassende Implementierung der digitalen Maschinen erzeugt eine neue Bedingung unseres Daseins. Sie wirft konkrete Fragen auf, die an unser Selbstbild und an unsere Emotionen rühren. Wie fühlen wir uns inmitten der totalen Verrechnung unseres Lebens? Was bedeutet Freiheit in permanenter digitaler Koexistenz? Welchen Wert hat heute noch ein Bild? Welchen Wert hat Musik? Ist der Mensch überhaupt noch das Subjekt der Geschichte? Oder wohnt er der technologischen Entwicklung nur noch ko-substantiell bei? Können wir beim Anwender der Massenprogramme noch vom Individuum sprechen?