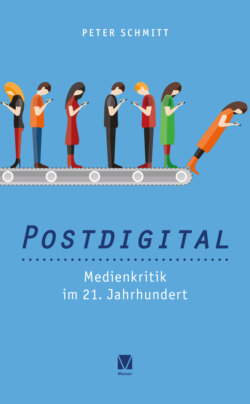Читать книгу Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert - Peter Schmitt - Страница 9
Beobachtung und Transparenz
ОглавлениеIn der verwalteten Welt herrschen weitere Gesetze. Eines hat sich unmerklich in jede menschliche Beziehung eingeschlichen: das Gesetz der wechselseitigen Kontrolle. Da heute jeder ein Smartphone mit sich herumträgt und sein Leben digital dokumentiert, sprich: Fotos und Filme von den banalsten Momenten, bis hin zu den wichtigsten, den ersten Schritten des Kindes beispielsweise, anfertigt und teilt, findet eine fast umfassende Form der privaten gegenseitigen Überwachung Eingang in den Alltag der Anwendercommunity. Es ist in der Tat nicht mehr ohne weiteres möglich, alltäglichen Aktivitäten ohne potentielle digitale Aufzeichnung beizuwohnen. Sobald man sich in Gesellschaft begibt, läuft man Gefahr, fotografiert oder gefilmt zu werden. Die Rede ist von nicht weniger als einer neuen Facette unseres Daseins, die mit den geteilten Bildern der Geburt beginnt. Die gegenseitige Aufzeichnung birgt Gesetzmäßigkeiten der strukturellen Überwachung in sich, die Foucault als »pausenlos überwachte Überwacher […] in einer Maschinerie, die funktioniert«14 charakterisierte. Die Effekte, vor allem für diejenigen, die eine lückenlose Smartphonenutzung des »always on« kultivieren, sind beträchtlich. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass hier ganze Facetten ihres Lebens nach der digitalen Aufzeichnung ausgerichtet werden. »We are« – um es mit den Worten des italienischen Künstlers Alessandro Ludovico zu sagen – »kind of voluntary agents of surveillance. And […] there is this absolutely crazy social mechanism of mutual surveillance«15.
Die von Foucault beschriebenen Beziehungsnetze der sich gegenseitig Überwachenden umgeben dabei den Einzelnen und stellen so etwas wie eine zweite soziale Umwelt dar. Bei genauerem Hinsehen findet diese in der Kultur der Offenheit samt Modus des »always on« eine erschreckend lapidare Verwirklichung. Über die beständige Verbindung via WhatsApp wird eine Lebensform der durchgehenden Kontrolle kultiviert, die den Einzelnen mehr oder weniger in eine stringente reaktive Haltung zwingt. Wer nicht antwortet, befindet sich umgehend im Rechtfertigungszwang. Das pausenlose, über den ganzen Tag ausgedehnte kommunikative Moment wird zu einem infiniten Regress. Der homo communicans in der denkbar radikalsten Form findet sich in einer Endlosschleife der Beobachtung von Beobachtenden wieder, könnte man sagen. Wer nicht mitmacht, wird zu einer ganz eigenen Art von »Mängelwesen«, zum reduzierten »homo medialis«, zu einer Kreatur, die sich nicht auskennt, die nicht medienkompetent ist und – was letztlich entscheidend ist – nicht an der neuen Lebensform des sharing teilnimmt. Der Mensch ist auf sonderbare Weise in seiner medial-»exzentrischen Positionalität« nicht mehr wirklich exzentrisch, wenn er nicht Zugang zu einem Touchscreen hat, mit dem er seine Mitmenschen beobachten kann. Er entwickelt dabei – wie im Kontext anderer Medienentwicklungen – ein Selbstbild, das dieser speziellen medialen Situation entspricht. Die Kultur des pausenlosen Beobachtens ist auch eine Kultur des ständigen Bewertens. Der Mensch ist ein ständig beobachteter und bewerteter Beobachter und Bewerter.
Ein weiteres Gesetz der totalen verwalteten Welt ist das der Offenheit. Während für viele bereits Privatheit ein Begriff der Vergangenheit ist und wir in einer Ära der »Transparenz« leben, nimmt sich die tatsächliche Praxis einer offenen Lebensführung im Alltag der Menschen oft nicht ganz so freiheitlich aus, wie vielleicht ursprünglich gedacht. Ein Beispiel: Das Erstellen eines Accounts bei beliebigen Social-Media-Plattformen, Nachrichtendiensten oder Messenger-Apps setzt die Eingabe der persönlichen Grunddaten (Name, Alter, Telefonnummer) voraus. Offenheit erfüllt hier offensichtlich den einfachen Zweck des Zugangs. Der Deal ist simpel und mittlerweile in das gesamtgesellschaftliche Grundverständnis in Form einer hinzunehmenden digitalen Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Inanspruchnahme des Internets eingegangen. Einmal im sozialen Netzwerk angekommen, setzt sich für gewöhnlich die vielleicht an sich gut gemeinte Idee der digitalen Offenheit in die Unzulänglichkeiten der alltäglichen Praxis fort. Dabei kommt zunächst die oben beschriebene Gesetzmäßigkeit erfolgreicher Posts in Gang: Je persönlicher, je emotionaler und je geschickter kontextualisiert, desto größer die Resonanz. Mit diesem Wissen im Hinterkopf verkehrt sich die vielleicht anfangs tatsächlich zweckunabhängig praktizierte Offenheit schnell in ihr Gegenteil. Das Posten persönlicher Inhalte wird von da ab auf die antizipierte Resonanz in der Community abgestimmt. Auch hier ist der Akt genuiner Offenheit nicht wirklich das eigentliche Thema. Es ist vielmehr ein Handel, auf den sich der Einzelne einlassen muss (gesetzt den Fall sie/er möchte erfolgreich kommunizieren). Es entstehen dabei die berüchtigten Like-und-Kommentar-Kartelle. Wer viel »liket«, erwartet auch viele Likes als Gegenleistung.
In diesem Zusammenhang festigt sich aber auch eine besondere Form des Aufmerksamkeitskapitalismus: Wer viel hat, dem wird viel gegeben. Wer wenig hat, dem wird wenig oder nichts zuteil. Genuine Offenheit kann vor diesem Hintergrund schnell etwas Unangenehmes werden. Äußerungen von persönlichen Momentaufnahmen, die unkommentiert bleiben, deuten unterschwellig auf eine zweifelhafte Stellung in der Online-Peergroup hin. Oder, was noch schlimmer ist, die Banalität eines »Posts« führt einen Abstieg im Anerkennungskontinuum des Sozialen Mediums herbei. Was bei sich weltweit verbreitenden Techniken aus einem bestimmten Teil der Erde nicht ausbleibt, ist die Mitverbreitung einer bestimmten regionalen Mentalität.
Offenheit gilt in Kalifornien als Lebensform, als way of life. Man wird sich in San Francisco an jeder Straßenecke mit jemandem unterhalten können. Und man wird insbesondere als Deutscher überrascht sein, wenn die Tiefen des Gesprächs bisweilen bis in die persönlichsten und tragischsten Details des Lebens des jeweiligen – beliebig gewählten – Gesprächspartners hineinreichen. Was immer man davon halten mag – die weltweit digital verbreitete Mentalität steht plötzlich mit den regionalen Landesmentalitäten in direkter Konkurrenz. Diese hochinteressante Entwicklung, die McLuhan mit seiner Theorie des Global Village antizipiert hatte, legt zunächst nahe, auf den allseits postulierten Wert der Offenheit mit einem Verständnis für Hintergründe der genutzten Programme samt ihrer Formbestimmtheiten und der Herkunft der Programmierer zu reagieren. Chris Kelty – ein kalifornischer Anthropologe – beschreibt die ambivalente Situation hinsichtlich des Wertes der Offenheit folgendermaßen: »Offenheit tendiert zur Vernebelung. Jeder (Kalifornier Anm. d. Verf.) behauptet, offen zu sein, jeder möchte etwas mitteilen, alle (Kalifornier Anm. d. Verf.) stimmen darin überein, dass es wichtig ist, offen zu sein […]. Aber obwohl sie so klar erscheint, ist ›Offenheit‹ vielleicht der komplexeste Aspekt von freier Software.«16 Kelty ahnt, dass die naive Mentalität der konsequenzlosen Offenheit im Internet neu bewertet werden muss, und stellt im Sinne Immanuel Kants die wichtige Frage nach der Motivation zu Offenheit. »Ist Offenheit gut an sich, oder ist Offenheit ein Mittel, um etwas anderes zu erlangen – und wenn ja, was?«17