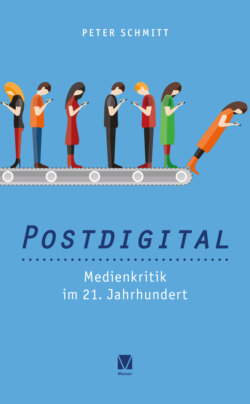Читать книгу Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert - Peter Schmitt - Страница 8
Digital verwaltete Welt
ОглавлениеUnd diese Äußerungen des Allgemeinen werden in jeder Serverfarm, jeder Cloud sauber gelistet, gespeichert und verwaltet. Mitte des letzten Jahrhunderts erkannten Adorno und sein Freund Max Horkheimer bereits eine eigenartige Verschwisterung der Kulturindustrie mit den Institutionen der Verwaltung. »Der Generalnenner der Kultur enthält virtuell bereits die Erfassung, Katalogisierung, Klassifizierung, welche die Kultur ins Reich der Administration hineinnimmt.«9 Die Übersichtlichkeit der Profile, die lückenlose statistische Erfassung aller eingegebenen Daten, die geordnete Chronik, die exakten Uhrzeiten zu den banalsten Äußerungen, die saubere Auflistung der Kontakte verweisen heute auf einen neuen Modus der totalen Verwaltung. Kritik an der umfassenden Bürokratisierung des Lebens in modernen Industrienationen war bis vor kurzem noch allgegenwärtig. Seit Kafkas Urszene des Ausgeliefertseins vor einer anonymen und übermächtigen Verwaltung haben sich unzählige Autoren und Regisseure an ihr abgearbeitet. Das hat bis heute auch seinen nachvollziehbaren Grund. Die sachliche Distanz und gleichzeitige unmittelbare Nähe der behördlichen Erfassung hatte schon immer etwas Kaltes, Entwürdigendes an sich. Das Individuum vor der namenlosen und gewaltigen Maschinerie, ohnmächtig vor dem endlosen Arbeitsbetrieb der Administration, in der es nur noch Nummer, nur noch Bestandteil des unpersönlichen Ganzen ist.
Das Thematisieren der Absurdität bürokratischer Verfahren, deren immenser Einfluss auf das Leben der Vielen, hat merkwürdigerweise über die letzten Jahrzehnte immer weiter nachgelassen. Und dies, obwohl der Mensch heute mit seinen Geräten stets eine Käseglocke der Verwaltung mit sich herumträgt. In ihr wird unentwegt erfasst, katalogisiert, klassifiziert. Eine streng algorithmisierte Datenwolke umgibt jeden Anwender und aus ihr auszubrechen ist de facto nicht mehr möglich. Es gibt in der frühen Fernsehära bereits kein Ausweichen, keinen »Standort außerhalb des Getriebes«10. Die lückenlose Vernetzung der Kanäle der Kulturindustrie (bestehend aus dem heute harmlos anmutenden dreikanaligen Schwarz-Weiß-Fernsehen, dem analogen Radio und dem Printbereich) lässt damals schon alle möglichen Schlupfwinkel verschwinden. Das damalige Verschwinden der Schlupfwinkel mutet heute jedoch fast lächerlich an, vergegenwärtigt man sich die zu jeder Zeit mitgeführten Überwachungsgeräte mit Ultra-HD-Kamera und GPS. Die bis in die entlegensten Winkel der Welt sich real zutragende Vernetzung und sich gleichzeitig verwirklichende Gläsernheit der Anwender gibt dem Bild der verschwindenden Schlupfwinkel neue Konturen. Die »verwaltete Welt« – ursprünglich als reine Bürokratiekritik vorgetragen – hat sich über das Internet und den Computer restlos verwirklicht.
Kein Kulturpessimismus der Vergangenheit kann es mit der heutigen Situation mehr aufnehmen. Evgeny Morozov zufolge fristet der Anwender sein Dasein zwischen »Sensoren, Filtern und Profilen«11. Für ihn gilt der Einzelne bereits als digital determiniert, und zwar in dem Maße, wie die Bestandteile seiner technischen Umwelt programmiert sind. Ihm kommt der Lebensmodus der Überwachung (über Sensoren) und der Datenspeicherung (in Form von Profilen) zu. In diesem Zusammenhang werden die prominent diskutierten Theorien postmoderner Soziologen fragwürdig. Ihnen gemäß kommt es gerade über die sich bietenden Möglichkeiten der Technik zu immer weiter fortschreitenden Individualisierungen hin zu höchst diversen Lebensstilen, die in einer pluralistischen Gesellschaft nebeneinander existieren. Der sogenannte digital akzelerierte Pluralismus erfährt über die monokulturellen GAFA-Profile seine Aufhebung.
Slavoj Žižek ventiliert in diesem Zusammenhang Gedanken zum Wegfall echter Individualität in Anbetracht der allgegenwärtigen »Cloud«. Gerade wo wirklich individuell gehandelt wird – also »nichtentfremdet, spontan« –, wirkt das unsichtbare Netzwerk der privaten Unternehmen als quasi objektives Regulativ.12 Mit folgender rhetorischer Frage verweist er auf die totalitäre und nivellierende Wirkung des Cloud-Computing als neuer Noosphäre: »[…] are we not all becoming involved in something comparable, insofar as our ›cloud‹ functions in a way not dissimilar to the Chinese state?«13 Hieran lassen sich weitere einfache Fragen knüpfen: Wie divers ist eine Gesellschaft, die flächendeckend WhatsApp, Google und Apple verwendet? Wie individuell ist ein Mensch, der seine Alleinstellungsmerkmale über Instagram kommuniziert? Wie viel Eigensinn, wie viel Persönlichkeit lassen die identischen Bausätze der sogenannten »Sozialen Medien« tatsächlich zu? Die Fragen lassen vermuten, dass es nicht Individualität ist, die über die »Massen-Apps« gefördert wird, sondern vielmehr die technische Bürokratisierung und die mediale Gleichschaltung. Die Filter, allen voran der Google-Algorithmus, stellen zwar vordergründig die Möglichkeit bereit, auf schnelle und reichhaltige Suchergebnisse zugreifen zu können, geben aber hintergründig auch eine hierarchisierte Auswahl vor, die den Einzelnen wiederum limitiert. Inmitten seiner sich immer weiter ausdifferenzierenden technisierten Umgebungen gleicht der Mensch sich über die Algorithmisierung durch die digitalen Dienstleister immer weiter einer Art nivelliertem Bewusstsein nach Adorno an. Der Bereitstellung von Benutzeroberflächen, den Suchmaschinen, den sozialen Portalen, der sukzessiven Infiltration des Lebens über »Sensoren, Filter und Profile« steht der Einzelne gegenüber wie einer neuen Architektur eines digitalen Gebäudes, das ihn umgibt und einschließt. Das Leben mit Smartphone legt ihn so gesehen auf mehreren Ebenen in seiner Lebensweise fest. Individualität entwickelt sich hier über den Umgang mit limitierten Optionen innerhalb eines vorgegebenen Koordinatensystems. In ihm herrscht folgendes Gesetz: Poste emotional und persönlich und dir soll Viralität zuteilwerden.