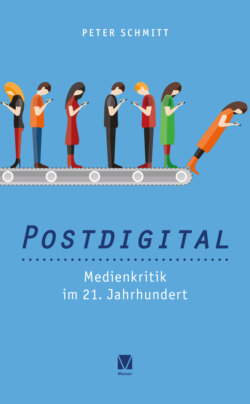Читать книгу Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert - Peter Schmitt - Страница 13
Kapitel 3 Technik Das technische Unbewusste
ОглавлениеBeschämend sind heute allein die technischen Dimensionen. Sie sind so gewaltig, dass sie im Grunde gar nicht mehr wahrgenommen werden können. Die gesamtgesellschaftliche Unbewusstheit geht auf technische »Hintergründe« zurück, die weitestgehend unreflektiert bleiben: »Jede menschliche Aktivität hängt von einem unterstellten Hintergrund ab, dessen Gehalt kaum hinterfragt wird: Er ist da, weil er da ist. Er ist gleichsam die Oberfläche, auf der das Leben dahingleitet. Einstmals mag der Großteil dieses Hintergrundes aus Entitäten bestanden haben, die in einer ›natürlichen Ordnung‹ existierten, also aus der ganzen Bandbreite der Wechselfälle der Erdoberfläche, von der Berührung durch Luftzüge, dem Jucken der Bekleidung bis zu Veränderungen am Himmel. Über die Zeit wurde dieser Hintergrund mit mehr und mehr ›artifiziellen‹ Bestandteilen ausgefüllt, so dass unter den gegenwärtigen Umständen viel von diesem Lebenshintergrund von ›zweiter Natur‹ ist, die künstliche Entsprechung des Atems, Straßen, Beleuchtung, Leitungen, Papier, Schrauben und Ähnliches konstituieren die erste Welle der Artifizialität. Nun erscheint eine zweite Welle zweiter Natur, die ihre flüchtige Präsenz durch so unterschiedliche Objektgestelle wie Kabel, Formeln, Funksignale, Bildschirme, Software, Kunstfasern etc. ausweitet.«36
Eine Beobachtung in der Straßenbahn lässt sich im Sinne Nigel Thrifts folgendermaßen deuten: Der beidhändig schnelltippende Teenager erfährt die erste und zweite Welle der zweiten Natur als gegeben und rauscht mit etwa 100 km/h durch die erste Natur. Diese nimmt er – wenn überhaupt – nur als dahingleitenden Hintergrund wahr, vor dem sich die weiteren Hintergründe der zweiten technischen Natur auffächern. Zur ersten Welle der zweiten Natur zählt die Straßenbahn selbst. Sie ist da, weil sie da ist. Sie ist jeden Morgen da, jeden Abend – die Straßenbahn ist, wie ein Baum, einfach da. Auch die zweite Welle der zweiten Natur ist einfach da. Der Apparat, die Musik, die Bilder. Die prinzipiell unhinterfragte Hinnahme des Hintergrundes als Konglomerat aller künstlichen Gegenstände bildet so etwas wie eine technische Bedingung unseres Lebens. »Wie hingezaubert offenbart sich jeden Morgen das Universum der Dinge vor den Menschen, niemand weiß, woher sie kommen, niemand weiß, wohin sie gehen«. Konrad Paul Liessmann beschreibt mit diesem Szenario einen Umstand, der als weitere Bedingung des heutigen Lebens gelten kann, und deutet mit ihm eine weitere, diesmal metaphysische Verschiebung an: »Nun sind es die Dinge, die Artefakte, die Gegenstände, die Waren aller Art, von denen wir nicht zu sagen wissen, woher sie eigentlich stammen und welcher Zukunft sie nach ihrem Gebrauch, ihrer Nutzung, ihrer Verwendung entgegengehen. Abstrakt gesehen sind die Dinge Resultat und Produkt menschlicher Arbeit. Aber die Arbeit selbst ist aus dieser Welt anscheinend verschwunden. Die Präsenz der Dinge ist hingegen unübersehbar und überwältigend«37.
Gerade die vielen Laptops und Smartphones sind die archetypischen Gegenstände ohne Herkunft unserer Zeit. Die Rohstoffgewinnung in Afrika, die chinesischen Fabriklandschaften, in denen die Apparate unter zweifelhaften Arbeitsbedingungen gefertigt wurden, sind im Leben der Nutzer ebenso wenig existent wie die Programmierbüros im Silicon Valley. »Ihre Herkunft, ihr Entstehungsprozess […] liegt im Verborgenen. Nichts an ihnen deutet an, aus welchem Rohstoff sie entstanden, durch welche Hände sie gegangen und aus welchen Maschinen sie entsprungen sind, welche Fließbänder sie sortiert und welche Fahrzeuge sie transportiert haben. Eines Morgens sind sie da. Und nur gerüchteweise weiß der moderne Mensch von jenen Friedhöfen, Halden, Verbrennungsanlagen und Endlagern, wo die Dinge ihre letzte Bestimmung finden«38. Die letzte Bestimmung des Menschen scheint immer mehr eine technische zu sein.
Die Einspeisung in algorithmisierte Konnektivität wirft tatsächlich die Frage nach eigentlicher Handlungsmacht in digitalisierten Umwelten auf. Humane Handlungsautonomie in soziotechnischen Umgebungen wird in aktuellen Arbeiten zur »Neurotechnologie« virulent diskutiert. Gerade die Frage danach, »wer handelt und was funktioniert«, ist allerdings oft nicht so leicht zu beantworten.39 Im Kontext blackbox-artiger Verflochtenheit muss die Frage nach wirklicher autonomer Aktivität sogar zwingend neu gestellt werden. Das Handeln bzw. Reagieren der Menschen findet mittlerweile in einem vielschichtig aufeinander verweisenden Produktekanon statt, der in seiner Ausdifferenzierung immer komplexer werdenden Eigengesetzlichkeiten unterliegt. Die zweite Welle der zweiten Natur bringt so gesehen Naturgesetzmäßigkeiten zweiter Ordnung mit sich. »Durch die Einrichtungen intelligenter Umgebungen werden die Oberflächen und Texturen des Alltagslebens durch alle Arten von softwaregesteuerten Geräten verstärkt, gesteuert, angetrieben. Es geht um die Genese einer Prozessrealität, die immer mehr von dem, ›was einmal als menschlich erschien, in Form von kleinen kognitiven Assistenten, auf die nun präkognitiv zurückgegriffen wird, in die Umwelt verlegt‹, nicht ohne dabei gleich auch« – und das ist nun die entscheidende Pointe – »die neue technische Welt direkt ins Unbewusste einzuarbeiten«40. Es kommt mit der immer unscheinbarer werdenden maschinellen Umgebung zu einer radikalen ontologischen Umstellung. Die Internalisierung der »exterioren Maschinenkultur« führt zu einer Aushebelung der psychischen und kollektiven Strukturierungsmacht von Sprache, die – nach Guattari bereits in den 1980er Jahren – in einer Art »computergestützten Subjektivität« endet. Erich Hörl beschreibt die Entwicklung hin zur technischen Subjektivität folgendermaßen: »Auf den überkommenen subjektiven Transzendentalismus des Schriftzeitalters folgt die transzendentale Technizität einer ökotechnologischen Prozesskultur, die bereits unsere heutige Erfahrung grundiert«41. Nicht der Mensch in der Introspektion ist mehr fähig zur sublimen transzendentalen Erkundung seiner selbst, sondern über die Apparate wird diese – im deutschen Idealismus noch als explizites Indiz für das Menschsein schlechthin geltende – Fähigkeit ausgelagert.