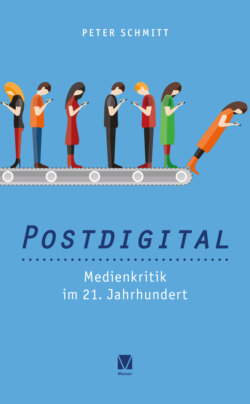Читать книгу Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert - Peter Schmitt - Страница 7
Kapitel 1 Individualität Verkehrsknotenpunkte des Allgemeinen
ОглавлениеIndividualität zeichnete sich schon immer durch die Unterscheidung vom Allgemeinen aus. »Das Individuum, das sich entfaltet und differenziert, indem es von dem Allgemeinen immer nachdrücklicher sich scheidet«5, wird gegenwärtig ohne Pause in die Mechanismen der computergestützten Lebensführung eingeschliffen. Jeder streicht mit uniformer Lässigkeit über Touchscreens. Jeder installiert die identischen Apps, die identischen Updates. Das Besondere, »Nichtidentische« verschwindet sukzessive hinter den Benutzeroberflächen, den wesensgleichen Funktionen der Programme. Der Versuch, sich vom Allgemeinen zu scheiden, scheitert jäh mit dem gesenkten Blick auf den allzeit bereiten Bildschirm. Aus einem einfachen Grund: weil es jeder macht. Dabei generiert sich Individualität per Definition aus dem Rückzug von dem, was jeder macht. Der Mensch wird erst zum Individuum, wenn er sich von der un- bzw. überindividuellen Masse löst und sich seine unterscheidenden Merkmale bewusst macht. Der Grad der Bewusstheit bei der Loslösung von kulturellen Zwängen macht die Qualität seiner Individualität aus. Zum kulturellen Zwang, der von der Totaldigitalisierung ausgeht, lässt sich jedoch kaum Distanz aufbauen. Im Gegenteil: Die Maschinerie ist ein dem Individuum a priori zukommendes Moment.
Das Individuum als Einzelwesen, das sich als einmalige Kombination von Merkmalen begreifen, das auf eine komplexe und widersprüchliche Genese seiner selbst zurückblicken darf, gerät mit den flächendeckend genutzten Apparaten in einen Strom technologischer Gleichschaltung. Hier findet es sich ohne Körper und ohne Geruch wieder. Würde man die Körperfunktionen der digitalen Menschen in ihrer Proportionalität darstellen wollen, so käme eine Zeichnung heraus, auf der ein winziger Körper mit verkümmerten Gliedmaßen, mit gewaltigen Augen und Ohren abgebildet wäre. Augen und Ohren, auf einen virtuellen Kosmos gerichtet, in dem drei Gebote zu befolgen sind: 1. Produziere und konsumiere so viele Bilder, wie du kannst! 2. Höre ohne Unterlass online gestreamte Musik! 3. Mache dich bildhaft den anderen gleich! Und tatsächlich: Aus sicherer Entfernung mutet das Internet wie ein großes, wahnwitziges Projekt der audiovisuellen Gleichschaltung an. Ein Blick in ein beliebiges Profil eines beliebigen Anbieters genügt, um sich der streng algorithmisierten Monokultur zu vergewissern: Jeder verwendet das identische Programm auf identische Art und Weise.
Die bloße Tatsache des angewendeten Programms macht den Einzelnen ad hoc weniger individuell. Denn mit den zur Verfügung gestellten bunten Bausätzen gehen automatisch dieselben Nutzungsweisen einher, die im besten Fall gefühlsbetont und spontan (also ohne lästige gedankliche Reflexionsleistung) vonstattengehen. Schon früher zielten die Inhalte und Formate des Fernsehens und des Radios nur selten auf gedankliche Reflexion ab (»Individuum wird es erst als Denkendes«)6, sondern direkt auf die Gefühlswelt. Die fast hypnotische Wirkung der sauberen Benutzeroberflächen, die angenehme Glätte des Touchscreens, die gefälligen Töne beim Klicken der Symbole, die Programme selbst, gespickt mit traumartig animierten Videosequenzen. Nicht die ratio, die kritische Distanz zum Gerät ist der Adressat der Inhalte, sondern die Emotionen, das Unbewusste. Gerade die distanzminimierenden Elemente, der »intuitive Gebrauch«, gelten als besonderes Zeichen von Qualität. Auch hier sind die Menschen scheinbar alle gleich. Jeder wendet gleich intuitiv die Geräte an. Nicht nur die Inhalte – also der über Spotify gestreamte romantische Popsong oder das geschmeidig animierte Game via Steam – laden die Anwender emotional auf, sondern auch die Apparatur selbst. Sie fühlt sich gut an, sieht gut aus. Sie liegt gut in der Hand, sauber und glatt. Sie funktioniert immer einwandfrei. Der Mensch hingegen erscheint vor dem digitalen Alleskönner wie ein tölpelhafter Saurier, wie ein veraltetes und makelbehaftetes Wesen aus einer anderen Zeit. Auf mehreren Ebenen wird dieses archaische Geschöpf in seiner kreatürlichen Befangenheit emotionalisiert. Zum einen bei der intuitiven Nutzung selbst, zum anderen über die hoch emotionalisierten Inhalte, die zu jeder Tages- und Nachtzeit konsumiert werden, und schließlich unterschwellig beschämt vor der Makellosigkeit der Apparate. Er selbst ist bedauernswert einzigartig und widersprüchlich. Insofern kann es dem unperfekten Einzelnen nur recht sein, dass die ihm apriorisch innewohnenden Eigenarten im digitalen Furor verschwinden. Wie von Geisterhand nivellieren sich dort Unterschiede nicht nur im konkreten Miteinander via Instagram.
Die Grundfunktion des Computers, die Verzifferung, steht für den Transfer von höchst diversen Inhalten in die 0-dimensionale, nackte Zahlenkolonne. Big Data steht insofern für das Sichauflösen von Grenzen, die einst zwischen einzelnen Sachgebieten klar zu ziehen waren. Geographie, Finanzen, Ästhetik, Kommunikation, Biologie – die GPS-Daten des Sommerurlaubs, die zuvor getätigten Online-Käufe, die nebenher gehörte Musik, die Kontodaten, der Chat mit der Nachbarin, der geschaute Porno, das Spielverhalten im Game, die unzähligen gescheiterten Selfie-Versuche, die Pränatalfotos, die gefilmte Geburt – alle Inhalte verschwimmen zu einem Datenkonvolut, das immer weiter anwächst und auf unabsehbare Zeit online steht. Der Mensch verliert hier an Individualität, ohne dass er es merkt. Die etymologische Perspektive auf lat. individuum – ›Unteilbares‹, ›Einzelding‹ – verweist in diesem Zusammenhang auf die geschlossene Einheit des einzeln Seienden. Sie wird über die hypostatische feinpixelige Visualität und komprimierte Akustik zerteilt. Zudem degeneriert die wertvolle Reifezeit hin zu realen Alleinstellungsmerkmalen zu fortschrittlicher Versiertheit bei der Maschinenbedienung. Das ausgehöhlte Konzept heutiger Individualität selbst wird zum Faktor sogenannter digitaler Identitätsarbeit. Nicht mehr vom Individuum ist dabei die Rede, sondern bezeichnenderweise vom Anwender. Wie sehr der Begriff Anwender indes auf ein höchst unindividuelles Reagieren verweist und wie wenig die digitale Individualisierung noch mit wirklich individuellem Agieren zu tun hat, muss bei der Annäherung an eine zeitgemäße kritische Medientheorie betont werden. Denn das vermeintlich freie und individuelle Hantieren mit vorgegebenen Profilbaukästen und Kommunikationsbausteinen entspricht gegenwärtig noch viel mehr der Tendenz der Kulturindustrie, »das Bewusstsein des Publikums von allen Seiten zu umstellen und einzufangen«7. Individualität wird in dieser lückenlosen, ja hermetischen Umstellung des Bewusstseins des Einzelnen erst heute wirklich zu der Pseudoindividualität, von der Theodor W. Adorno vor gut sechzig Jahren sprach. Die bescheidet sich gegenwärtig mit oberflächlicher Verschiedenheit bei der Wahl des Fotos und der exaltierten Sprachnachricht auf WhatsApp. Hier wird immer deutlicher, dass die »Individuen gar keine mehr sind, sondern bloße Verkehrsknotenpunkte der Tendenzen des Allgemeinen«8.