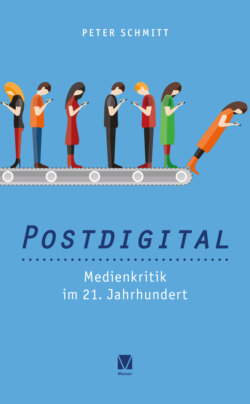Читать книгу Postdigital: Medienkritik im 21. Jahrhundert - Peter Schmitt - Страница 14
Verzifferung
ОглавлениеDiese Bedeutungsverschiebung verweist auf eine tieferliegende Dimension. Sie geht an die Grundfunktion des Computers: die Verzifferung. Friedrich Kittler stellte hier zunächst eine prinzipielle Nivellierung von Unterschieden fest: »Ob Digitalrechner Töne oder Bilder nach außen schicken, also ans sogenannte Mensch-Maschine-Interface senden oder aber nicht, intern arbeiten sie nur mit endlosen Bitfolgen, die von elektrischen Spannungen repräsentiert werden.«42 Der Unterschied zwischen Tinte auf Papier und symbolisierten Bitfolgen auf dem Monitor liegt insofern nicht in einem möglichen qualitativen Unterschied bezüglich der überbrachten Nachricht. Entscheidend ist – und hier wird es explizit medientheoretisch –, dass die Tinte auf Papier ein nachvollziehbares physisches Ereignis darstellt, während die symbolisierten Bitfolgen, samt der Programmierung des Computers, dem Lesenden verborgen bleiben. Tinte auf Papier lässt sich direkt anfassen, verwischen, riechen, falten, zerreißen, zerknüllen, abfotografieren. Die unendlichen Rechenfolgen samt ihrer Materialien, also der Siliziumchips zur Verarbeitung und Speicherung, der Golddrähte und Kupferbahnen zur Übertragung, der optischen Systeme aus Glasfaserkabeln bis hin zu den optischen Schaltkreisen, bleiben im Verborgenen. Die wahre Digitalität zeigt im Grunde nur ihr Rechenergebnis in Form von Pixeln auf dem Bildschirm. An sich ist das mediale Ereignis selbst unbeobachtbar. Was der Leser der auf dem Monitor aufblinkenden Zeilen sieht, sind ausschließlich die Effekte der digitalen Rechenleistung. Tatsächliches Material des Mediums ist (ab den frühen 1950er Jahren) die unendliche nackte Zahlenkolonne.
Erst mit der Einführung von Betriebssystemen (bspw. UNIX ab den 1960er Jahren) wurde aus der Zahlenkolonne so etwas wie eine eindimensionale Kommandozentrale. Mit ihr fand die erste Verdeckung, eine erste Entstellung des Materials statt, die es zudem manipulierbar machte. Im nächsten Schritt entwickelte Apple (ab den 1970er Jahren) eine graphische oder zweidimensionale Benutzeroberfläche, und damit kam eine weitere Dimension des Verbergens und der Manipulierbarkeit hinzu. Somit stehen wir mit einem Betriebssystem und der zugehörigen Benutzeroberfläche bereits vor der zweifachen Brechung des ursprünglichen Materials. »Was sich in Siliziumchips, die aus demselben Element wie jeder Kieselstein am Wegrand bestehen, rechnet und abbildet, sind symbolische Strukturen«. Kittler nennt es »Verzifferungen des Reellen«43. Die Verzifferung des Reellen, die hinter ihrer Entschlüsselung stattfindenden mathematischen Gleichungssysteme, die endlosen Bitfolgen, die als elektrische Spannungen repräsentiert werden, die komplexe Genese der Pixel und Symbole also, die auf dem Bildschirm erscheinen, sind allesamt Ereignisse, die dem Nutzer zum einen verborgen bleiben und ihre Wirkung haben. Die Überlagerung des eigentlichen Materials, sprich: der unendlichen Zahlenkolonnen, die Unkenntnis der Programme, die codierten Ideen der Programmierer, ein fehlendes Bewusstsein für deren Macht, die blinde Verwendung von Benutzeroberflächen und Betriebssystemen machen den vermeintlich neutralen Nutzer zum gelenkten Nutzer, zwingen ihn in die reduzierte Rolle des Anwenders.
Es ist ganz gleich, was man mit dem Computermedium macht, es bleibt die Illusion des Anwenders, eigenen Impulsen genuiner Kreativität gefolgt zu sein. Denn gefolgt ist man ausschließlich einem ganzen Konglomerat an Vorbedingungen, die zur Verdeutlichung nochmal aufgezählt werden: dem Programmierer, dem Programm, der Benutzeroberfläche, dem Betriebssystem und schließlich den Zahlenkolonnen der Bits und Bytes. Illusionär ist die Vorstellung von einer wirklich autonomen Nutzung des Computermediums ohne fundiertes Wissen zu Programmiersprachen, Programmierern, Betriebssystemen, zugehörigen Machtzentren. Wer nicht die Programmiersprachen samt mathematisch-physikalischem und technischem Wissen beherrscht, ist – wie Vilém Flusser es bereits in den 1980er Jahren erahnen konnte – »Analphabet in einem mindestens so radikalen Sinn, wie es die der Schrift Unkundigen in der Vergangenheit waren«. Die hier geforderte kritische Medientheorie muss auf dieses strukturelle Unwissen in der breiten Gesellschaft, das in etwa dem Unwissen der agrarisch strukturierten Gesellschaft des frühen Mittelalters bezüglich der Schrift gleichkommt, hinweisen. Das meistgenutzte Medium der Gegenwart ist den Nutzenden so fremd, dass sie im Grunde wie eine Gruppe analphabetischer Bauern im Mittelalter mit Feder und Papier nichts Besseres anzufangen weiß als das Malen von Hühnern. Sie nutzt das Medium, wie es der Bauer getan hätte, zu etwas anderem als dem ihm innewohnenden Zweck. Eben wie die damalige intellektuelle Elite der Schriftgelehrten in den Koordinaten des neuen Mediums dachte und die ihr zugehörige Tiefenaufmerksamkeit kultivierte, so denken die heutigen Programmiereliten nicht mehr in Worten, sondern in Zahlen, in Formen, in Bewegtbildern. »Die Regeln ihres Denkens sind mathematisch […] aber weniger ›logisch‹. Es ist ein immer weniger diskursives und immer mehr synthetisches, strukturelles Denken.« Worauf läuft diese Entwicklung hinaus? Das möchte man Vilém Flusser fragen. Er wusste, dass das Lesen von Buchstaben »künftig als ein Symptom von Rückständigkeit gelten« wird, »wie etwa in der Neuzeit ein magisch-mythisches Verhalten«44.