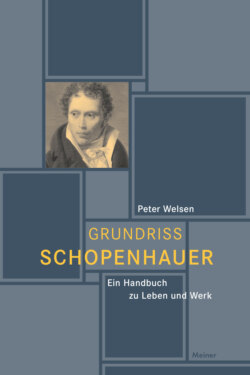Читать книгу Grundriss Schopenhauer - Peter Welsen - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erkenntnistheorie
ОглавлениеAngesichts der Tatsache, daß Schopenhauer das Anliegen verfolgt, den »ächten« oder »wahren Kriticismus« (HN I 20, 24, 37, 126 u. 151) zu errichten, überrascht es nicht, daß er die Erkenntnistheorie an den Anfang der Darstellung seines Ansatzes stellt. Das liegt daran, daß er es für erforderlich hält, die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis zu klären, bevor er sich der Metaphysik – sei es der Natur, des Schönen oder der Sitten – zuwendet. Er erläutert seine einschlägigen Überlegungen zunächst in seiner Dissertation Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde und später nochmals im jeweils ersten Teil der beiden Bände von Die Welt als Wille und Vorstellung sowie seiner Philosophischen Vorlesungen. Vor diesem Hintergrund könnte man die Dissertation durchaus als »›Propädeutik‹ zum Hauptwerk« betrachten.9
Schopenhauers erkenntnistheoretischer Ansatz bietet sich insofern als recht komplex dar, als er transzendentale und anthropologische – d. h. physiologische und psychologische – Ausführungen enthält, die nicht immer klar voneinander geschieden werden, sondern gelegentlich ineinander übergehen. Schopenhauer spricht in diesem Zusammenhang auch von einer subjektiven und einer objektiven »Betrachtungsweise des Intellekts« (W II 318). So betont er, daß man »nicht bloß […] vom Intellekt zur Erkenntniß der Welt gehn [muß], sondern auch […] von der als vorhanden genommenen Welt zum Intellekt. Dann wird diese, im weitern Sinn, physiologische Betrachtung die Ergänzung jener ideologischen, wie die Franzosen sagen, richtiger transscendentalen.« (W II 339)
Aufgabe der transzendentalen Untersuchung der Erkenntnis ist es, die apriorischen Bedingungen der Möglichkeit derselben zu beschreiben. Die beiden grundlegendsten dieser Bedingungen sind die apriorische Korrelation von Subjekt und Objekt sowie der Satz vom zureichenden Grunde, die ihrerseits eng miteinander zusammenhängen und für die gesamte Welt als Vorstellung gelten. Was den letzteren anbelangt, so wurde dieser, wie Schopenhauer ausführt, von Leibniz als »Hauptgrundsatz aller Erkenntniß und Wissenschaft förmlich aufgestellt« (G 31) und von Wolff in einem wesentlichen Punkt, nämlich der Unterscheidung zwischen Seins- und Erkenntnisgrund, ausdifferenziert. Schopenhauer schließt sich der auf Wolff zurückgehenden Formulierung des Satzes an: »Nihil est sine ratione cur potius sit, quam non sit.« (G 17)
Der Satz vom Grunde zeichnet sich – laut Schopenhauer – dadurch vor anderen Prinzipien aus, daß er sich nicht beweisen oder erklären läßt. Dabei versteht er unter einem Beweis oder einer Erklärung ein deduktives Verfahren, mit dessen Hilfe ein Satz oder ein Sachverhalt von einem anderen Satz oder Sachverhalt hergeleitet wird. Nun aber beinhaltet der Satz vom Grunde, daß sich alle Sätze oder Sachverhalte auf andere zurückführen lassen, so daß er das oberste Prinzip allen Beweisens oder Erklärens darstellt, das auf einer anderen, höheren Ebene angesiedelt ist und – als oberstes Prinzip – nicht von Prinzipien, die ihm nochmals übergeordnet wären, abgeleitet werden kann: »Denn jeder Beweis ist die Zurückführung des Zweifelhaften auf ein Anerkanntes, und wenn wir von diesem, was es auch sei, immer wieder einen Beweis fordern, so werden wir zuletzt auf gewisse Sätze gerathen, welche die Formen und Gesetze, und daher die Bedingungen alles Denkens und Erkennens ausdrücken, aus deren Anwendung mithin alles Denken und Erkennen besteht; so daß Gewißheit nichts weiter ist, als Uebereinstimmung mit ihnen, folglich ihre eigene Gewißheit nicht wieder aus andern Sätzen erhellen kann.« (G 38) Freilich bedeutet dies nicht, daß Schopenhauer über keine Argumente verfügt, um den Satz vom Grunde zu verteidigen, sondern es besagt lediglich, daß eine deduktive Herleitung – also eine Herleitung aus anderen Sätzen – zum Scheitern verurteilt ist. Vielmehr ist Schopenhauer überzeugt, daß der Satz vom Grunde deshalb wahr ist, weil er bei jeder Begründung vorausgesetzt wird, sogar dann, wenn man die Frage nach der Begründung des Satzes überhaupt erst aufwirft: »Wer nun einen Beweis, d. i. die Darlegung eines Grundes, für ihn fordert, setzt ihn eben hiedurch schon als wahr voraus, ja, stützt seine Forderung eben auf diese Voraussetzung. Er geräth also in diesen Cirkel, daß er einen Beweis der Berechtigung, einen Beweis zu fordern, fordert.« (G 38)
Ist im Titel von Schopenhauers Dissertation von einer »vierfache[n] Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde« die Rede, so ist damit gemeint, daß sich dieses eine Prinzip in vier unterschiedliche Gestalten aufgliedert, je nachdem auf welche Art von Vorstellungen es sich gerade bezieht. All diesen Formen ist die folgende, von Schopenhauer als die »Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund« (G 41) bezeichnete Struktur gemeinsam, die sowohl das Verhältnis von Subjekt und Objekt wie auch das Verhältnis der Objekte zueinander betrifft: »Unser erkennendes Bewußtseyn, als äußere und innere Sinnlichkeit (Receptivität), Verstand und Vernunft auftretend, zerfällt in Subjekt und Objekt, und enthält nichts außerdem. Objekt für das Subjekt seyn, und unsere Vorstellung seyn, ist das Selbe. Alle unsere Vorstellungen sind Objekte des Subjekts, und alle Objekte des Subjekts sind unsere Vorstellungen. Nun aber findet sich, daß alle unsere Vorstellungen unter einander in einer gesetzmäßigen und der Form nach a priori bestimmbaren Verbindung stehn, vermöge welcher nichts für sich Bestehendes und Unabhängiges, auch nichts Einzelnes und Abgerissenes, Objekt für uns werden kann. Diese Verbindung ist es, welche der Satz vom zureichenden Grund, in seiner Allgemeinheit, ausdrückt.« (G 41) Damit geht Schopenhauer zunächst von einer apriorischen Korrelation von Subjekt und Objekt aus, wie das auch schon Reinhold und Fichte getan hatten, und er setzt darüber hinaus Objekt und Vorstellung gleich, nimmt also, ohne dies zunächst näher zu begründen, eine idealistische Position ein. Was aber die Objekte bzw. Vorstellungen anbelangt, so ist er davon überzeugt, daß keines von ihnen isoliert bestehen könne, sondern daß ein jedes nach dem Satz vom zureichenden Grunde durch andere, derselben Klasse von Objekten bzw. Vorstellungen angehörende, bedingt sei.
Angesichts der Identifizierung der Objekte mit Vorstellungen erstaunt es keineswegs, daß der Satz vom zureichenden Grunde lediglich für diese, nicht jedoch für das Ding an sich gilt. Deshalb stellt Schopenhauer fest: »Nun ist aber der Satz vom Grunde in allen seinen Gestalten a priori, wurzelt also in unserm Intellekt: daher darf er nicht auf das Ganze aller daseienden Dinge, die Welt, mit Einschluß dieses Intellekts, in welchem sie dasteht, angewandt werden. Denn eine solche, vermöge apriorischer Formen sich darstellende Welt ist eben deshalb bloße Erscheinung: was daher nur in Folge eben dieser Formen von ihr gilt, findet keine Anwendung auf sie selbst, d. h. auf das in ihr sich darstellende Ding an sich.« (G 175) Vergegenwärtigt man sich, daß sich der Satz vom Grunde auf die Relationen zwischen den Objekten bzw. Vorstellungen bezieht, so kann man nachvollziehen, daß schließlich auch das Subjekt, dem sie gegeben sind, sowie die Beziehung, in der es zu den Objekten steht, nicht unter ihn fallen. Deshalb weist Schopenhauer das Ansinnen zurück, das Subjekt vom Objekt oder das Objekt vom Subjekt nach dem Satz vom Grund abzuleiten: »Der Realismus setzt das Objekt als Ursache, und deren Wirkung ins Subjekt. Der Fichte’sche Idealismus macht das Objekt zur Wirkung des Subjekts. Weil nun aber, was nicht genug eingeschärft werden kann, zwischen Subjekt und Objekt gar kein Verhältniß nach dem Satz vom Grunde Statt findet; so konnte auch weder die eine, noch die andere der beiden Behauptungen je bewiesen werden, und der Skepticismus machte auf beide siegreiche Angriffe.« (W I 41)
Schopenhauer unterscheidet zwischen vier Klassen von Objekten bzw. Vorstellungen, die jeweils unter eine eigene Gestalt des Satzes vom zureichenden Grunde fallen. Dies sind die anschaulichen, vollständigen, empirischen Vorstellungen bzw. Objekte, die abstrakten Vorstellungen bzw. Begriffe, die formalen Vorstellungen bzw. die apriorischen Anschauungen des Raumes und der Zeit sowie das Subjekt des Wollens oder – präziser formuliert – die affektiven, emotionalen und volitionalen Erlebnisse desselben. Diesen vier Klassen der Vorstellungen entsprechen der Satz vom zureichenden Grunde des Werdens, des Erkennens, des Seins und des Handelns. Hat die Erkenntnis lediglich Vorstellungen zum Gegenstand, nicht aber dasjenige, was jenseits der Vorstellung angesiedelt ist, so kann Schopenhauer von der »Immanenz unserer […] Erkenntniß« (W II 715) bzw. ihrer Untauglichkeit »zum transscendenten Gebrauch« (W II 338) sprechen.
Mit dieser Festlegung tritt Schopenhauer für einen – auf Kant zurückgehenden – erkenntnistheoretischen Ansatz ein, der unter dem Namen »transzendentaler Idealismus« bekannt geworden ist. Inhaltlich läuft der transzendentale Idealismus darauf hinaus, daß sich die Erkenntnis nicht etwa auf vorstellungsunabhängige Dinge an sich, sondern auf Erscheinungen bzw. Vorstellungen bezieht und daß ihre Gegenstände sowie deren apriorische Eigenschaften (Raum, Zeit, kategoriale Bestimmungen) ebenfalls Erscheinungen bzw. Vorstellungen sowie Eigenschaften derselben sind. Freilich grenzt Schopenhauer den transzendentalen Idealismus gegen den – z. B. von Berkeley vertretenen – »absoluten Idealismus« (W II 554) ab, der mit seiner These, die gesamte Wirklichkeit erschöpfe sich in Vorstellungen, einem »theoretischen Egoismus« gleichkomme: »Das angeschaute Objekt aber muß etwas an sich selbst seyn und nicht bloß etwas für Andere: denn sonst wäre es schlechthin nur Vorstellung, und wir hätten einen absoluten Idealismus, der am Ende theoretischer Egoismus würde, bei welchem alle Realität wegfällt und die Welt zum bloßen subjektiven Phantasma wird.« (W II 226) Was den transzendentalen Idealismus vom »absoluten Idealismus« unterscheidet, ist die Annahme der Existenz eines Dinges an sich. Darüber hinaus betont Schopenhauer im Einklang mit Kant, daß der transzendentale Idealismus mit einem empirischen Realismus einhergehe. Dies bedeutet, daß sich die Gegenstände der Erkenntnis – trotz ihrer Idealität – nicht etwa als »Lüge« oder »Schein« (W I 43), sondern als empirisch real darbieten. Vor dem Hintergrund des transzendentalen Idealismus leuchtet ein, daß Kant und Schopenhauer die empirische Realität im Bereich der Erscheinung bzw. Vorstellung ansiedeln: »Der transscendentale Idealismus macht inzwischen der vorliegenden Welt ihre empirische Realität durchaus nicht streitig, sondern besagt nur, daß diese keine unbedingte sei […]; daß mithin diese empirische Realität selbst nur die Realität einer Erscheinung sei.« (P I 99)10 Innerhalb dieses Bereichs siedelt Schopenhauer dann auch den Unterschied zwischen subjektiven und objektiven Vorstellungen an, also zwischen Phantasmen und Träumen auf der einen Seite und Vorstellungen von empirisch Realem auf der anderen, ohne freilich ein Kriterium angeben zu können, das es in jedem einzelnen Fall gestatten würde, beides auseinanderzuhalten.11 Zwar ist er sich darüber im klaren, daß sich die empirische Wirklichkeit tendenziell durch ein höheres Maß an Kohärenz auszeichnet als der Traum und daß zwischen beiden Bereichen in der Regel eine Kluft besteht, aber nichtsdestoweniger gibt er zu bedenken: »[W]enn nun aber […] der kausale Zusammenhang mit der Gegenwart, oder dessen Abwesenheit, schlechterdings nicht auszumitteln ist, so muß es auf immer unentschieden bleiben, ob ein Vorfall geträumt oder geschehn sei.« (W I 45)
Versichert Schopenhauer bei anderer Gelegenheit, der transzendentale Idealismus beinhalte, daß die empirische Wirklichkeit in gewisser Hinsicht einem Traum gleiche (W I 45 ff.), so ist darin kein Widerspruch zu seiner Konzeption des empirischen Realismus zu erblicken. Während der empirische Realismus innerhalb der Welt als Vorstellung angesiedelt ist und dort allein die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Vorstellung stattfindet, stellt die Rede von der »traumartigen Beschaffenheit der ganzen Welt« (W I 516) das Resultat einer vom Standpunkt der Welt als Wille durchgeführten metaphysischen, über die Welt als Vorstellung hinausgehenden Reflexion dar. Solch eine Deutung des transzendentalen Idealismus geht natürlich über Kant hinaus und reiht sich eher in die Tradition des indischen Denkens ein.
Während letzterer diese Lehre in der transzendentalen Ästhetik – also im Ausgang von den Anschauungsformen des Raumes und der Zeit – zu begründen versucht, glaubt Schopenhauer, dieses Ziel auf einem einfacheren, von Berkeley gebahnten Weg erreichen zu können: »Es ist allerdings auffallend, daß er [Kant] jene bloß relative Existenz der Erscheinung nicht aus der einfachen, so nahe liegenden, unleugbaren Wahrheit ›Kein Objekt ohne Subjekt‹ ableitete, um so, schon an der Wurzel, das Objekt, weil es durchaus immer nur in Beziehung auf ein Subjekt daist, als von diesem abhängig, durch dieses bedingt und daher als bloße Erscheinung, die nicht an sich, nicht unbedingt existirt, darzustellen.« (W I 533)12 Schopenhauer geht von der korrekten Beobachtung aus, daß die Erkenntnis von einer subjektiven Bedingung abhängt, nämlich davon, daß etwas als Objekt vorgestellt wird. Daraus folgert er anscheinend, was erkannt werde, sei nicht etwa ein vorstellungsabhängiges Ding, sondern nur die Vorstellung bzw. ihr objektiver Gehalt. Anders ausgedrückt: »Keine Wahrheit ist also gewisser, von allen andern unabhängiger und eines Beweises weniger bedürftig, als dies, daß Alles, was für die Erkenntnis daist, also die ganze Welt, nur Objekt in Beziehung auf das Subjekt ist, Anschauung des Anschauenden, mit Einem Wort, Vorstellung.« (W I 29) Umgekehrt hält Schopenhauer den Gedanken, es gebe vorstellungsunabhängige Objekte, für »falsch« und »absurd« (W II 11), ja er glaubt, daß er sich »nicht einmal denken läßt« (W II 16). Freilich ist solch ein Schluß von der Subjektivität einer Bedingung der Erkenntnis auf die Subjektivität des Erkannten alles andere als zwingend. Es scheint vielmehr, als liege damit ein nachgerade klassisches non sequitur vor.
Im zweiten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung führt Schopenhauer weitere Argumente zugunsten des transzendentalen Idealismus an. Eines davon lautet, das Subjekt könne sich nur deshalb in der Welt orientieren, weil diese mit seinen Vorstellungen koinzidiere: »Daß wir nämlich so tief eingesenkt sind in Zeit, Raum, Kausalität und den ganzen darauf beruhenden gesetzmäßigen Hergang der Erfahrung, daß wir […] darin so vollkommen zu Hause sind und uns von Anfang an darin zurecht zu finden wissen, – Dies wäre nicht möglich, wenn unser Intellekt Eines und die Dinge ein Anderes wären; sondern ist nur daraus erklärlich, daß Beide ein Ganzes ausmachen, der Intellekt selbst jene Ordnung schafft und er nur für die Dinge, diese aber auch nur für ihn dasind.« (W II 16) Es liegt auf der Hand, daß die Orientierung des Menschen auch deshalb funktionieren könnte, weil die Erkenntnis – wenigstens zum Teil – mit einer von der Vorstellung unterschiedenen Wirklichkeit kongruiert und daß sie dies aufgrund ihrer evolutionären Entwicklung tut.13
Darüber hinaus versucht Schopenhauer, seine Position durch die Widerlegung des »Haupteinwands« des transzendentalen Realismus gegen den transzendentalen Idealismus zu verteidigen. Dieser lautet, daß ein Subjekt, um sich seiner Wirklichkeit zu versichern, nicht darauf angewiesen ist, daß diese von einem anderen Subjekt bezeugt wird. Übertrage man diese Überlegung auf andere, vom fraglichen Subjekt verschiedene Objekte, so folge nach realistischer Auffassung, daß auch diese vorstellungsunabhängig existieren. Genau dies akzeptiert Schopenhauer jedoch nicht: »Jener Andere, als dessen Objekt ich jetzt meine Person betrachte, ist nicht schlechthin das Subjekt, sondern zunächst ein erkennendes Individuum. Daher, wenn er auch nicht dawäre, ja wenn sogar überhaupt kein anderes erkennendes Wesen als ich selbst existirte; so wäre damit noch keineswegs das Subjekt aufgehoben, in dessen Vorstellung allein alle Objekte existiren. Denn dieses Subjekt bin ja eben auch ich selbst, wie jedes Erkennende es ist. Folglich wäre, im angegebenen Fall, meine Person allerdings noch da, aber wieder als Vorstellung, nämlich in meiner eigenen Erkenntniß.« (W II 12 f.) Dies aber bedeutet für Schopenhauer, daß auch alle anderen Objekte nur in der Vorstellung existieren. Allerdings scheint er dabei zu übersehen, daß die Abhängigkeit aller Erfahrung von einem Subjekt keineswegs impliziert, daß alle Wirklichkeit, um zu bestehen, der Erfahrung – und damit des Subjekts – bedarf.
Noch weniger überzeugend ist der Versuch, den transzendentalen Idealismus im Rekurs auf die Abhängigkeit der Erkenntnis vom Gehirn zu stützen. Aus der korrekten Beobachtung, daß die Anschauung der äußeren Wirklichkeit auf die vermittelnde Funktion des Gehirns angewiesen ist, folgert Schopenhauer, diese sei – im Sinne des transzendentalen Idealismus – bloße Erscheinung oder Vorstellung (vgl. W II 334). Freilich ist diese Argumentation aus zwei Gründen nicht überzeugend: Zum einen ergibt sich aus der Abhängigkeit der Vorstellung der äußeren Wirklichkeit von einer subjektiven Bedingung wie dem Gehirn keineswegs, daß sie auch selbst nur subjektiv, also bloßes Phänomen ist14, und zum andern stellt das Gehirn, aus dessen Vermittlung die Subjektivität der Vorstellung abgeleitet wird, eine empirisch reale Voraussetzung dar, die nicht mit dem Idealismus, zu dem sie führen soll, kompatibel ist. Würde man hingegen im Gehirn eine ideale Entität wie z. B. eine Erscheinung oder Vorstellung erblicken, so wäre der Idealismus, dessen Gültigkeit sie verbürgen soll, bereits zirkulär vorausgesetzt. Letztendlich könnte Schopenhauer im Ausgang vom Gehirn allenfalls zu einem kritischen Realismus, nicht aber zum transzendentalen Idealismus gelangen.
Schopenhauer grenzt seinen Ansatz gegen zwei andere ab, in denen er Spielarten des Dogmatismus erblickt: den dogmatischen Realismus sowie den dogmatischen Idealismus. Während er selbst von einer apriorischen Korrelation von Subjekt und Objekt ausgeht und den Geltungsbereich des Satzes vom zureichenden Grunde auf die verschiedenen Klassen von Objekten eingrenzt, versuchen der dogmatische Realismus bzw. Idealismus nach seiner Auffassung, die gesamte Wirklichkeit vom Objekt bzw. Subjekt abzuleiten: »Der Realismus setzt das Objekt als Ursache, und deren Wirkung ins Subjekt. Der Fichte’sche Idealismus macht das Objekt zur Wirkung des Subjekts.« (W I 41) Dagegen wendet Schopenhauer zunächst ein, daß es nicht zulässig ist, das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt als kausales zu betrachten. Die Kategorie der Kausalität gelte nämlich – wie der Satz vom zureichenden Grunde insgesamt – nur für Objekte, nicht jedoch für das Subjekt, denn dieses sei eine apriorische Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis von Objekten. Was jedoch das Objekt anbelangt, so wirft Schopenhauer dem dogmatischen Realismus vor, er stufe es als von der Vorstellung verschiedenes »Objekt an sich« – und damit als etwas angeblich »völlig Undenkbares« (W I 42) – ein. Als solches könne es keineswegs an einem kausalen Vorgang teilhaben. Der dogmatische Idealismus hingegen zeichnet sich dadurch aus, das Objekt als Produkt einer Handlung des Subjekts zu erklären. Es liegt auf der Hand, auf wen Schopenhauer damit abzielt: »[I]n dieser Hinsicht muß ich also eines Systems erwähnen, das ich sonst durchaus nicht für beachtenswert halt; die sogenannte Wissenschaftslehre von J. G. Fichte.« (Vo I 515) Auch gegen diesen wendet Schopenhauer ein, weder das Subjekt noch die Korrelation von Subjekt und Objekt falle unter die Kategorie der Kausalität. Die beiden anderen von Schopenhauer vorgetragenen Argumente haben damit zu tun, daß Fichte von einem einzigen Prinzip ausgeht, aus dem alle anderen Einsichten folgen sollen. Dagegen wendet Schopenhauer ein, das Subjekt lasse sich nicht vom Objekt isolieren, sondern trete stets mit ihm zusammen auf (vgl. W I 65). Darüber hinaus bemängelt er, daß ein Prinzip nicht ausreiche, um zu weiteren Erkenntnissen zu gelangen: »Mit Einem Princip ist überall nichts zu machen.« (HN I 124 Anm.) Dies bedeutet, daß Fichte mehr voraussetzen muß, als er selbst zugibt, etwa ein oder mehrere weitere Prinzipien sowie Deduktionsregeln, mit deren Hilfe sich weitere Einsichten ableiten ließen.
Schopenhauer verbindet in seiner Erkenntnistheorie zwei Ansätze, einen subjektiven, transzendentalen, und einen objektiven, empirischen (vgl. W II 318). Ersteren stuft er als idealistisch, letzteren hingegen als realistisch bzw. materialistisch ein.15 Obgleich er im Zuge seines Kritizismus dem subjektiven Ansatz den methodischen Vorrang gewährt, betrachtet er ihn – ebenso wie den objektiven – als einseitig und daher ergänzungsbedürftig. Das gilt natürlich auch für das Verhältnis von Idealismus und Realismus bzw. Materialismus: »Keine, aus einer objektiven, anschauenden Auffassung der Dinge entsprungene und folgerecht durchgeführte Ansicht der Welt kann durchaus falsch seyn; sondern sie ist, im schlimmsten Fall, nur einseitig: so z. B. der vollkommene Materialismus, der absolute Idealismus u. a. m. Sie alle sind wahr; aber sie sind es zugleich: folglich ist ihre Wahrheit eine nur relative. Jede solche Auffassung ist nämlich nur von einem bestimmten Standpunkt aus wahr; wie ein Bild die Gegend nur von einem Gesichtspunkte aus darstellt.« (P II 19) Angesichts der Tatsache, daß er sowohl den Idealismus als auch den Realismus bzw. Materialismus für berechtigt hält, erklärt Schopenhauer sogar, es liege eine »Antinomie in unserm Erkenntnißvermögen« (W I 61) vor. Da aber eine Antinomie die Schwierigkeit beinhaltet, daß sich zwei kontradiktorisch entgegengesetzte Thesen zugleich als wahr erweisen lassen, stellt sich die Frage, ob und wie sie sich überwinden lasse. Nun geht Schopenhauer keineswegs von einer vollkommenen Gleichberechtigung beider Ansätze aus, sondern löst den Gegensatz auf, indem er Idealismus und Realismus auf unterschiedlichen Ebenen ansiedelt bzw. die Materie zwar als empirisch real, aber als transzendental ideal betrachtet: »Der wahre Idealismus hingegen ist eben nicht der empirische, sondern der transscendentale. Dieser läßt die empirische Realität der Welt unangetastet, hält aber fest, daß alles Objekt, also das empirisch Reale überhaupt, durch das Subjekt zwiefach bedingt ist: erstlich materiell, oder als Objekt überhaupt, weil ein objektives Daseyn nur einem Subjekt gegenüber und als dessen Vorstellung denkbar ist; zweitens formell, indem die Art und Weise der Existenz des Objekts, d. h. des Vorgestelltwerdens (Raum, Zeit, Kausalität), vom Subjekt ausgeht, im Subjekt prädisponirt ist.« (W II 15) Darüber hinaus faßt Schopenhauer beides – Subjekt und Objekt bzw. Intellekt und Materie – unter dem Begriff der Vorstellung zusammen und läßt es im ontologisch primären Ding an sich gründen: »Bei mir hingegen sind Materie und Intellekt unzertrennliche Korrelata, nur für einander, daher nur relativ, da: die Materie ist die Vorstellung des Intellekts; der Intellekt ist das, in dessen Vorstellung allein die Materie existirt. Beide zusammen machen die Welt als Vorstellung aus, welche eben Kants Erscheinung, mithin ein sekundäres ist. Das Primäre ist das Erscheinende, das Ding an sich selbst, als welches wir nachher den Willen kennen lernen. Dieser ist an sich weder Vorstellendes, noch Vorgestelltes; sondern von seiner Erscheinungsweise völlig verschieden.« (W II 25; vgl. a. W II 27)16
Wie bereits angedeutet wurde, legt Schopenhauer neben der transzendentalen Betrachtung der Erkenntnis auch eine anthropologische – physiologisch und psychologisch ausgerichtete – vor, welche die Abhängigkeit des Intellekts von den Sinnesorganen, dem Nervensystem sowie dem Gehirn in den Vordergrund stellt. So sei der Intellekt als Funktion des Gehirns zu betrachten: »Dieser Intellekt ist das Sekundäre, ist das posterius des Organismus und, als eine bloße Gehirnfunktion, durch diesen bedingt.« (N 219 f.) Damit erweise sich der Intellekt – und damit auch die Erkenntnis – letztlich als »physisch« und nicht etwa als »metaphysisch« (W II 287). Nimmt man hinzu, daß Schopenhauer zugleich einen transzendentalen Idealismus lehrt, so stößt man auf das Problem, daß sich bald die Erkenntnis als Produkt der Materie bzw. des Gehirns, bald die Materie bzw. das Gehirn als Produkt der Erkenntnis darbietet: »Der Behauptung, daß das Erkennen Modifikation der Materie ist, stellt sich also immer mit gleichem Recht die umgekehrte entgegen, daß alle Materie nur Modifikation des Erkennens des Subjekts, als Vorstellung desselben, ist.« (W I 58; vgl. a. W II 25 u. 339)17
Stellt man in Rechnung, daß sich der Wille als Ding an sich in der empirischen Wirklichkeit als Wille zum Leben manifestiert, so ist nachvollziehbar, daß Schopenhauer das Gehirn und seine Leistung, die Erkenntnis, unter diesem Gesichtspunkt als Mittel zur »Erhaltung des Individuums und Fortpflanzung des Geschlechts« (W I 202; vgl. a. W I 204 u. W II 327) charakterisiert. Da nun die Erkenntnis durch das Gehirn und dieses – als Erscheinung desselben – durch den Willen bedingt ist, könnte man sagen, daß sie im Verhältnis zum Gehirn bzw. zum Leib sekundär und im Verhältnis zum Willen als Ding an sich gar nur tertiär sei. In diesem Sinn hebt Schopenhauer hervor: »Ich setze also erstlich den Willen, als Ding an sich, völlig Ursprüngliches; zweitens seine bloße Sichtbarkeit, Objektivation, den Leib; und drittens die Erkenntniß, als bloße Funktion eines Theils dieses Leibes.« (N 220; vgl. a. W II 234, 238, 287, 302, 320, 322 u. 324) Daß die Erkenntnis dem Willen untergeordnet ist, zeigt sich in mehrfacher Hinsicht: Zum einen dient sie ihm als bloße »μηχανη« (W I 202 u. 204), und zum andern hängt sie dergestalt von ihm ab, daß er sie bald fördert (vgl. W II 257 ff.), bald stört und verfälscht (vgl. W II 164 ff. u. 250 ff.). Demnach wäre das Gehirn – metaphysisch betrachtet – eine Erscheinung des Willens, genauer gesagt, eine Erscheinung, in der sich dieser »als ein Erkennenwollen« (W II 302) objektiviert.
Was das Verhältnis des Gehirns zum übrigen Leib bzw. Organismus anbelangt, so stellt es sich als überaus komplex dar. Zunächst betont Schopenhauer, daß beide durch einander bedingt sind: »Demnach ist allerdings das Gehirn, mithin der Intellekt, unmittelbar durch den Leib bedingt, und dieser wiederum durch das Gehirn, jedoch nur mittelbar, nämlich als Räumliches und Körperliches, in der Welt der Anschauung, nicht aber an sich selbst, d. h. als Wille.« (W II 303) Gemeint ist damit, daß das Gehirn – als »Efflorescenz des Organismus« (W II 322) – physisch vom Leib abhängt18, während der Leib umgekehrt in kognitiver Hinsicht – das heißt, um erkannt zu werden – auf das Gehirn angewiesen ist. Setzt man für das Gehirn das, was es leistet, die Vorstellung, ein, so ergibt sich: »Allerdings setzt […] das Daseyn des Leibes die Welt der Vorstellung voraus; sofern auch er, als Körper oder reales Objekt, nur in ihr ist: und andererseits setzt die Vorstellung selbst eben so sehr den Leib voraus; da sie nur durch die Funktion eines Organs desselben entsteht.« (W II 323) Angesichts der wechselseitigen Bedingtheit der Vorstellung einerseits und des Gehirns bzw. Leibes anderseits, die Schopenhauer an dieser Stelle beschreibt, erhob Zeller 1873 den bekannt gewordenen Einwand, es liege ein Zirkel vor: »Wir befinden uns demnach in dem greifbaren Zirkel, daß die Vorstellung ein Produkt des Gehirns und das Gehirn ein Produkt der Vorstellung sein soll – ein Widerspruch, für dessen Lösung der Philosoph auch nicht das Geringste gethan hat.«19 Freilich war Zeller entgangen, daß Schopenhauer die Abhängigkeit von Vorstellung und Gehirn jeweils in einem anderen theoretischen Zusammenhang und nicht etwa im Rahmen eines einheitlichen Ansatzes diskutiert, so daß kein Zirkel entsteht, sondern lediglich zwei unterschiedliche Perspektiven – eine subjektive und eine objektive bzw. eine transzendentale und eine anthropologische – vorliegen und sich dabei ergänzen. Dies aber bedeutet, daß die von Zeller geübte Kritik ihr Ziel verfehlt.
Es war bereits davon die Rede, daß der Satz vom zureichenden Grunde in vier Gestalten auftritt, die mit der apriorischen Korrelation von Subjekt und Objekt sowie dem Verhältnis der gesetzmäßigen Abhängigkeit, in dem die Objekte bzw. Vorstellungen der jeweiligen Klasse zueinander stehen, eine gemeinsame Wurzel aufweisen. Verweist jedes Objekt auf ein anderes, so läuft dies für Schopenhauer auf die »Dependenz, Relativität, Instabilität und Endlichkeit der Objekte unsers in Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft, Subjekt und Objekt befangenen Bewußtseyns« (G 175; vgl. a. W I 34, 65 f. u. 221) hinaus, und es bedeutet darüber hinaus, daß es kein Objekt gibt, das als letzter Grund oder Absolutum in Frage käme (vgl. G 171 u. P I 92). Was nun die vier Gestalten des Satzes vom zureichenden Grunde anbelangt, so unterscheidet Schopenhauer zwischen dem Satz vom zureichenden Grunde des Werdens, des Erkennens, des Seins sowie des Handelns, von denen sich eine jede auf eine andere Klasse von Objekten bzw. Vorstellungen bezieht.
Der Satz vom zureichenden Grund des Werdens läuft letztlich auf das »Gesetz der Kausalität« oder – in modernerer Terminologie – das Kausalitätsprinzip hinaus. Schopenhauer formuliert es wie folgt: »Wenn ein neuer Zustand eines oder mehrerer realer Objekte eintritt; so muß ihm ein anderer vorhergegangen seyn, auf welchen der neue regelmäßig, d. h. allemal, so oft der erstere daist, folgt. Ein solches Folgen heißt ein Erfolgen und der erstere Zustand die Ursache, der zweite die Wirkung.« (G 49) Dabei handelt es sich – nach Schopenhauer – um ein apriorisches bzw. transzendentales Gesetz (vgl. G 56, N 289, E 66 f. sowie W II 46 u. 48), das heißt, um eines, dessen Geltungsgrund nicht in der Erfahrung liegt, sondern das vielmehr eine Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung darstellt (vgl. W I 40 u. 553 sowie E 189). Dieses Prinzip bezieht sich allein auf den Bereich der empirischen Wirklichkeit bzw. der Welt als Vorstellung, und es beinhaltet, daß jedes Ereignis in diesem Bereich notwendig nach einer kausalen Regel durch ein anderes, ihm vorhergehendes Ereignis hervorgebracht wird. Indem Schopenhauer jede Wirkung als notwendige Folge einer Ursache betrachtet, nimmt er eine deterministische Position ein, die freilich nur für die empirische Wirklichkeit – also das Verhältnis empirischer Gegenstände bzw. Ereignisse zueinander – gilt. Eine über die Veränderungen in der empirischen Wirklichkeit hinausreichende Geltung kommt ihm, wie Schopenhauer hervorhebt, nicht zu. Damit erstreckt sich das »Gesetz der Kausalität« weder auf die Materie noch auf die Naturkräfte, aber auch das Ding an sich als metaphysische Entität, der Satz vom zureichenden Grunde sowie die apriorische Korrelation von Subjekt und Objekt als transzendentale Strukturen sind ihm nicht unterworfen.
Zwar legt Schopenhauer im § 21 der Abhandlung Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde eine ausführliche Erläuterung der »Apriorität des Kausalitätsbegriffes« vor, doch bereits in dieser Formulierung deutet sich an, daß er dort allenfalls die Apriorität der Kategorie der Kausalität, nicht aber jene des Gesetzes der Kausalität einsichtig macht. Er argumentiert, daß die Kategorie der Kausalität erforderlich ist, um den Übergang von der Empfindung zur empirischen Anschauung bzw. Wahrnehmung zu erklären: »Erst wenn der Verstand […] in Thätigkeit geräth und seine einzige und alleinige Form, das Gesetz der Kausalität, in Anwendung bringt, geht eine mächtige Verwandlung vor, indem aus der subjektiven Empfindung die objektive Anschauung wird.« (G 67) Schopenhauer ist der Auffassung, daß dem erkennenden Subjekt nicht schon in der Empfindung, sondern erst in der Anschauung ein Gegenstand gegeben ist. Das liege daran, daß das Subjekt mit Hilfe des Verstandes bzw. der Kategorie der Kausalität die Empfindung als Resultat der Einwirkung eines Gegenstandes deutet, den es konstruiert und in den Raum projiziert: »[Der Verstand] nämlich faßt, vermöge seiner selbsteigenen Form, also a priori, d. i. vor aller Erfahrung (denn diese ist bis dahin noch nicht möglich), die gegebene Empfindung des Leibes als eine Wirkung auf […], die als solche nothwendig eine Ursache haben muß. […] Bei diesem Proceß nimmt nun der Verstand […] alle, selbst die minutiösesten Data der gegebenen Empfindung zu Hülfe, um, ihnen entsprechend, die Ursache derselben im Raume zu konstruiren.« (G 67 f.)20 Sicherlich trifft es zu, daß man, um eine Wirkung auf eine Ursache zu beziehen, ein Verständnis von Kausalität benötigt, doch Schopenhauer geht erheblich weiter. Er behauptet, daß »das Gesetz der Kausalität uns a priori, folglich als ein, hinsichtlich der Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt, nothwendiges bewußt ist« (E 66). Nun läuft das Kausalitätsprinzip darauf hinaus, daß alle Ereignisse durch andere Ereignisse bewirkt werden. Um aber der Empfindung eine Ursache zuzuordnen, ist es keineswegs erforderlich, alle Ereignisse als kausal abhängig zu betrachten, sondern es genügt zu wissen, daß es überhaupt so etwas wie kausale Abhängigkeit gibt, ganz gleich, ob sie alle oder nur einige Ereignisse kennzeichnet. Damit aber verfehlt Schopenhauer sein Ziel, die apriorische Geltung des Kausalitätsprinzips einsichtig zu machen. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt darin, daß er nicht präzise zwischen der Kategorie der Kausalität einerseits und dem »Gesetz der Kausalität« anderseits unterscheidet.
Der Satz vom zureichenden Grunde des Erkennens bezieht sich hingegen nicht auf empirische Gegenstände, sondern auf Begriffe bzw. auf Urteile, die eine Verbindung von Begriffen darstellen: »Als solcher besagt er, daß wenn ein Urtheil eine Erkenntniß ausdrücken soll, es einen zureichenden Grund haben muß: wegen dieser Eigenschaft erhält es sodann das Prädikat wahr.« (G 121) Damit liefe die Wahrheit eines Urteils darauf hinaus, daß es begründet ist: »Die Wahrheit ist also die Beziehung eines Urtheils auf etwas von ihm Verschiedenes, das sein Grund genannt wird« (ebd.).21 Schopenhauer unterscheidet zwischen vier Arten der Wahrheit, denen er vier Arten von Gründen zuordnet (vgl. G 121 ff.). Dies sind die logische, die empirische, die transzendentale sowie die metalogische Wahrheit. Während die logische Wahrheit eines Urteils darin besteht, daß es formal korrekt von anderen Urteilen – seinen Prämissen – abgeleitet ist, kommt einem Urteil empirische Wahrheit zu, wenn es durch empirische Anschauung bzw. Erfahrung bestätigt wird. Durch transzendentale Wahrheit zeichnen sich hingegen Urteile aus, die apriorische Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung ausdrücken, und durch metalogische Wahrheit diejenigen, welche die formalen Bedingungen des Denkens zum Gegenstand haben. In den beiden letzteren Fällen wird die Begründung, wie Schopenhauer darlegt, durch eine »Reflexion« bzw. eine »Selbstuntersuchung der Vernunft« (G 125) geleistet.
Der Satz vom zureichenden Grunde des Seins zielt auf die apriorischen Formen der Anschauung, Raum und Zeit, ab und besagt, daß raum-zeitliche Objekte durch andere bestimmt sind: »Raum und Zeit haben die Beschaffenheit, daß alle ihre Theile in einem Verhältniß zu einander stehn, in Hinsicht auf welches jeder derselben durch einen andern bestimmt und bedingt ist. Im Raum heißt dies Verhältniß Lage, in der Zeit Folge.« (G 148) Da nun der Raum die Grundlage der Geometrie und die Zeit, wie Schopenhauer – in Anlehnung an Kant – glaubt, die Grundlage der Arithmetik darstellt, könnte man sagen, daß sich der Satz vom zureichenden Grund des Seins auf die anschaulichen Grundlagen der Mathematik bezieht. Ist von einer Bestimmung raum-zeitlicher Gegebenheiten die Rede, so besagt dies nichts anderes, als daß deren Position in Raum und Zeit nicht etwa absolut ist, sondern allein in Relation zu anderen Gegebenheiten angegeben werden kann, die gleichsam den Grund für deren Position ausmachen. Dabei betrachtet Schopenhauer raum-zeitliche Objekte vor dem Hintergrund des transzendentalen Idealismus als bloße Vorstellungen, die freilich nicht in der Erfahrung, sondern in reiner Anschauung gegeben sind.
Im Gegensatz zu den drei ersten Gestalten des Satzes vom zureichenden Grunde hat der Satz vom zureichenden Grunde des Handelns nur ein Objekt, das Subjekt als wollendes. Gelegentlich spricht Schopenhauer von einem »Subjekt des Wollens«, das er dem »Subjekt des Erkennens« gegenüberstellt (G 157 ff.). Einerseits siedelt Schopenhauer das wollende Subjekt in der empirischen Wirklichkeit an, anderseits stuft er die volitionalen Regungen, die es hat, nicht als äußere, sondern als innere Zustände ein. Genau diese Dualität schlägt sich auch im Status des Satzes vom zureichenden Grunde des Handelns nieder. Als empirische Gegebenheit fällt das wollende Subjekt unter den Satz vom zureichenden Grunde des Werdens bzw. das Gesetz der Kausalität, doch angesichts der Tatsache, daß volitionale Regungen nicht dem äußeren, sondern dem inneren Sinn gegeben sind, hält es Schopenhauer für angemessen, eine besondere Art der Kausalität für sie zu fordern: »Hieraus ergiebt sich der wichtige Satz: die Motivation ist die Kausalität von innen gesehn.« (G 162) Daher bezeichnet Schopenhauer den Satz vom zureichenden Grund des Handelns auch als »Gesetz der Motivation« (ebd.). Es beinhaltet, daß volitionale Regungen bzw. Willensakte – zusammen mit den ihnen entsprechenden Handlungen – mit derselben Notwendigkeit durch Motive hervorgebracht werden wie äußere Ereignisse durch äußere Ursachen: »Wie jede Wirkung in der unbelebten Natur ein nothwendiges Produkt zweier Faktoren ist, nämlich der hier sich äußernden allgemeinen Naturkraft und der diese Aeußerung hier hervorrufenden einzelnen Ursache; gerade so ist jede That eines Menschen das nothwendige Produkt seines Charakters und des eingetretenen Motivs. Sind diese Beiden gegeben, so erfolgt sie unausbleiblich.« (E 95)
Dabei vertritt Schopenhauer – in Hinblick auf alle vier Fassungen des Satzes vom zureichenden Grunde – die Auffassung, daß alles, was aus einem Grund folgt, dies mit Notwendigkeit tut. In Anlehnung an die vier Klassen von Objekten unterscheidet Schopenhauer zwischen vier Arten der Notwendigkeit: der physischen, der logischen, der mathematischen sowie der moralischen bzw. praktischen (vgl. G 171). Während die physische Notwendigkeit der kausalen Abhängigkeit von Ursache und Wirkung entspricht, besteht die logische darin, daß sich eine Konklusion notwendig aus ihren Prämissen ergibt. Mathematische Notwendigkeit liegt im Bereich der Zahlen und geometrischen Figuren vor, moralische bzw. praktische hingegen im Bereich des Handelns. In allen vier Bereichen gilt, daß sich die Folge notwendig aus dem Grund ergibt.
Unabhängig von den Schwierigkeiten, die Schopenhauers transzendentaler Idealismus sowie seine Argumentation für die apriorische Geltung des Kausalitätsprinzips mit sich bringen, ist es sicherlich ein Verdienst, daß er sowohl zwischen mehreren Arten von Gründen als auch zwischen mehreren Arten der Erkenntnis unterscheidet. Auf diese Weise lassen sich Verwechslungen vermeiden, wie sie z. B. in der rationalistischen Metaphysik in Hinblick auf den Grund des Werdens (causa) und den Grund des Erkennens (ratio) aufgetreten sind. Anderseits stellt sich die Frage, ob der Grund des Handelns eine selbständige Art von Grund oder nicht vielmehr einen Grund des Werdens darstellt.
Wie erläutert wurde, begrenzt Schopenhauer die Geltung des Satzes vom zureichenden Grunde auf den Bereich der Vorstellung, zu dem er auch die empirische Wirklichkeit als das Gesamt der »anschaulichen, vollständigen, empirischen Vorstellungen« (G 43) rechnet. Damit aber hält er sich zumindest die Möglichkeit einer ontologischen Region offen, die sich dem Satz vom zureichenden Grunde entzieht. Genau dies ist der Bereich des Dinges an sich, den Schopenhauer als den Willen deutet und dem er sich im zweiten Buch seines Hauptwerks zuwendet.