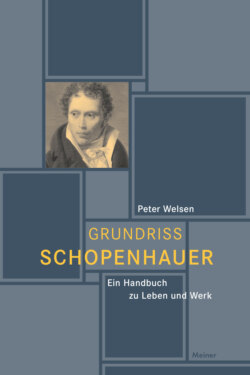Читать книгу Grundriss Schopenhauer - Peter Welsen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Metaphysik des Schönen
ОглавлениеWährend Schopenhauer im ersten und zweiten Buch von Die Welt als Wille und Vorstellung die Realität so beschreibt, wie sie nach seiner Auffassung ist, erläutert er im dritten und vierten, wie sie überwunden werden kann. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, daß er von der »moralischen Bedeutung« der Wirklichkeit überzeugt ist. So stellt er fest: »Daß die Welt bloß eine physische, keine moralische, Bedeutung habe, ist der größte, der verderblichste, der fundamentale Irrthum, die eigentliche Perversität der Gesinnung, und ist wohl im Grunde auch Das, was der Glaube als den Antichrist personificirt hat.« (P II 219) Mit anderen Worten, es geht Schopenhauer nicht einfach nur darum, wie die Welt ist, sondern auch darum, ob und wie sie sein sollte. Bliebe man bei einer bloßen Deskription stehen, wie sie die Metaphysik der Natur liefert, so käme das, wie er meint, einem »trostlosen und unmoralischen Spinozismus« (Vo I 89) gleich. Nach allem, was bisher dargelegt wurde, wäre die Welt nicht zuletzt deshalb negativ zu bewerten, weil der Wille als blinde, erkenntnislose Kraft mit sich selbst entzweit ist und weder für das individuell Seiende noch für die Wirklichkeit als Ganzes ein letztes Ziel hat: »In der That gehört Abwesenheit alles Zieles, aller Gränzen, zum Wesen des Willens an sich, der ein endloses Streben ist.« (W I 217) Unter dieser Voraussetzung ist es keineswegs erstaunlich, daß Schopenhauer zur pessimistischen Auffassung neigt, die Welt sei etwas, das letzten Endes nicht sein sollte. In diesem Sinne erklärt Schopenhauer, daß »wir über das Daseyn der Welt uns nicht zu freuen, vielmehr zu betrüben haben; – daß ihr Nichtseyn ihrem Daseyn vorzuziehn wäre; – daß sie etwas ist, das im Grunde nicht seyn sollte« (W II 674 f.). Nun ist es – nach Schopenhauer – ein legitimes Anliegen der Philosophie, dem Menschen angesichts der Negativität der Wirklichkeit einen Weg zu weisen, mit ihr fertig zu werden, und zwar dadurch, daß er sie überwindet. Damit bietet sich sein Ansatz als Erlösungslehre bzw. Soteriologie dar. Nach seiner Auffassung bestehen zwei Möglichkeiten der Weltüberwindung: eine ästhetische, die Gegenstand der Metaphysik des Schönen ist, und eine ethische, die in der Metaphysik der Sitten zu erörtern ist. Obgleich Schopenhauer dem Schönen durchaus ein hohes Maß an Bedeutung zuerkennt, bekennt er, daß ihm an der Metaphysik der Sitten weitaus mehr als an der Metaphysik des Schönen gelegen ist: »Wenn nun also die Metaphysik der Sitten zu den früher vorzunehmenden Betrachtungen nothwendig hinzukommen muß, um das Mißverstehn derselben zu verhüten, um solche ins gehörige Licht zu stellen, und um überhaupt das Wichtigste und Jedem am meisten Angelegene nicht wegzulassen: so ist hingegen mit der Metaphysik des Schönen dieses nicht in gleichem Grade der Fall, und sie könnte allenfalls, ohne großen Nachtheil, aus dem Ganzen unserer Betrachtungen wegfallen.« (Vo I 90)28
So wie Schopenhauer in einer »ersten Betrachtung« die Welt als Vorstellung (erstes Buch) und die Welt als Wille (zweites Buch) thematisiert, geht er – in einer »zweiten Betrachtung« – erneut auf die Welt als Vorstellung (drittes Buch) und die Welt als Wille (viertes Buch) ein. Dabei besteht der Unterschied zwischen den beiden »Betrachtungen« darin, daß sich die erste beschreibend, die zweite hingegen soteriologisch darbietet. Was nun die Welt als Vorstellung anbelangt, so wird sie im ersten Buch als »dem Satze vom Grunde unterworfen« (W I 27) betrachtet, im dritten aber als »unabhängig vom Satze vom Grunde« (W I 219). Vergegenwärtigt man sich, daß die im ersten Buch behandelten, unter den Satz vom zureichenden Grunde fallenden Vorstellungen die reine und die empirische Anschauung sowie der Begriff sind, so leuchtet ein, daß im dritten Buch von einer anderen Art von Vorstellung die Rede ist, die sich den Anschauungsformen des Raumes und der Zeit sowie der Kategorie der Kausalität entzieht. Schopenhauer bezeichnet diese – mit einem von Platon entlehnten Ausdruck – als Idee oder auch als »Platonische Idee« (W I 219), der er auf seiten des Subjekts eine besondere Weise des Erkennens, die – im Sinne der Ästhetik zu verstehende – Kontemplation zuordnet.29
Da er die Ideen jenseits von Raum und Zeit ansiedelt, ist es nur konsequent, daß Schopenhauer sie als »bleibend« (W I 237) oder »ewig« (W I 222 u. 224) einstuft. Sie gehören damit einem metaphysischen Bereich an, dem er – im Vergleich zur empirischen Wirklichkeit – ein höheres Maß an Dignität zuerkennt (vgl. W I 235). Das zeigt sich an zwei Eigentümlichkeiten der Ideen. Zunächst einmal charakterisiert sie Schopenhauer – an Platon anknüpfend – als Urbilder der empirischen Dinge: »Diese Ideen also insgesammt stellen sich in unzähligen Individuen und Einzelheiten dar, als deren Vorbild sie sich zu diesen ihren Nachbildern verhalten.« (W I 221; vgl. a. W I 224 u. 235) Darüber hinaus ist Schopenhauer überzeugt, daß in den Ideen das Wesen der empirischen Dinge liegt: »Aber nur das Wesentliche aller jener Stufen seiner Objektivation macht die Idee aus: hingegen die Entfaltung dieser, indem sie in den Gestaltungen des Satzes vom Grunde auseinandergezogen wird zu mannigfaltigen und vielseitigen Erscheinungen; dieses ist der Idee unwesentlich, liegt bloß in der Erkenntnißweise des Individuums und hat auch nur für dieses Realität.« (W I 236)30 Da nun unter dem Wesen einer Sache diejenigen Eigenschaften zu verstehen sind, die entscheidend dafür sind, daß sie einer bestimmten Art bzw. Gattung angehört, ist es nicht weiter erstaunlich, daß Schopenhauer erklärt, die Idee enthalte die einer Art bzw. Gattung wesentlichen Eigenschaften (vgl. W II 341, 432 f. u. 566). Sieht man genauer hin, so bemerkt man, daß Schopenhauer die Ideen nicht etwa als gegenständlich betrachtet, sondern das Wesen, das sie zum Ausdruck bringen, mit den in der Metaphysik der Natur eingeführten Objektivationsstufen des Willens gleichsetzt, also den Naturkräften, dem artspezifischen Charakter der Pflanzen und Tiere sowie dem individuellen Charakter des Menschen.31
Als auf das gemeinsame Wesen mehrerer Dinge bezogene Vorstellung ist die Idee – ähnlich wie der Begriff – allgemein (vgl. W II 557), doch sie unterscheidet sich darin von ihm, daß sie nicht abstrakt, sondern anschaulich und nicht unbestimmt, sondern bestimmt ist: »Der Begriff ist abstrakt, diskursiv, innerhalb seiner Sphäre völlig unbestimmt, nur ihrer Gränze nach bestimmt […]. Die Idee dagegen, allenfalls als adäquater Repräsentant des Begriffs zu definiren, ist durchaus anschaulich und, obwohl eine unendliche Menge einzelner Dinge vertretend, dennoch durchgängig bestimmt« (W I 296). Da die Idee den Dingen ontologisch vorgeordnet ist, der Begriff hingegen im Ausgang von bereits gegebenen Dingen durch Abstraktion gewonnen wird, also den Dingen ontologisch nachgeordnet ist, stuft Schopenhauer erstere als »unitas ante rem« und letzteren als »unitas post rem« ein (W I 297 u. W II 434).
In Hinblick auf den Willen als Ding an sich gilt Schopenhauer die Idee als »Objektivation« (W I 178 ff.) oder »Objektität« (W I 179 u. 207) desselben. Damit meint er, daß sich der Wille nicht unmittelbar in der empirischen Wirklichkeit manifestiert, sondern daß er zunächst in den Ideen erscheint. Damit nehmen die Ideen eine mittlere Stellung zwischen dem Ding an sich auf der einen und der empirischen Wirklichkeit auf der anderen Seite ein. Stellt man in Rechnung, daß die Idee dem Willen damit näher steht als die empirische Wirklichkeit, so ist nachvollziehbar, daß Schopenhauer sie als »unmittelbare Objektität« des Willens charakterisiert: »Das einzelne, in Gemäßheit des Satzes vom Grunde erscheinende Ding ist also nur eine mittelbare Objektivation des Dinges an sich (welches der Wille ist), zwischen welchem und ihm noch die Idee steht, als die alleinige unmittelbare Objektität des Willens, indem sie keine andere dem Erkennen als solchem eigene Form angenommen hat, als die der Vorstellung überhaupt, d. i. des Objektseyns für ein Subjekt.« (W I 228) Da die Idee nicht dem Raum, der Zeit und der Kausalität, sondern nur der Subjekt-Objekt-Relation unterworfen ist, hält sich Schopenhauer gar für berechtigt, sie als »adäquate Objektität« (W I 228 u. 233 ff.) des Willens zu bezeichnen.32
Ferner lehrt Schopenhauer, daß sich der Wille in den Ideen in unterschiedlichen Graden oder Stufen objektiviert, die eine hierarchische Ordnung darstellen, die sich von den Naturkräften über die Ideen der Pflanzen und Tiere bis zur Idee des Menschen erstreckt, in der sie kulminiert (vgl. W I 178 ff.).33 Dabei betont Schopenhauer, daß »in allen Ideen, d. h. in allen Kräften der unorganischen und allen Gestalten der organischen Natur, einer und der selbe Wille es ist, der sich offenbart, d. h. in die Form der Vorstellung, in die Objektität, eingeht« (W I 193). Gelegentlich beschreibt Schopenhauer die Ideen, in denen sich der Wille manifestiert, als »Willensakte« (W I 207 ff. u. 211 f.)34 Das mutet insofern merkwürdig an, als unter einem Akt eine Tätigkeit und damit etwas Zeitliches zu verstehen ist, der Wille als Ding an sich aber – sowie auch die Idee – außerhalb der Zeit liegt. Eine ähnlich gelagerte Schwierigkeit besteht darin, begreiflich zu machen, wie der Wille und die Ideen als nicht-zeitliche Entitäten in zeitlichen Entitäten, wie sie die empirischen Dinge sind, in Erscheinung treten können.
Da es sich bei der Idee um eine anschauliche Vorstellung handelt, leuchtet es ein, daß sie Gegenstand einer anschaulichen – und nicht etwa abstrakten – Erkenntnis ist (vgl. W I 307). Gelingt nun dem Menschen die Erkenntnis einer Idee, so erhebt er sich über die Beschränkungen, denen er als empirisches, vom Willen getriebenes Wesen unterworfen ist, und erlebt sich als »reines Subjekt des Erkennens« bzw. »reines Subjekt der Erkenntniß«: »Der […] Uebergang von der gemeinen Erkenntniß einzelner Dinge zur Erkenntniß der Idee geschieht plötzlich, indem die Erkenntniß sich vom Dienste des Willens losreißt, eben dadurch das Subjekt aufhört ein bloß individuelles zu seyn und jetzt reines, willenloses Subjekt der Erkenntniß ist, welches nicht mehr, dem Satze vom Grunde gemäß, den Relationen nachgeht; sondern in fester Kontemplation des dargebotenen Objekts […] ruht und darin aufgeht.« (W I 231) Kennzeichnend für diese Kontemplation ist, daß sich das Subjekt von Raum und Zeit – und damit von seiner Individualität – loslöst (vgl. W I 222), in der betrachteten Idee aufgeht (vgl. W I 232 f.), sich von seinem Willen emanzipiert (vgl. W I 234) und daher – solange dieser Zustand andauert – kein Leiden und keinen Schmerz mehr empfindet. Schopenhauer stellt dazu fest: »[W]ir feiern den Sabbath der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Ixion steht still.« (W I 253) Genau dieser Zustand ließe sich in gewissem Sinne als Erlösung des Menschen vom Druck der Realität deuten.
Zwar konzediert Schopenhauer, daß im Prinzip jeder Mensch in der Lage ist, Ideen zu erkennen (vgl. W I 250), doch schreibt er diese Fähigkeit dem Genie in besonderem Maße zu (vgl. W I 240 ff.). Allerdings versteht er unter einem Genie keineswegs einen Menschen, der sich durch ein besonders hohes Maß an Kreativität oder Originalität auszeichnet, sondern seine hervorstechende Eigenschaft ist eher kognitiv, sie hat weniger mit Subjektivität als mit Objektivität zu tun: »[S] o ist Genialität nichts Anderes, als die vollkommenste Objektivität, d. h. objektive Richtung des Geistes, entgegengesetzt der subjektiven, auf die eigene Person, d. i. den Willen, gehenden. Demnach ist Genialität die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten, sich in die Anschauung zu verlieren und die Erkenntniß, welche ursprünglich nur zum Dienste des Willens daist, diesem Dienste zu entziehn, d. h. sein Interesse, sein Wollen, seine Zwecke, ganz aus den Augen zu lassen, sonach seiner Persönlichkeit sich auf eine Zeit völlig zu entäußern, um als rein erkennendes Subjekt, klares Weltauge, übrig zu bleiben« (W I 240). Gegenstand der besonderen, dem Genie eigentümlichen Art von anschaulicher Erkenntnis sind nicht etwa einzelne Dinge, sondern das Allgemeine bzw. das Wesen der Dinge (vgl. W I 239 u. W II 449 f.). Dies bedeutet, daß mit Objektivität nicht empirische, sondern ideale, das Wesen betreffende Objektivität gemeint ist. Was aber das letztere anbelangt, so siedelt es Schopenhauer bekanntlich in den unveränderlichen, ewigen Ideen an.
Angesichts der Tatsache, daß nach dem Satz vom zureichenden Grunde jedes Objekt in einer Beziehung zu einem anderen Objekt steht und durch sie bestimmt wird, läuft die empirische Erkenntnis darauf hinaus, eine Relation eines Objekts zu anderen herzustellen, während die geniale Erkenntnis gerade darin besteht, das Wesen des Objekts unabhängig von allen Relationen zu erfassen. Letztere bezeichnet der Philosoph auch als »Kontemplation« oder »reine Kontemplation« (W I 239 f. u. 243).
Erfaßt das Genie die Idee, die einem Gegenstand zugrunde liegt, so erfährt es sich als »reines Subjekt des Erkennens« (W I 240). In diesem Zustand erlebt sich das Genie nicht mehr als Individuum, sondern geht in der Idee auf, die es kontempliert. Mehr noch, es löst sich vom Willen los, dem es sonst unterworfen ist (vgl. W I 240 u. 242 f.).35 Da die menschliche Erkenntnis in der Regel vom Willen geleitet und gelegentlich sogar getrübt wird, stellt die Erhebung des Genies über den Willen geradezu die Bedingung der Möglichkeit reinen, objektiven Erkennens dar. Dabei kann man – mit Schopenhauer – das Genie als den »höchsten Grad der Objektivität des Erkennens definiren« (W II 342). Ist in diesem Zusammenhang von der Reinheit der Erkenntnis die Rede, so bezieht sich dies zum einen darauf, daß die Erkenntnis die empirische Wirklichkeit transzendiert, und zum anderen darauf, daß sie nicht unter dem Einfluß des Willens steht. Der Preis, den das Genie für dieses Privileg zu entrichten hat, besteht nach Schopenhauer darin, daß es in praktischen Angelegenheiten wenig Geschick hat (vgl. W I 242) und mehr als gewöhnliche Menschen leidet (vgl. W I 246).
Das Genie ragt nicht allein durch die Erkenntnis der Ideen heraus, sondern es verfügt darüber hinaus über die Fähigkeit, sie zu wiederholen und darzustellen. Dies geschieht, wie Schopenhauer erläutert, in Bereichen wie der Kunst, der Poesie sowie der Philosophie: »Ein Genie ist ein Mensch, der einen doppelten Intellekt hat: den einen für sich, zum Dienste seines Willens, und den andern für die Welt, deren Spiegel er wird, indem er sie rein objektiv auffaßt. Die Summe, oder Quintessenz dieser Auffassung wird, nachdem die technische Ausbildung hinzugekommen ist, in Werken der Kunst, der Poesie, oder der Philosophie wiedergegeben.« (P II 84) Um dies zu leisten, bedarf das Genie der »Besonnenheit« (W I 240 u. 250 f.), das heißt, es muß in der Lage sein, die entsprechende Erkenntnis über den Augenblick hinaus zu konservieren.36 Schopenhauer schreibt dem Genie darüber hinaus auch Phantasie zu. Er erblickt ihre Aufgabe jedoch nicht darin, Beliebiges zu erfinden, sondern darin, die unmittelbar gegebene empirische Wirklichkeit, in der sich die Ideen zumeist nur unvollkommen artikulierten, so zu variieren, daß sich die Ideen in reinerer Gestalt erfassen ließen: »Die Phantasie also erweitert den Gesichtskreis des Genius über die seiner Person sich in der Wirklichkeit darbietenden Objekte, sowohl der Qualität, als der Quantität nach.« (W I 241) Gelingt es dem Genie, die Idee zu erkennen und – z. B. in einem Kunstwerk – darzustellen, so macht es sie auf diese Weise auch anderen Menschen zugänglich: »Der Künstler läßt uns durch seine Augen in die Welt blicken. Daß er diese Augen hat, daß er das Wesentliche, außer allen Relationen liegende der Dinge erkennt, ist eben die Gabe des Genius, das Angeborene; daß er aber im Stande ist, auch uns diese Gabe zu leihen, uns seine Augen aufzusetzen: dies ist das Erworbene, das Technische der Kunst.« (W I 251)
Insbesondere sieht Schopenhauer die Aufgabe der Kunst darin, dem Betrachter die Erkenntnis der Ideen zu erleichtern (vgl. W I 251). Angesichts des Gewichts, das Schopenhauer der Idee in Hinblick auf die Kunst beimißt, überrascht es nicht weiter, daß er sie als Grund des Schönen betrachtet: »Da nun einerseits jedes vorhandene Ding rein objektiv und außer aller Relation betrachtet werden kann; da ferner auch andererseits in jedem Dinge der Wille, auf irgend einer Stufe seiner Objektität, erscheint, und dasselbe sonach Ausdruck einer Idee ist; so ist auch jedes Ding schön.« (W I 268) Trotz seiner hohen Wertschätzung für die Kunst betont Schopenhauer freilich, daß sich die Erkenntnis der Idee nicht in der Kunst, sondern in der Philosophie vollendet: »[S]ie ist ästhetisch, wird, wenn selbstthätig, genial und erreicht den höchsten Grad, wenn sie philosophisch wird […]. Es ist der höchste Grad der Besonnenheit.« (P II 84 Anm.)
Vergegenwärtigt man sich, daß Schopenhauer die Idee als sinnlich und ihre Erkenntnis als anschaulich betrachtet, so ist es konsequent, daß er fordert, die Kunst habe aus der Anschauung, nicht aber aus dem Begriff hervorzugehen (vgl. W I 94 u. 98). Insbesondere hält er die Vorstellung für verfehlt, die Befolgung der Regeln der Ästhetik sei dafür entscheidend, daß ein Kunstwerk von Rang entstehe. Er betont vielmehr, »daß noch kein Künstler es durch Studium der Aesthetik geworden ist« (W I 77). So kann der Künstler »von seinem Thun keine Rechenschaft geben: er arbeitet […] aus bloßem Gefühl und unbewußt, ja instinktmäßig« (W I 298). Unter der Voraussetzung, daß sich die Kunst nicht Begriffen, sondern Ideen verdankt, ist es auch verständlich, daß sie nicht etwa erstere, sondern letztere darstellen soll. So lehnt Schopenhauer den Versuch einer allegorischen Darstellung von Begriffen in den bildenden Künsten ab (vgl. W I 299 ff. u. W II 497). Umgekehrt ist er sich darüber im klaren, daß Ideen in der Sprache nur mit Hilfe von Begriffen ausgedrückt werden können. Angesichts dieser Schwierigkeit macht er geltend, daß Ideen unerschöpflich sind und nicht in Begriffen aufgehen (vgl. W II 479 u. 482). Diesem Umstand könne man dadurch gerecht werden, daß man den Begriff in einem bildlichen, übertragenen Sinne gebrauche, um die Phantasie »auf das Anschauliche zu leiten« (W I 303).37 Dazu erklärt Schopenhauer: »Solches geschieht schon in jedem tropischen Ausdruck, und geschieht in jeder Metapher, Gleichniß, Parabel und Allegorie, welche alle nur durch die Länge und Ausführlichkeit ihrer Darstellung sich unterscheiden. In den redenden Künsten sind dieserwegen Gleichnisse und Allegorien von trefflicher Wirkung.« (W I 303 f.) Durch den Vorrang der Anschauung unterscheide sich die Kunst auch von der Philosophie, die sich in erster Linie des Begriffs bediene und die nicht etwa Einzelnes, sondern das Ganze der Wirklichkeit präsentiere: »Zur Philosophie verhält sich die Poesie, wie die Erfahrung sich zur empirischen Wissenschaft verhält. Die Erfahrung nämlich macht uns mit der Erscheinung im Einzelnen und beispielsweise bekannt: die Wissenschaft umfaßt das Ganze derselben, mittelst allgemeiner Begriffe.« (W II 503) Da sich – mit der Idee – der Gehalt der Kunst letzten Endes nicht auf den Begriff bringen lasse, sondern sich als unerschöpflich erweise, halte sich die Antwort, die sie auf die Frage nach dem Wesen der Wirklichkeit gebe, in einer Offenheit, die allenfalls die Philosophie aufheben könne: »Ihre Antwort, so richtig sie auch seyn mag, wird jedoch immer nur eine einstweilige, nicht eine gänzliche und finale Befriedigung gewähren. Denn sie [gibt] immer nur ein Fragment, ein Beispiel statt der Regel, nicht das Ganze, als welches nur in der Allgemeinheit des Begriffes gegeben werden kann. Für diesen daher, also für die Reflexion und in abstracto, eine eben deshalb bleibende und auf immer genügende Beantwortung jener Frage zu geben, – ist die Aufgabe der Philosophie.« (W II 479 f.)
Die Wirkung der Kunst besteht nach Schopenhauer zunächst darin, den Betrachter zur Erkenntnis der Ideen anzuregen und sie ihm zu erleichtern (vgl. W I 251). Zwar ist Schopenhauer davon überzeugt, daß diese sowohl der Natur als auch der Kunst zugrunde liegen, so daß beide als schön gelten können, doch er legt dar, daß die Kunst darauf angelegt ist, das in der Natur anzutreffende Ideale durch ihren gestaltenden Eingriff so zu präsentieren, daß es auch einem Betrachter zugänglich wird, der – im Vergleich zum Künstler – »schwächere Empfänglichkeit und keine Produktivität hat« (W I 299). Mit anderen Worten, er führt die Erleichterung der Erkenntnis darauf zurück, »daß der Künstler, der nur die Idee, nicht mehr die Wirklichkeit erkannte, in seinem Werk auch nur die Idee rein wiederholt hat, sie ausgesondert hat aus der Wirklichkeit, mit Auslassung aller störenden Zufälligkeiten« (W I 251). Damit der Betrachter die Ideen erfassen kann, muß er allerdings – ähnlich wie der Künstler, nur in geringerem Maße – die entsprechende Fähigkeit besitzen: »Wir müssen daher in allen Menschen […] jenes Vermögen[,] in den Dingen ihre Ideen zu erkennen, und eben damit sich ihrer Persönlichkeit augenblicklich zu entäußern, als vorhanden annehmen. Der Genius hat vor ihnen nur den viel höhern Grad und die anhaltendere Dauer jener Erkenntnißweise voraus« (W I 250 f.). Einen weiteren Grund dafür, daß die Kunst der Erkenntnis der Idee förderlich ist, erblickt Schopenhauer darin, daß Gegenstände, die einem nicht in der Wirklichkeit, sondern in der künstlerischen Darstellung begegnen, den Willen weniger ansprechen und daher eine objektivere Betrachtung ermöglichen: »Daß also das Kunstwerk die Auffassung der Ideen, in welcher der ästhetische Genuß besteht, so sehr erleichtert, beruht nicht bloß darauf, daß die Kunst, durch Hervorhebung des Wesentlichen und Aussonderung des Unwesentlichen, die Dinge deutlicher und charakteristischer darstellt, sondern eben so sehr darauf, daß das zur rein objektiven Auffassung des Wesens der Dinge erforderte gänzliche Schweigen des Willens am sichersten dadurch erreicht wird, daß das angeschaute Objekt selbst gar nicht im Gebiete der Dinge liegt, welche einer Beziehung zum Willen fähig sind, indem es kein Wirkliches, sondern ein bloßes Bild ist.« (W II 438 f.) Wie gerade angedeutet wurde, ruft die Erkenntnis der Ideen beim Betrachter »ästhetischen Genu[ß]« bzw. »ästhetische[s] Wohlgefallen« (W I 250 f. u. 271) hervor. Das liegt – nach Schopenhauer – einerseits an der Idee selbst, die ihm als schön gilt, anderseits daran, daß der Wille in der Kontemplation zur Ruhe kommt und damit auch das Leiden an der Wirklichkeit aussetzt. Letzteres sei eher der Fall, wenn die Idee einer niedrigeren Stufe der Objektität des Willens, ersteres hingegen, wenn sie einer höheren angehöre (vgl. W I 271). Tritt der Wille beim Genuß des Schönen in den Hintergrund und findet dadurch eine Entlastung des Menschen von der Negativität der Wirklichkeit statt, so bietet sich die ästhetische Erfahrung als Vorstufe oder Vorwegnahme der Erlösung dar, die allerdings nicht dauerhaft ist. Schopenhauer stellt dazu fest: »Jene reine, wahre und tiefe Erkenntniß des Wesens der Welt wird [dem Künstler] nun Zweck an sich: er bleibt bei ihr stehn. Daher wird sie ihm nicht, wie wir es […] bei dem zur Resignation gelangten Heiligen sehn werden, Quietiv des Willens, erlöst ihn nicht auf immer, sondern nur auf Augenblicke vom Leben, und ist ihm so noch nicht der Weg aus demselben, sondern nur einstweilen ein Trost in demselben; bis seine dadurch gesteigerte Kraft, endlich des Spieles müde, den Ernst ergreift.« (W I 335)
Schopenhauer weist den einzelnen Künsten einen unterschiedlichen Rang zu, der sich nach den Ideen bemißt, die sich darin ausdrücken (vgl. W I 269). Dabei geht er von der – freilich nicht eigens begründeten – Annahme aus, daß jede Idee eine niedrigere oder höhere Stufe der Objektität des Willens darstellt. Während der Baukunst lediglich Naturkräfte wie die Schwere, Kohäsion, Starrheit oder Härte zugrunde lägen und sich darin ästhetische Zwecke mit nützlichen verbänden (vgl. W I 273 u. 276 f.), stelle die Gartenkunst die »höhere Stufe der vegetabilischen Natur« (W I 278) dar. Über der Bau- und Gartenkunst siedelt Schopenhauer die bildenden Künste an. Diese gliedert er in Landschaftsmalerei, Tiermalerei, Historienmalerei und Skulptur. Er ordnet ihnen die Ideen zu, welche den einzelnen Gattungen der Pflanzen und Tiere sowie dem Menschen entsprechen, der sich dadurch auszeichne, daß bei ihm der Charakter der Gattung und der Charakter des Individuums auseinander träten: »Bei der Darstellung des Menschen sondert sich nun aber der Gattungscharakter vom Charakter des Individuums: jener heißt nun Schönheit […], dieser aber behält den Namen Charakter oder Ausdruck bei« (W I 280; vgl. a. W I 285). Schopenhauer ist überzeugt, daß die Idee des Menschen – vor jenen der Tiere, Pflanzen und Naturkräfte – den höchsten Rang einnimmt und dies auch für die menschliche Schönheit bzw. die Künste gilt, in denen sie dargestellt wird: »Darum ist der Mensch vor allem Andern schön und die Offenbarung seines Wesens das höchste Ziel der Kunst. Menschliche Gestalt und menschlicher Ausdruck sind das bedeutendeste Objekt der bildenden Kunst, so wie menschliches Handeln das bedeutendeste Objekt der Poesie.« (W I 269; vgl. a. W I 281 u. 308) Einerseits ist der bildenden Kunst und der Poesie gemeinsam, daß sie den Menschen darstellen, anderseits ist Schopenhauer überzeugt, daß letztere der ersteren überlegen ist. Er begründet seine Auffassung damit, daß allein die Poesie dem Menschen in seiner Komplexität gerecht wird: »Wenn aber, in der Darstellung der niederigeren Stufen der Objektität des Willens, die bildende Kunst sie meistens übertrifft, weil die erkenntnißlose und auch die bloß thierische Natur in einem einzigen wohlgefaßten Moment fast ihr ganzes Wesen offenbart; so ist dagegen der Mensch, soweit er sich nicht durch seine bloße Gestalt und Ausdruck der Miene, sondern durch eine Kette von Handlungen und sie begleitender Gedanken und Affekte ausspricht, der Hauptgegenstand der Poesie, der es hierin keine andere Kunst gleich thut, weil ihr dabei die Fortschreitung zu Statten kommt, welche den bildenden Künsten abgeht.« (W I 308) Unter den literarischen Gattungen aber kommt – nach Schopenhauer – dem Trauerspiel der höchste Rang zu. Es stelle den »Gipfel der Dichtkunst, sowohl in Hinsicht auf die Größe der Wirkung, als auf die Schwierigkeit der Leistung« (W I 318) dar. Inhaltlich zeichne es sich dadurch aus, daß es die Negativität der Wirklichkeit thematisiere, die Schopenhauer auf einen Konflikt des Willens mit sich selbst zurückführt: »Es ist der Widerstreit des Willens mit sich selbst, welcher hier, auf der höchsten Stufe seiner Objektität, am vollständigsten entfaltet, furchtbar hervortritt.« (ebd.) Damit läßt das Trauerspiel eine besondere Affinität zu Schopenhauers pessimistischer Weltsicht erkennen.
Die in metaphysischer Hinsicht interessanteste Kunst erblickt Schopenhauer jedoch in der Musik. Er weist ihr insofern eine Sonderstellung innerhalb der Künste zu, als er ihre Aufgabe nicht in der Darstellung von Ideen, sondern des Willens selbst erblickt. Diesen drückt sie unmittelbar – das heißt, ohne Vermittlung durch Ideen – aus: »Die Musik ist nämlich eine so unmittelbare Objektivation und Abbild des ganzen Willens, wie die Welt selbst es ist, ja wie die Ideen es sind, deren vervielfältigte Erscheinung die Welt der einzelnen Dinge ausmacht. Die Musik ist also keineswegs, gleich den andern Künsten, das Abbild der Ideen, sondern Abbild des Willens selbst, dessen Objektität auch die Ideen sind« (W I 324). Damit kommt der Musik ein höherer Grad an Allgemeinheit zu als den anderen Künsten, die auf einzelne Ideen beschränkt sind. Sie ist, wie Schopenhauer erklärt, die »ausgedehntest[e]« (W II 534) unter den Künsten. Da die Musik mit dem Willen diejenige Instanz zum Ausdruck bringt, welche das Wesen des Menschen ausmacht und ihn letztlich bestimmt, spricht sie ihn mit einer besonderen Intensität an. Ihre Wirkung ist deshalb »sehr viel mächtiger und eindringlicher, als die der andern Künste« (W I 324).
Freilich ist sich Schopenhauer darüber im klaren, daß der Wille als Ding an sich nicht unmittelbar zugänglich ist und daß er seine Konzeption der Musik nicht im Sinne eines strengen Beweises einsichtig machen kann. So stellt er fest: »[W]elchen Aufschluß jedoch zu beweisen, ich als wesentlich unmöglich erkenne; da er ein Verhältniß der Musik, als einer Vorstellung, zu Dem, was wesentlich nie Vorstellung seyn kann, annimmt und festsetzt, und die Musik als Nachbild eines Vorbildes, welches selbst nie unmittelbar vorgestellt werden kann, angesehn haben will.« (W I 323) Vergegenwärtigt man sich, daß auch die Philosophie das Ding an sich als das Wesen der Welt zum Gegenstand hat, so kann man nachvollziehen, daß Schopenhauer der Musik geradezu einen philosophischen Rang zuerkennt: »Musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi.« (W I 332)38
Schopenhauer beschreibt das Verhältnis der Musik zur empirischen Wirklichkeit sowie zu den Ideen, die ihr zugrunde liegen, als »Analogie« (W I 323 f., 328 f. u. 331) bzw. »Parallelismus« (W I 324 u. W II 526).39 So legt er dar, daß die einzelnen Stimmen des vierstimmigen Satzes der Stufenfolge der Ideen entsprechen (vgl. W I 324 ff. u. W II 526), und ordnet der obersten, die Melodie artikulierenden Stimme die Idee des Menschen zu (vgl. W I 326 u. W II 526). Darüber hinaus erblickt Schopenhauer in der Entwicklung von Melodie, Harmonie und Rhythmus einen Ausdruck der Bewegung des Willens zwischen Wunsch und Befriedigung bzw. Entzweiung und Versöhnung (vgl. W I 326 f. sowie W II 530, 532 u. 534). Ähnlich interpretiert er den Gegensatz von Dur und Moll: »Aber wie wundervoll ist die Wirkung von Moll und Dur! Wie erstaunlich, daß der Wechsel eines halben Tones, der Eintritt der kleinen Terz, statt der großen, uns sogleich und unausbleiblich ein banges, peinliches Gefühl aufdringt, von welchem uns das Dur wieder eben so augenblicklich erlöst.« (W I 328)
Hält man sich vor Augen, daß die Musik auf eine Darstellung des Willens hinausläuft, so ist es nicht weiter erstaunlich, daß sich ihre Wirkung insbesondere auf die emotionale und voluntative Seite des Menschen erstreckt. So erklärt Schopenhauer: »Weil die Musik nicht, gleich allen andern Künsten, die Ideen, oder Stufen der Objektivation des Willens, sondern unmittelbar den Willen selbst darstellt; so ist hieraus auch erklärlich, daß sie auf den Willen, d. i. die Gefühle, Leidenschaften und Affekte des Hörers, unmittelbar einwirkt, so daß sie dieselben schnell erhöht, oder auch umstimmt.« (W II 527) Freilich erblickt Schopenhauer in der Musik kein Stimulans, das sich damit begnügte, den Willen zu erregen, sondern er stellt sie insofern mit den anderen Künsten auf eine Stufe, als auch sie eine Haltung des reinen Erkennens hervorrufe. Diese habe zwar die Affektionen des Willens zum Gegenstand, doch sie würden nicht unmittelbar als solche, sondern mittelbar erlebt: »Wir sehn also hier die Willensbewegungen auf das Gebiet der bloßen Vorstellung hinübergespielt, als welche der ausschließliche Schauplatz der Leistungen aller schönen Künste ist; da diese durchaus verlangen, daß der Wille selbst aus dem Spiel bleibe und wir durchweg uns als rein Erkennende verhalten. Daher dürfen die Affektionen des Willens selbst, also wirklicher Schmerz und wirkliches Behagen, nicht erregt werden, sondern nur ihre Substitute, das dem Intellekt Angemessene, als Bild der Befriedigung des Willens, und das jenem mehr oder weniger Widerstrebende, als Bild des größern oder geringern Schmerzes.« (W II 531)