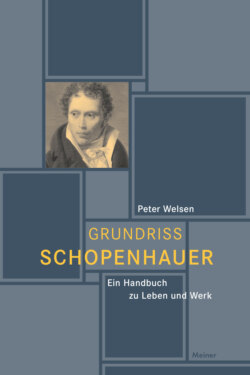Читать книгу Grundriss Schopenhauer - Peter Welsen - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Metaphysik der Natur
ОглавлениеSchopenhauer bleibt keineswegs bei dem transzendentalen Idealismus seiner erkenntnistheoretischen Betrachtung stehen, sondern er betont, daß diese »eine einseitige« (W I 30) sei und daher einer Korrektur bedürfe. Diese läuft darauf hinaus, daß die Welt nicht nur Vorstellung sei, sondern einen weiteren, die empirische Wirklichkeit übersteigenden metaphysischen Bereich enthalte, nämlich jenen des Dinges an sich. Damit ergänzt Schopenhauer – ähnlich wie Kant – seinen transzendentalen Idealismus durch einen ontologischen bzw. metaphysischen Realismus, das heißt, er geht von der Existenz von etwas Wirklichem jenseits der empirischen Realität aus. Im Gegensatz zu Kant begnügt sich Schopenhauer nicht etwa damit, daß das Ding an sich unerkennbar ist, sondern er ist der Auffassung, daß es als Wille zu deuten sei. Genau darin erblickt er das »Fundamentaldogma« (N 183) seiner Metaphysik.
Schopenhauer nennt zunächst einmal zwei Gründe dafür, daß er sich nicht mit einer Untersuchung der empirischen Wirklichkeit begnügt, sondern den Schritt in die Metaphysik vollzieht. Zum einen macht er geltend, die Erscheinung bzw. Vorstellung impliziere, daß ihr etwas von ihr Verschiedenes zugrunde liegt: »Denn offenbar setzt Jenes als Erscheinung ein Erscheinendes, als Seyn für Anderes ein Seyn für sich, und als Objekt ein Subjekt voraus; nicht aber umgekehrt: weil überall die Wurzel der Dinge in Dem, was sie für sich selbst sind, also im Subjektiven liegen muß, nicht im Objektiven, d. h. in Dem, was sie erst für Andere, in einem fremden Bewußtseyn sind.« (W II 569 f.; vgl. a. W II 214 f. u. P I 104) – Zum andern hebt Schopenhauer hervor, daß die empirischen Wissenschaften nicht in der Lage seien, eine erschöpfende Erklärung der Welt als Vorstellung bzw. von deren Wesen zu liefern. Vielmehr blieben sie als Morphologie und als Ätiologie bei der Erscheinung stehen, ohne Rechenschaft über die darin wirksamen Naturkräfte zu geben, die als qualitates occultae nach zusätzlicher Aufklärung verlangten.
Darüber hinaus nennt Schopenhauer einen weiteren, für ihn letztlich entscheidenden Grund, der ihn veranlaßt, die Welt als Vorstellung in Richtung auf das Ding an sich zu überschreiten. Angesichts der Negativität der empirischen Wirklichkeit werde der Mensch in Erstaunen versetzt und vom Bedürfnis ergriffen, ein tieferes Verständnis von ihr zu gewinnen: »Wenn die Welt nicht etwas wäre, das, praktisch ausgedrückt, nicht seyn sollte; so würde sie auch nicht theoretisch ein Problem seyn: vielmehr würde ihr Daseyn entweder gar keiner Erklärung bedürfen, indem es sich so gänzlich von selbst verstände, daß eine Verwunderung darüber und Frage danach in keinem Kopfe aufsteigen könnte; oder der Zweck desselben würde sich unverkennbar darbieten.« (W II 677 f.) Eine Lösung des Problems verspricht sich Schopenhauer nun von der Metaphysik, die er wie folgt beschreibt: »Unter Metaphysik verstehe ich jede angebliche Erkenntniß, welche über die Möglichkeit der Erfahrung, also über die Natur, oder die gegebene Erscheinung der Dinge, hinausgeht, um Aufschluß zu ertheilen über Das, wodurch jene, in einem oder dem andern Sinne, bedingt wäre; oder, populär zu reden, über Das, was hinter der Natur steckt und sie möglich macht.« (W II 191) Man könnte also sagen, daß Schopenhauers Antwort auf die Frage nach dem Ding an sich nicht zuletzt durch das »metaphysische Bedürfnis« motiviert ist.
Wie bereits angedeutet wurde, will Schopenhauer den »ächten« oder »wahren Kriticismus« (HN I 20, 24, 37, 126 u. 151) errichten. Dies bedeutet zunächst einmal, daß er die dogmatische Metaphysik ebenso ablehnt wie Kants kritizistische Auffassung, das Ding an sich lasse sich nicht erkennen. So erstaunt es nicht, daß Schopenhauer in seiner Metaphysik eine neue Richtung einschlägt: »[M]ein Weg liegt in der Mitte zwischen der Allwissenheitslehre der frühern Dogmatik und der Verzweiflung der Kantischen Kritik.« (W I 526)
Schopenhauer führt Kants – sei es angeblichen oder tatsächlichen – Fehler auf die Annahme zurück, die Metaphysik dürfe sich nicht auf Erfahrung stützen. Genau darin erblickt er eine petitio principii (vgl. W I 525 u. W II 211). Mehr noch, Schopenhauer betont, daß sich die Metaphysik der Erfahrung zu bedienen hat, um Auskunft über das Ding an sich erteilen zu können: »Ich sage daher, daß die Lösung des Räthsels der Welt aus dem Verständniß der Welt selbst hervorgehn muß; daß also die Aufgabe der Metaphysik nicht ist, die Erfahrung, in der die Welt dasteht, zu überfliegen, sondern sie von Grund aus zu verstehn, indem Erfahrung, äußere und innere, allerdings die Hauptquelle aller Erkenntniß ist; daß daher nur durch die gehörige und am rechten Punkt vollzogene Anknüpfung der äußern Erfahrung an die innere, und dadurch zu Stande gebrachte Verbindung dieser zwei so heterogenen Erkenntnißquellen, die Lösung des Räthsels der Welt möglich ist« (W I 526). Aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Erfahrung bezeichnet Schopenhauer seine Metaphysik als »immanent« (W II 214) bzw. als »immanenten Dogmatismus« (P I 148), ja er stuft sie sogar als »Erfahrungswissenschaft« (ebd.) ein.
Allerdings meint er damit nicht, daß sie sich in Erfahrung erschöpfe oder gar mit ihrer Hilfe das Ding an sich zur anschaulichen Gegebenheit bringe, sondern allenfalls, daß sie ihren Ausgang von der Erfahrung nehme und auch dann, wenn sie über diese hinausgehe, an sie gebunden bleibe: »In diesem Sinne also geht die Metaphysik über die Erscheinung, d. i. die Natur, hinaus, zu dem in oder hinter ihr Verborgenen […], es jedoch immer nur als das in ihr Erscheinende, nicht aber unabhängig von aller Erscheinung betrachtend: sie bleibt daher immanent und wird nicht transscendent. Denn sie reißt sich von der Erfahrung nie ganz los, sondern bleibt die bloße Deutung und Auslegung derselben, da sie vom Dinge an sich nie anders, als in seiner Beziehung zur Erscheinung redet.« (W II 214) Mit dieser Wendung rückt Schopenhauer die empirische Wirklichkeit in die Nähe eines Textes, der nicht einfach nur einen unmittelbar zugänglichen, manifesten, sondern darüber hinaus auch einen im Zuge einer hermeneutischen Bemühung – der »Deutung« oder »Auslegung« – zu ermittelnden latenten Sinn aufweist. Ebenfalls auf dieser Linie bewegt sich Schopenhauer, wenn er das, was die Metaphysik zu ergründen hat, nämlich das »wahre«, »innere« oder gar »innerste Wesen der Welt« (W I 139 f., 152, 154, 156 u. 168) mit einem der Hermeneutik entlehnten Ausdruck als ihre »Bedeutung« (W I 137, 141 u. 165) anspricht oder den Denkern – im Gegensatz zu den bloßen Gelehrten – die Aufgabe zuweist, im »Buche der Welt« (P II 538) zu lesen.
Da nun die Metaphysik von der Erfahrung abhängt, diese aber keine apodiktische Erkenntnis zu liefern vermag, gilt dies auch für die Metaphysik selbst: »Der hier erörterte, redlicherweise nicht abzuleugnende Ursprung der Metaphysik aus empirischen Erkenntnißquellen benimmt ihr freilich die Art apodiktischer Gewißheit, welche allein durch Erkenntniß a priori möglich ist« (W II 212). Das hindert Schopenhauer allerdings nicht daran, die Aussichten auf eine Vollendung der Metaphysik überraschend günstig einzuschätzen: »Wann aber ein Mal ein, soweit die Schranken des menschlichen Intellekts es zulassen, richtiges System der Metaphysik gefunden seyn wird; so wird ihm die Unwandelbarkeit einer a priori erkannten Wissenschaft doch zukommen: weil sein Fundament nur die Erfahrung überhaupt seyn kann, nicht aber die einzelnen und besondern Erfahrungen, durch welche hingegen die Naturwissenschaften stets modificirt werden und der Geschichte immer neuer Stoff zuwächst. Denn die Erfahrung im Ganzen und Allgemeinen wird nie ihren Charakter gegen einen neuen vertauschen.« (W II 212 f.) Von der – von führenden Repräsentanten der modernen Hermeneutik vertretenen – Überzeugung, der Prozeß der Auslegung lasse sich nicht zum Abschluß bringen, sondern sei ins Unendliche fortzusetzen, ist Schopenhauer damit ein gutes Stück entfernt.22
Schopenhauer erblickt die Aufgabe der Metaphysik weniger in der »Beobachtung einzelner Erfahrungen« als in der »richtige[n] Erklärung der Erfahrung im Ganzen«, so daß er sie auch als »Wissenschaft von der Erfahrung überhaupt« (W II 211) bezeichnen kann. Dabei vergleicht er die sich in der Erfahrung darbietende empirische Wirklichkeit mit einer »unbekannten Schrift« (W II 215 u. P II 26) oder »Geheimschrift« (W II 213), die es zu dechiffrieren gelte. Um diesen Vorgang zu charakterisieren, benutzt er Ausdrücke wie »Deutung« und »Auslegung« bzw. »Sinn« und »Bedeutung«, die aus dem Bereich der Hermeneutik stammen (W II 213 ff. u. P II 26). Als Kriterien für die Richtigkeit einer derartigen Interpretation nennt er zum einen ihre Kohärenz und zum andern ihre Übereinstimmung mit der empirischen Wirklichkeit (vgl. W II 215 f. u. P II 26).23 Allerdings ist sich Schopenhauer darüber im klaren, daß jede solche Interpretation, auch seine eigene, unter dem Vorbehalt steht, daß sie ihren Gegenstand, das Ding an sich, nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar – auf dem Umweg über eine Interpretation der empirischen Wirklichkeit – zu erfassen vermag. Er stellt dazu fest: »So läßt meine Lehre Uebereinstimmung und Zusammenhang in dem kontrastirenden Gewirre der Erscheinungen dieser Welt erblicken und löst die unzähligen Widersprüche, welche dasselbe, von jedem andern Standpunkt aus gesehn, darbietet: sie gleicht daher insofern einem Rechenexempel, welches aufgeht; wiewohl keineswegs in dem Sinne, daß sie kein Problem zu lösen übrig, keine mögliche Frage unbeantwortet ließe. Dergleichen zu behaupten, wäre eine vermessene Ableugnung der Schranken menschlicher Erkenntniß überhaupt. Welche Fackel wir auch anzünden und welchen Raum sie auch erleuchten mag; stets wird unser Horizont von tiefer Nacht umgränzt bleiben. Denn die letzte Lösung des Räthsels der Welt müßte nothwendig bloß von den Dingen an sich, nicht mehr von den Erscheinungen reden.« (W II 216) Mit anderen Worten, es ist die – im transzendentalen Idealismus – angelegte Beschränkung der Erkenntnis auf den Bereich der Vorstellung, welche die Metaphysik zu einem Rekurs auf die Interpretation nötigt und diese ihrerseits daran hindert, ihren Gegenstand, das Ding an sich, adäquat zu erkennen.
In seiner Metaphysik der Natur beschreitet Schopenhauer zwei verschiedene, einander entgegengesetzte Wege: Zum einen dringt er von der empirischen Wirklichkeit zum Ding an sich vor, und zum andern schlägt er daraufhin die umgekehrte Richtung ein, indem er versucht, erstere als Objektivation des letzteren zu verstehen. Was die Erschließung des Dinges an sich im Ausgang von der Welt als Vorstellung anbelangt, so fällt auf, daß sich Schopenhauer zunächst dem Individuum als einem wollenden zuwendet und daß er dies erst in empirischer und dann in metaphysischer Hinsicht tut. Dabei vollzieht er eine Reihe interpretatorischer Schritte, die es legitim erscheinen lassen, von einer Hermeneutik des Individualwillens zu sprechen.24
Die einzelnen Schritte, die Schopenhauer vollzieht, um zur Erkenntnis des Individualwillens zu gelangen, erweisen sich in mehrfacher Hinsicht als recht komplex. Bald macht sich der Philosoph empirische, bald metaphysische Überlegungen zunutze, und sein tatsächliches Vorgehen deckt sich nicht immer mit seiner Einschätzung desselben. Dazu kommt eine Reihe terminologischer Unschärfen, welche das Verständnis erschweren. Immerhin steht soviel fest, daß Schopenhauer bei seinem Unternehmen auf eine Verbindung von innerer und äußerer Erfahrung setzt. Was die erstere betrifft, so legt er dar, daß im »Selbstbewußtseyn« das, worauf es ihm ankomme, unmittelbar gegeben sei. Freilich ist seine Beschreibung des Gegebenen erheblichen Schwankungen unterworfen. So ist die Rede vom »Subjekt des Wollens«, dem »Wollen«, dem »Willen« sowie auch von dessen »Akten«, »Affektionen« oder »Regungen«. Da schwer nachzuvollziehen ist, daß dem erkennenden Subjekt ein anderes, wollendes Subjekt bzw. ein Subjekt des Wollens gegeben ist oder daß eine Disposition, wie sie der Wille ist, als Gegenstand in Erscheinung tritt, liegt die Vermutung nahe, daß Akte des Willens das Gegebene ausmachen. Schopenhauer hat recht, wenn er konstatiert: »Ich erkenne meinen Willen nicht im Ganzen, nicht als Einheit, nicht vollkommen, seinem Wesen nach; sondern ich erkenne ihn allein in seinen einzelnen Akten.« (Vo II 76) Da nun die inneren Zustände, die Schopenhauer als Akte des Willens deutet, also die entsprechenden affektiven, emotionalen und volitiven Erlebnisse25, offenbar der Form der Zeit unterworfen bzw. durch sie vermittelt sind, ist es notwendig, die Rede von der unmittelbaren Gegebenheit der Willensakte wie folgt zu modifizieren: »Wäre dieses Sichbewußtwerden ein unmittelbares; so hätten wir eine völlig adäquate Erkenntniß des Dinges an sich. Weil es aber dadurch vermittelt ist, daß der Wille den organischen Leib und, mittelst eines Theiles desselben, sich einen Intellekt schafft, dann aber erst durch diesen sich im Selbstbewußtseyn als Willen findet und erkennt; so ist diese Erkenntniß des Dinges an sich erstlich durch das darin schon enthaltene Auseinandertreten eines Erkennenden und eines Erkannten und sodann durch die vom cerebralen Selbstbewußtseyn unzertrennliche Form der Zeit bedingt, daher also nicht völlig erschöpfend und adäquat.« (P II 105) Es läßt sich resümieren, daß Schopenhauer die im »Selbstbewußtseyn« gegebenen inneren Zustände zur Kenntnis nimmt und sie, indem er sie unter den Begriff des Willens subsumiert, als Ausdruck einer empirischen Disposition des Subjekts interpretiert, die in dessen Fähigkeit besteht, entsprechende Regungen zu erleben.
Darüber hinaus wendet sich Schopenhauer auch der äußeren Erfahrung zu und versucht, sie mit der inneren zu verbinden. Genauer gesagt betrachtet er den Leib aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: »Dem Subjekt des Erkennens […] ist dieser Leib auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben: ein Mal als Vorstellung in verständiger Anschauung, als Objekt unter Objekten, und den Gesetzen dieser unterworfen; sodann aber auch zugleich auf eine ganz andere Weise, nämlich als jenes Jedem unmittelbar Bekannte, welches das Wort Wille bezeichnet.« (W I 143) Dabei ordnet er zunächst jedem Willensakt, der im »Selbstbewußtseyn« gegeben ist, eine Aktion des Leibes zu. In einem weiteren Schritt transzendiert Schopenhauer den Bereich der Erfahrung, indem er nicht allein den willkürlichen, sondern allen Bewegungen des Leibes einen Willensakt zuordnet. So betont er: »Die Aktion des Leibes ist nichts Anderes, als der objektivirte, d. h. in die Anschauung getretene Akt des Willens. Weiterhin wird sich uns zeigen, daß dieses von jeder Bewegung des Leibes gilt, nicht bloß von der auf Motive, sondern auch von der auf bloße Reize erfolgenden unwillkürlichen, ja, daß der ganze Leib nichts Anderes, als der objektivirte, d. h. zur Vorstellung gewordene Wille ist« (ebd.). Mit anderen Worten, Schopenhauer dehnt den Bereich des Willentlichen dadurch aus, daß er – über die im »Selbstbewußtseyn« gegebenen Willensakte hinaus – unbewußte Regungen des Willens einführt, die es ihm gestatten, einen Parallelismus von Physischem und Psychischem anzunehmen bzw. die Identität von Leib und Wille zu lehren. Hält man sich vor Augen, daß weder die unbewußten Willensakte noch der Wille als empirische Disposition, welche den – bewußten wie unbewußten – Akten zugrunde liegt, anschaulich gegeben sind, so leuchtet ohne weiteres ein, daß es sich in beiden Fällen um Resultate handelt, zu denen Schopenhauer lediglich auf dem Weg einer Interpretation der inneren und äußeren Erfahrung gelangt.
Freilich bleibt Schopenhauer nicht bei einer Erläuterung der Willensakte oder des Willens als einer empirischen Disposition stehen, sondern unternimmt den Versuch, den Willen als das Ding an sich zu erweisen. Dabei geht er von der – bereits erwähnten – Identität von Leib und Wille aus: »[M]ein Leib und mein Wille sind Eines; – oder was ich als anschauliche Vorstellung meinen Leib nenne, nenne ich, sofern ich desselben auf eine ganz verschiedene, keiner andern zu vergleichenden Weise mir bewußt bin, meinen Willen; – oder, mein Leib ist die Objektität meines Willens; – oder, abgesehn davon, daß mein Leib meine Vorstellung ist, ist er nur noch mein Wille« (W I 146). Damit faßt Schopenhauer den Leib als Erscheinung von etwas von ihm Verschiedenem und dieses wiederum als den Willen auf. Ist es durchaus nachvollziehbar, daß der Leib nicht nur vorgestellt wird, sondern auch an sich selbst existiert, so erscheint eine Gleichsetzung von Ding an sich und Wille durchaus problematisch. Schopenhauer setzt zum einen voraus, daß es ein von der Vorstellung verschiedenes Ding an sich gibt, und zum anderen, daß sich die Wirklichkeit im Willen und in der Vorstellung erschöpft: »Außer dem Willen und der Vorstellung ist uns gar nichts bekannt, noch denkbar.« (W I 149) Träfe dies zu, so wäre das Ding an sich, da es keine Vorstellung wäre, tatsächlich mit dem Willen identisch. Freilich scheitert das Argument daran, daß es sehr wohl denkbar ist, daß es neben den Vorstellungen und dem Willen noch etwas anderes – nämlich vorstellungsunabhängige raum-zeitliche Gegenstände – gibt. Schopenhauer gelingt es offenbar nicht, die Identität des Leibes mit dem Willen als Ding an sich einsichtig zu machen.
Das gilt auch für den zweiten Anlauf, den er in diesem Zusammenhang nimmt. Schopenhauer ist davon überzeugt, daß die Aktionen des Leibes Erscheinungen von Willensakten sind. Daraus ergibt sich für ihn, daß auch der Leib selbst eine Erscheinung des Willens ist: »Ist nun jede Aktion meines Leibes Erscheinung eines Willensaktes, in welchem sich, unter gegebenen Motiven, mein Wille selbst überhaupt und im Ganzen, also mein Charakter, wieder ausspricht; so muß auch die unumgängliche Bedingung und Voraussetzung jener Aktion Erscheinung des Willens seyn: denn sein Erscheinen kann nicht von etwas abhängen, das nicht unmittelbar und allein durch ihn, das mithin für ihn nur zufällig wäre, wodurch sein Erscheinen selbst nur zufällig würde: jene Bedingung aber ist der ganze Leib selbst. Dieser selbst also muß schon Erscheinung des Willens seyn« (W I 151). Man darf sich nicht davon irritieren lassen, daß Schopenhauer im folgenden den Willen mit dem intelligiblen Charakter gleichsetzt, denn dieser gilt ihm letztlich als Objektivation des Willens als Ding an sich, so daß – unter dieser Voraussetzung – der Leib sowohl Erscheinung des intelligiblen Charakters wie auch des Willens als eines Dinges an sich wäre. Freilich läßt sich nicht ohne weiteres nachvollziehen, daß der Leib, um Erscheinungen von Willensakten zu ermöglichen, selbst eine Erscheinung des Willens sein muß.
Was aber sein Vorgehen anbelangt, mit dem er von den – sei es bewußten oder unbewußten – Willensakten zum Individualwillen als empirischer Disposition und von diesem zum Willen als Ding an sich gelangt, so ist festzuhalten, daß sich Schopenhauer – trotz mancher anderslautender Beteuerungen – nur bei den bewußten Regungen des Willens, nicht aber bei den unbewußten sowie beim Willen als Disposition oder gar als Ding an sich auf anschaulich Gegebenes stützt. Um über dieses hinauszugehen, deutet er dieses mit Hilfe von Begriffen oder – wie er gelegentlich formuliert – einer »Reflexion« (W I 154 sowie W II 325 u. 338), die man ohne weiteres hermeneutisch nennen könnte.
Schopenhauer versucht, die Frage nach dem Ding an sich nicht allein hinsichtlich des Individuums, sondern auch hinsichtlich der empirischen Wirklichkeit insgesamt zu beantworten. Dabei bedient er sich erneut der inneren sowie der äußeren Erfahrung, die er in einer Reihe interpretatorischer Schritte in Richtung auf den Willen als »Kern und Wesen jener […] Welt« (W I 470) hinter sich zurückläßt. Da sich der Wille als Ding an sich nicht etwa der Anschauung darbietet, sondern allenfalls erdeutet wird, erscheint es angemessen, in diesem Zusammenhang von einer Hermeneutik des Weltwillens zu sprechen.26
Es fällt auf, daß Schopenhauer die – bereits erläuterte – These der Identität des Leibes mit dem Willen als »Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur« (W I 148) betrachtet. Damit setzt die Hermeneutik des Weltwillens die Hermeneutik des Individualwillens voraus. Entscheidend für die Interpretation der empirischen Wirklichkeit als Erscheinung des Willens als Ding an sich ist nun, daß Schopenhauer annimmt, die Welt erschöpfe sich in der Vorstellung und im Willen und das Ding an sich sei keine Vorstellung. Daraus ergibt sich für ihn: »Wenn wir der Körperwelt, welche unmittelbar nur in unserer Vorstellung dasteht, die größte uns bekannte Realität beilegen wollen; so geben wir ihr die Realität, welche für Jeden sein eigener Leib hat: denn der ist Jedem das Realste. Aber wenn wir nun die Realität dieses Leibes und seiner Aktionen analysiren, so treffen wir, außerdem daß er unsere Vorstellung ist, nichts darin an, als den Willen: damit ist selbst seine Realität erschöpft. Wir können daher eine anderweitige Realität, um sie der Körperwelt beizulegen, nirgends finden. Wenn also die Körperwelt noch etwas mehr seyn soll, als bloß unsere Vorstellung, so müssen wir sagen, daß sie außer der Vorstellung, also an sich und ihrem innersten Wesen nach, Das sei, was wir in uns selbst unmittelbar als Willen finden.« (W I 149)
Neben diesem Argument verwendet Schopenhauer noch ein anderes, das einem Analogieschluß gleichkommt. So erklärt er, er wolle alle Objekte »nach Analogie jenes Leibes beurtheilen und daher annehmen, daß, wie sie einerseits, ganz so wie er, Vorstellung und darin mit ihm gleichartig sind, auch andererseits, wenn man ihr Daseyn als Vorstellung des Subjekts bei Seite setzt, das dann noch übrig Bleibende, seinem innern Wesen nach, das selbe seyn muß, als was wir an uns Wille nennen« (W I 148 f.).
Während das erste Argument daran krankt, daß die ontologische Voraussetzung, die Welt bestehe aus nichts anderem als dem Willen und der Vorstellung, problematisch erscheint, besteht die Schwäche des zweiten darin, daß Analogieschlüsse kein formal korrektes Verfahren des Folgerns darstellen. Daraus, daß eine Entität eine finite Menge von Eigenschaften sowie eine zusätzliche Eigenschaft besitzt, ergibt sich keineswegs, daß eine andere Entität mit derselben finiten Menge von Eigenschaften dieselbe zusätzliche Eigenschaft besitzt.27 Angesichts dieser Schwierigkeiten könnte man sich darauf zurückziehen, daß es Schopenhauer weniger um einen logisch zwingenden Schluß als vielmehr darum geht, im Ausgang von der Selbsterfahrung des Subjekts eine bloße – mehr oder weniger plausible – Deutung der äußeren Wirklichkeit zu präsentieren. Zugunsten dieses Vorschlags könnte man die folgende Stelle aus dem Handschriftlichen Nachlaß anführen: »Aus dir sollst du die Natur verstehn, nicht dich aus der Natur. Das ist mein revolutionäres Princip.« (HN I 421)
Obgleich es nicht angeht, die These, das Ding an sich sei der Wille, im Zuge eines Analogieschlusses auf die gesamte äußere Wirklichkeit zu übertragen, weist diese eine Reihe von Eigenschaften auf, die Schopenhauer in seinem Vorgehen bestärkt haben mögen. Es handelt sich darum, daß es in der Natur finales und teleologisches Verhalten gibt, das seinerseits mit Kräften zu tun hat. Schopenhauer teilt dieses Verhalten in solches ein, das durch Ursachen, Reize oder Motive bedingt ist. Während es im letzteren Fall keine Schwierigkeiten bereitet, eine Beziehung zum Willen herzustellen, ist es in den beiden ersteren weniger einfach. Schopenhauer legt zunächst dar, daß die Instinkte und Kunsttriebe der Tiere einerseits zweckmäßig seien, anderseits von der Erkenntnis nur begleitet, nicht aber geleitet würden. Der Wille befinde sich dort »in blinder Thätigkeit« (W I 160). Dies gelte für manche Funktionen des menschlichen Körpers ebenfalls: »Auch in uns wirkt der selbe Wille vielfach blind: in allen den Funktionen unsers Leibes, welche keine Erkenntniß leitet, in allen seinen vitalen und vegetativen Processen, Verdauung, Blutumlauf, Sekretion, Wachsthum, Reproduktion.« (W I 160) In einem weiteren Schritt legt Schopenhauer dar, daß die Pflanzen – anders als Mensch und Tier – lediglich für Reize empfänglich seien, aber dennoch Kräfte sowie eine gewisse Zweckmäßigkeit erkennen ließen und deshalb vom Willen bestimmt seien: »Wir werden also was für die Vorstellung als Pflanze, als bloße Vegetation, blind treibende Kraft erscheint, seinem Wesen an sich nach, für Willen ansprechen und für eben Das erkennen, was die Basis unserer eigenen Erscheinung ausmacht« (W I 163). Schopenhauer gibt sich aber keineswegs mit der Beobachtung zufrieden, daß das Verhalten von Lebewesen zweckmäßig ist, sondern er behauptet das auch von ihrem Körperbau, den er dann ebenfalls als Ausdruck des Willens deutet: »Hierauf beruht die vollkommene Angemessenheit des menschlichen und thierischen Leibes zum menschlichen und thierischen Willen überhaupt, derjenigen ähnlich, aber sie weit übertreffend, die ein absichtlich verfertigtes Werkzeug zum Willen des Verfertigers hat, und dieserhalb erscheinend als Zweckmäßigkeit, d. i. die teleologische Erklärbarkeit des Leibes.« (W I 152 f.) Was schließlich die – von Ursachen beherrschte – unbelebte Natur anbelangt, so räumt Schopenhauer zwar ein, daß »die Endursachen gänzlich zurücktreten« (W II 394), doch betont er, daß auch dort Kräfte in Richtung auf bestimmte Ziele wirken, und deutet sie als Ausdruck des Willens: »Wenn wir [die Welt] nun mit forschendem Blicke betrachten, wenn wir den gewaltigen, unaufhaltsamen Drang sehn, mit dem die Gewässer der Tiefe zueilen, die Beharrlichkeit, mit welcher der Magnet sich immer wieder zum Nordpol wendet, die Sehnsucht, mit der das Eisen zu ihm fliegt, die Heftigkeit, mit welcher die Pole der Elektricität zur Wiedervereinigung streben […] – so wird es uns keine große Anstrengung der Einbildungskraft kosten, selbst aus so großer Entfernung unser eigenes Wesen wiederzuerkennen, jenes Nämliche, das in uns beim Lichte der Erkenntniß seine Zwecke verfolgt, hier aber, in den schwächsten seiner Erscheinungen, nur blind, dumpf, einseitig und unveränderlich strebt, jedoch, weil es überall Eines und das Selbe ist […] – auch hier wie dort den Namen Wille führen muß, welcher Das bezeichnet, was das Seyn an sich jedes Dinges in der Welt und der alleinige Kern jeder Erscheinung ist.« (W I 163 f.)
Schopenhauer ist sich darüber im klaren, daß er, indem er den Begriff des Willens nicht nur in Hinblick auf das Individuum, sondern auf die empirische Wirklichkeit insgesamt gebraucht, eine beträchtliche »Ausdehnung« oder »Erweiterung« (W I 155 f.) desselben vornimmt. In diesem Zusammenhang nimmt er an, daß der Wille in verschiedenen »Abstufungen« und »Grade[n]« (W I 149, 155 u. 173) erscheint. So heißt es, die Äußerungen des Willens brauchten weder von Erkenntnis begleitet (vgl. W I 149, 156 u. 159 ff.) noch durch Motive bestimmt zu werden (ebd.), ja sie müßten nicht einmal bewußt sein (vgl. N 279). Nun könnte man aber fragen, warum Schopenhauer nicht einen neutraleren Ausdruck wie z. B. »Kraft« oder »Energie« wählt. Genau dies lehnt er mit dem Argument ab, allein der Wille sei dem Menschen – aus seinem Inneren – vertraut und ermögliche dadurch einen größeren Erkenntnisgewinn: »Führen wir daher den Begriff der Kraft auf den des Willens zurück, so haben wir in der That ein Unbekannteres auf ein unendlich Bekannteres, ja auf das einzige uns wirklich unmittelbar und ganz und gar Bekannte zurückgeführt und unsere Erkenntniß um ein sehr großes erweitert.« (W I 157) Daß damit der Vorwurf des Anthropomorphismus droht, stört Schopenhauer nicht weiter. So bekennt er: »Ich habe […] die Welt als Makranthropos nachgewiesen; sofern Wille und Vorstellung ihr wie sein [des Menschen] Wesen erschöpft.« (W II 753)
Obgleich sich Schopenhauer dessen bewußt ist, daß der Wille als Ding an sich nicht adäquat erkannt werden kann, schreibt er ihm bestimmte Eigenschaften zu. Dabei läßt er sich von der Annahme leiten, daß der Wille – im Verhältnis zur Vorstellung – »ein von dieser toto genere Verschiedenes [ist]« (W I 146). Unter dieser Voraussetzung kann Schopenhauer dem Willen genau die Eigenschaften absprechen, die für die Vorstellung konstitutiv sind: »Der Wille als Ding an sich ist von seiner Erscheinung gänzlich verschieden und völlig frei von allen Formen derselben […], die daher nur seine Objektität betreffen, ihm selbst fremd sind.« (W I 157) So falle der Wille weder unter die Anschauungsformen von Raum und Zeit noch unter den Satz vom zureichenden Grunde (vgl. W I 157 f.). Angesichts der Tatsache, daß – nach Schopenhauer – Raum und Zeit »Vielheit« und »Wechsel« (W I 205) ermöglichen, überrascht es nicht, daß er diese dem Willen als Ding an sich vorenthält und statt dessen erklärt, dieser zeichne sich vielmehr durch »Einheit« und »Identität« (W I 165, 205 f. u. 213) aus. Entzieht sich der Wille als Ding an sich überdies dem Satz vom zureichenden Grunde, so ist er »grundlos« (W I 150 u. 158) und steht damit außerhalb des Kausalitätsprinzips. Dies aber bedeutet darüber hinaus, daß der Wille als Ding an sich frei ist: »Daß der Wille als solcher frei sei, folgt schon daraus, daß er, nach unserer Ansicht, das Ding an sich […] ist.« (W I 361) Da überdies die Erkenntnis an den Bereich der Vorstellung gebunden ist, läßt sich nachvollziehen, daß Schopenhauer den Willen als »bewußtlos« (W II 234), »erkenntnißlos« (W II 546 u. P II 55) oder gar »blind[]« (W I 201 u. 234) charakterisiert.
Darüber hinaus beschreitet Schopenhauer noch einen anderen Weg, um den Willen mit Eigenschaften auszustatten. Es handelt sich darum, daß er im Zuge einer Interpretation der empirischen Wirklichkeit bestimmtes darin auftretendes Verhalten als Ausdruck von Dispositionen deutet, die er mit dem Willen in Verbindung bringt. Freilich wird dabei nicht immer klar, ob er den Willen als Disposition oder Träger einer solchen auffaßt und ob diese empirisch oder metaphysisch ist. Von dieser Unschärfe sind auch die zuletzt angeführten Eigenschaften betroffen. Schopenhauer schreibt sie einem als »Drang« oder »Trieb« charakterisierten Willen zu. So stellt er fest: »Allein bei genauerer Betrachtung werden wir auch hier finden, daß [der Wille] vielmehr ein blinder Drang, ein völlig grundloser, unmotivirter Trieb ist.« (W II 418) Dieser besitzt, wie Schopenhauer darlegt, kein letztes Ziel, sondern sei eine »Bewegung« oder ein »Streben vorwärts in den unendlichen Raum, ohne Rast und Ziel« (W I 199; vgl. a. W I 217 u. 386). Angesichts der Tatsache, daß sich – laut Schopenhauer – das Leben als die höchste Stufe der Objektivationen des Willens darbietet, beschreibt er diesen gelegentlich als »Willen zum Leben«: »[D]a was der Wille will immer das Leben ist, eben weil dasselbe nichts weiter, als die Darstellung jenes Wollens für die Vorstellung ist; so ist es einerlei und nur ein Pleonasmus, wenn wir statt schlechthin zu sagen, ›der Wille‹, sagen ›der Wille zum Leben‹.« (W I 347; vgl. a. W II 410 u. 419) Mit dieser Wendung distanziert sich Schopenhauer entschieden von der Tradition der abendländischen Metaphysik des Geistes. In diesem Sinne bekennt er, daß er »das nicht weiter Erklärliche, sondern jeder Erklärung zum Grunde zu Legende, den Willen zum Leben gesetzt habe, und daß dieser, weit entfernt, wie das Absolutum, das Unendliche, die Idee und ähnliche Ausdrücke mehr, ein leerer Wortschall zu seyn, das Allerrealste ist, was wir kennen, ja, der Kern der Realität selbst.« (W II 411)
Schopenhauer begnügt sich nicht damit, das Ding an sich als Willen zu deuten, sondern macht sich diese Einsicht zunutze, um die empirische Wirklichkeit bzw. die Welt als Vorstellung als Objektivation desselben zu verstehen. Dabei schiebt er zwischen Wille und Vorstellung eine zusätzliche Instanz ein: »Das einzelne, in Gemäßheit des Satzes vom Grunde erscheinende Ding ist also nur eine mittelbare Objektivation des Dinges an sich (welches der Wille ist), zwischen welchem und ihm noch die Idee steht, als die alleinige unmittelbare Objektität des Willens« (W I 228). Im Verhältnis zum Ding an sich bieten sich die Ideen als – angeblich zeitlose – »Akte« (W I 208 f. u. 211) dar, im Verhältnis zur Vorstellung hingegen als die verschiedenen »Grade« oder »Stufen« (W I 177 u. 182 f.), in denen der Wille erscheint. Als solche nennt Schopenhauer die als qualitates occultae auftretenden Naturkräfte (vgl. W I 171 ff., 178 f.), den artspezifischen Charakter der Pflanzen und Tiere sowie den individuellen Charakter der Menschen, wobei er die Ideen nicht mit dem empirischen, sondern dem intelligiblen Charakter gleichsetzt (vgl. W I 187, 208 u. 211). Wie Schopenhauer betont, liegt ein Gegensatz zwischen den »verschiedenen Ideen« auf der einen und dem »einen Willen[]« (W I 212) auf der anderen Seite vor. Mehr noch, die Ideen zeichneten sich nicht allein durch ihre Diversität aus, sondern stünden »unter einander in Konflikt« (W I 195). Schopenhauer deutet diesen »Streit« (W I 196) als eine »dem Willen wesentliche Entzweiung mit sich selbst« (W I 197; vgl. a. W I 318 u. 387), die er freilich nicht in einem geschichtsphilosophischen oder -theologischen Telos zur Aufhebung bringt, sondern bestehen bleiben läßt. So erklärt er: »In der That gehört Abwesenheit alles Zieles, aller Gränzen, zum Wesen des Willens an sich, der ein endloses Streben ist.« (W I 217)
Angesichts der Tatsache, daß Schopenhauer den Willen als »Wille[n] zum Leben« (W I 347) interpretiert, erstaunt es nicht weiter, daß er die belebte Natur als eine auf den Zweck des Lebens ausgerichtete charakterisiert. Nach seiner Auffassung zeigt sich das sowohl an der organischen Ausstattung der Lebewesen als auch an ihrem Verhalten. Nicht zuletzt gelte das für die Erkenntnis, die auf ebendiesen Zweck ausgerichtet sei: »Die Erkenntniß […] geht also ursprünglich aus dem Willen selbst hervor, gehört zum Wesen der höhern Stufen seiner Objektivation, als eine bloße μηχανη, ein Mittel zur Erhaltung des Individuums und der Art, so gut wie jedes Organ des Leibes.« (W I 204)
Daher überrascht es auch nicht, daß Schopenhauer – insbesondere im Kapitel 19 des zweiten Bandes von Die Welt als Wille und Vorstellung – darauf insistiert, daß der Wille im Verhältnis zur Erkenntnis den Primat innehat. Erblickt man in der Erkenntnis ein Phänomen, in dem sich der Wille manifestiert bzw. dem er zugrunde liegt, so kann man – mit Schopenhauer – dann, wenn die Erkenntnis den Willen selbst zum Gegenstand hat, geradezu von einer Erkenntnis des Willens durch den Willen bzw. von einer »Selbsterkenntniß« (W I 218, 238, 362 u. 506 sowie W II 754) des Willens sprechen. Daß sich der Wille tatsächlich selbst erkennt, gilt nun Schopenhauer als der »eine[] und einzige[] Gedanke[]« (W I 360), in dem seine Philosophie kulminiert: »Meine ganze Ph[ilosophie] läßt sich zusammenfassen in dem einen Ausdruck: die Welt ist die Selbsterkenntniß des Willens.« (HN I 462)
Auch wenn sich Schopenhauer in seiner Metaphysik der Natur weder auf bloße Begriffe noch gar auf eine intellektuelle Anschauung beruft, sondern in einer Reihe interpretatorischer Schritte von der empirischen Wirklichkeit zum Willen als dem Ding an sich voranschreitet, erhebt sich die Frage, ob sein Vorgehen sowie die Resultate, die es liefert, tatsächlich überzeugen. Dazu ist zunächst festzustellen, daß es durchaus legitim erscheint, bestimmte affektive und volitionale Regungen von Lebewesen auf eine entsprechende Disposition zurückzuführen, und ähnliches gilt sicher auch für den Vorschlag, den Leib mit seinen Funktionen als Ausdruck eines Willens zum Leben zu betrachten, der bald bewußt, bald unbewußt wirken mag. Freilich wird man in diesen Fällen – sowie bei allem, was Schopenhauer zur Zweckmäßigkeit in der belebten Natur ausführt – keineswegs zwingend zu einer stärkeren Annahme als zu jener einer empirischen Disposition gelangen, die man als Willen oder Willen zum Leben bezeichnen mag. Was hingegen die unbelebte Natur anbelangt, so scheint es keineswegs klar zu sein, ob sie durchgängig zweckmäßig ist und welchen Status die Kräfte besitzen, die Schopenhauer darin anzutreffen glaubt. Selbst unter der Voraussetzung, daß sich in beiderlei Hinsicht eine befriedigende Antwort finden ließe, spräche kaum etwas dafür, über die Annahme einer empirischen Disposition hinauszugehen.
Dies ist allerdings nicht der Weg, den Schopenhauer beschreitet, indem er von empirischen Dispositionen bzw. dem empirischen Charakter zu intelligiblen Dispositionen bzw. zum intelligiblen Charakter der Dinge gelangt und den Bereich des Intelligiblen mit den Ideen identifiziert, die er wiederum als Objektivationen des Willens als eines Dinges an sich hinstellt. Der damit vollzogene Übergang von der empirischen zur intelligiblen bzw. metaphysischen Wirklichkeit erscheint in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zunächst leuchtet nicht ein, wie das Ding an sich – als Ding – mit einer Disposition, dem Willen, in eins fallen soll. Die Fähigkeit, etwas zu wollen bzw. sich teleologisch oder final zu verhalten, ist nichts, was an sich selbst bestünde, sondern tritt vielmehr an – sei es belebten oder unbelebten – Dingen auf. Man könnte allenfalls sagen, das Ding an sich sei ein wollendes. Dies aber erscheint insofern bedenklich, als Schopenhauer dem Ding an sich die Zeitlichkeit abspricht und kaum verständlich ist, daß ein nicht-zeitliches Ding etwas will oder daß es eine nicht-zeitliche Disposition gibt, etwas zu wollen. Nicht minder schwierig ist vor diesem Hintergrund die von Schopenhauer vertretene These, der Wille als Ding an sich sei ein »Agens« oder ein »Thätiges« (N 220 u. 288).
Es scheint, als sei Schopenhauer in folgende Aporie geraten: Einerseits betrachtet er das Ding an sich als von der Vorstellung toto genere verschieden, so daß er – streng genommen – nichts darüber aussagen dürfte; anderseits versucht er, angetrieben vom metaphysischen Bedürfnis, sich dennoch darüber zu äußern, und ist dabei auf eine Sprache angewiesen, die allenfalls der empirischen, nicht aber der metaphysischen Wirklichkeit angemessen ist. Daß er sich bei alledem einer hermeneutischen Methode bedient, ändert wenig an den Widersprüchen, in die er gerät, zeugt aber nichtsdestoweniger von einem höheren Maße an intellektueller Redlichkeit als der Rekurs auf bloße Begriffe oder gar die intellektuelle Anschauung, wie er im spekulativen Idealismus eines Fichte, Schelling oder Hegel anzutreffen ist. So muß Schopenhauer trotz seines Versuchs, den Willen als Ding an sich zu erdeuten und ihm auf diese Weise kognitiv gerecht zu werden, letzten Endes einräumen: »Ein ›Erkennen der Dinge an sich‹, im strengsten Sinne des Worts, wäre demnach schon darum unmöglich, weil wo das Wesen an sich der Dinge anfängt, das Erkennen wegfällt, und alle Erkenntniß schon grundwesentlich bloß auf Erscheinungen geht.« (W II 322)
Es kann resümiert werden, daß sich Schopenhauer insofern einer hermeneutischen Methode bedient, als er in seiner Metaphysik des Willens den Versuch unternimmt, im Zuge einer Interpretation der Welt als Vorstellung deren »Bedeutung« zu ergründen und sie mit dem Willen als dem Ding an sich gleichzusetzen. Stellt man in Rechnung, daß er diesen als blinde, irrationale Kraft betrachtet, welche dem Menschen, ohne ihm bewußt zu sein, voraus liegt und ihn eher beherrscht, als daß er sie beherrschen würde, so könnte man sagen, daß seine Hermeneutik des Willens jener Art des entlarvenden Denkens ähnelt, wie es z. B. bei Marx, Nietzsche und Freud auftritt.