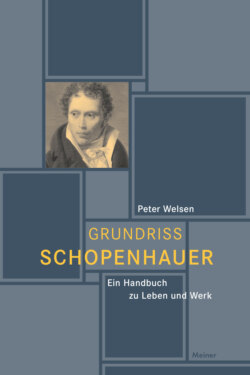Читать книгу Grundriss Schopenhauer - Peter Welsen - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Biographische Skizze
ОглавлениеArthur Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 als erstes Kind des wohlhabenden Kaufmanns Heinrich Floris Schopenhauer (1747–1805) und seiner Frau Johanna (1766–1838) in Danzig geboren. Die Familie zählte zu den angesehensten und wohlhabendsten der Stadt. Die Ehe der Eltern war wenig glücklich, und so erstaunt es nicht, daß die Mutter – ähnlich wie auch der Vater – ihrem Sohn kein Gefühl der Liebe und Geborgenheit vermitteln konnte. Als die – bis dahin freie – Stadt 1793 von Preußen annektiert wurde, verließ Heinrich Floris Schopenhauer diese, da er als überzeugter Republikaner nicht preußischer Untertan sein wollte, verkaufte sein Geschäft und zog mit seiner Familie nach Hamburg. Dort wurde er wieder erfolgreich als Kaufmann tätig. 1797 wurde Adele, die Schwester des Philosophen, geboren, die bis 1849 leben sollte.
Nach dem Wunsch seines Vaters sollte Arthur Schopenhauer auf den Kaufmannsberuf vorbereitet werden, für den nicht zuletzt gründliche Kenntnisse der englischen und französischen Sprache erforderlich waren. Daher wurde er von 1797 bis 1799 nach Le Havre geschickt, wo er in der Familie eines Geschäftsfreundes lebte und sich das Französische so gut aneignete, daß seine Deutschkenntnisse zeitweise darunter litten. Nach seiner Rückkehr nach Hamburg verbrachte er vier Jahre an einer privaten Lehranstalt, dem Rungeschen Institut, um auf den künftigen Beruf vorbereitet zu werden. Wie er selbst feststellt, lernte er dort, »was einem Kaufmanne von Nutzen ist und dem Gebildeten wohl ansteht« (GBr 649). Freilich merkte Schopenhauer bald, daß er wenig Neigung zum vorgesehenen Beruf verspürte, sondern sich eher zur Gelehrtenlaufbahn hingezogen fühlte.
Angesichts dieser Situation konfrontierte ihn sein Vater mit der Alternative, entweder ins Gymnasium einzutreten, um dann zu studieren, oder mit den Eltern eine ausgedehnte Bildungsreise durch Europa zu unternehmen und anschließend eine kaufmännische Lehre zu beginnen. Schopenhauer konnte der Verlokkung solch einer Reise nicht widerstehen. Die Familie brach im Frühjahr 1803 auf und begab sich zunächst über die Niederlande nach England. Während seine Eltern nach Schottland weiterreisten, verbrachte Arthur Schopenhauer mehrere Monate in einem Internat in Wimbledon, um die englische Sprache zu erlernen. Darauf besuchte er mit seinen Eltern mehrere französische Städte wie Paris, Bordeaux, Toulouse und Marseille. Auf einem Ausflug nach Toulon machte Schopenhauer eine folgenreiche Erfahrung: Er erlebte im dortigen Arsenal das Elend der angeketteten Galeerensklaven und war darüber zutiefst erschüttert: »In meinem 17ten Jahre ohne alle gelehrte Schulbildung, wurde ich vom Jammer des Lebens so ergriffen, wie Buddha in seiner Jugend, als er Krankheit, Alter, Schmerz und Tod erblickte. […] [M]ein Resultat war, daß diese Welt kein Werk eines allgütigen Wesens seyn könnte, wohl aber das eines Teufels, der Geschöpfe ins Daseyn gerufen, um am Anblick ihrer Quaal sich zu weiden« (HN IV/1 96). Ähnlich intensiv wirkten auf den angehenden Philosophen die Schweizer Alpen in ihrer Erhabenheit, nicht zuletzt der Pilatus, den er im Zuge der Fortsetzung seiner Reise bestieg, die ihn schließlich über Österreich und Böhmen im Sommer 1804 nach Deutschland zurückführte.
Gemäß der mit dem Vater getroffenen Vereinbarung nahm Schopenhauer widerwillig seine kaufmännische Ausbildung auf, zunächst bei Kabrun in Danzig, wenig später bei Jenisch in Hamburg. Offen bekannte er: »Nie aber hat es einen schlechteren Handlungsbeflissenen gegeben als mich.« (GBr 651) Im Winter 1804/05 verschlechterte sich der körperliche und seelische Zustand von Heinrich Floris Schopenhauer zusehends, am 20. April 1805 wurde seine Leiche im Fleet hinter seinem Haus gefunden. Wahrscheinlich hatte er sich vom Fenster des Speichers herabgestürzt.
Im darauffolgenden Jahr verließen Adele und Johanna Schopenhauer Hamburg und zogen nach Weimar um. Dort führte Johanna einen literarischen Salon, in dem unter anderem Goethe und Wieland verkehrten, und begann darüber hinaus eine überaus erfolgreiche schriftstellerische Karriere. 1807 brach Schopenhauer seine Ausbildung ab, um sich zunächst in Gotha und ab Ende des Jahres in Weimar durch das Erlernen der alten Sprachen auf ein Universitätsstudium vorzubereiten, das er 1809 nach Auszahlung seines Erbes in Göttingen aufnahm. Anfänglich schrieb er sich für Medizin, ab dem Wintersemester 1810/11 aber für Philosophie ein. Das hinderte ihn allerdings nicht, weiterhin naturwissenschaftliche Vorlesungen zu besuchen. Auf Anregung von Gottlob Ernst Schulze, seines wichtigsten philosophischen Lehrers, der nicht zuletzt durch seine skeptische Kritik an Kant hervorgetreten war, widmete sich Schopenhauer insbesondere der Lektüre Platons und Kants, die zeit seines Lebens die für ihn bedeutendsten Philosophen bleiben sollten. Bei einem Besuch in Weimar riet ihm Wieland von der Philosophie ab. Schopenhauer entgegnete: »Das Leben ist eine mißliche Sache, ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken.« (Gespr 22) Daraufhin änderte Wieland seine Einschätzung und empfahl ihm, doch bei der Philosophie zu bleiben.
1811 wechselte Schopenhauer an die neugegründete »Universität zu Berlin«, nicht zuletzt, um den auf dem Höhepunkt seines Ruhmes stehenden Johann Gottlieb Fichte zu hören, von dessen Vorlesungen (»Thatsachen des Bewußtseins« im Wintersemester 1811/12, »Wissenschaftslehre« im Sommersemester 1812) er jedoch so wenig angetan war, daß er sie immer wieder bissig kommentierte. Ferner nahm Schopenhauer an Vorlesungen der Philologen Boeckh und Wolf sowie von F. D. E. Schleiermacher teil. Dazu kamen gelegentliche Besuche an der Charité, an welcher der junge Philosoph zwei psychisch kranken Patienten regelmäßig Besuche abstattete, auf die seine späteren Überlegungen zum »Wahnsinn« aufbauen konnten. Insgesamt fühlte sich Schopenhauer in Berlin eher nur mäßig wohl. Davon zeugt, daß er die Stadt als »physisch und moralisch ein vermaledeites Nest« (GBr 338) beschrieb. Nichtsdestoweniger waren seine Überlegungen, die einige Jahre später in Die Welt als Wille und Vorstellung eine feste Gestalt annehmen sollten, so weit gediehen, daß er gegen Ende seines Aufenthaltes notieren konnte: »Unter meinen Händen und vielmehr in meinem Geiste erwächst ein Werk, eine Philosophie, die Ethik und Metaphysik in Einem sein soll […]. Das Werk wächst, concrescirt allmählig und langsam wie das Kind im Mutterleibe« (HN I 55). Aufgrund der unsicheren militärischen Situation – nach der Schlacht von Lützen fühlte man sich in Berlin durch die napoleonischen Truppen bedroht – verließ Schopenhauer die Stadt im Mai 1813 in Richtung Weimar. Von dort zog er sich, um seine Dissertation zum Abschluß zu bringen, nach Rudolstadt zurück. Er reichte die Arbeit (Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde), in der er die erkenntnistheoretischen Grundlagen seines Ansatzes darlegt, an der Universität Jena ein und wurde dort im Oktober desselben Jahres in absentia mit der Note magna cum laude promoviert.
In die Zeit, die Schopenhauer anschließend in Weimar verbrachte, fielen zwei wichtige Ereignisse: der Bruch mit der Mutter, der durch den Einzug des Freundes Müller von Gerstenbergk in deren Haus begünstigt wurde, sowie eine Reihe intensiver Begegnungen mit Goethe, in deren Mittelpunkt die Diskussion der Farbenlehre stand. Zwar waren sich beide Denker in der Ablehnung von Newtons einschlägiger Theorie einig, doch Schopenhauer betonte den subjektiven Aspekt der Wahrnehmung der Farben stärker als Goethe und versuchte, diesen von der Überlegenheit seines eigenen Ansatzes mit einiger Vehemenz zu überzeugen. Freilich ließ sich Goethe nicht belehren und brach den Austausch im Frühjahr 1814 ab. Er drückte seine Erfahrung mit dem jungen Philosophen wie folgt aus: »Trüge gern noch länger des Lehrers Bürden, wenn Schüler nur nicht gleich Lehrer würden.«1 Wenig später – im Jahr 1816 – veröffentlichte Schopenhauer seine Theorie unter dem Titel Ueber das Sehn und die Farben. Ebenfalls während des Aufenthalts in Weimar wurde er vom Orientalisten Majer erstmals auf die indische Philosophie – in Gestalt einer von Anquetil-Duperron angefertigten französischen Übersetzung einer persischen Übersetzung einer Auswahl von Texten aus den Upanischaden, die 1801/02 unter dem Titel Oupnekhat erschienen war – aufmerksam gemacht, die ähnlich großen Einfluß wie Platon und Kant auf ihn ausüben sollte: »Ich gestehe übrigens daß ich nicht glaube daß meine Lehre je hätte entstehn können, ehe die Upanischaden, Plato und Kant ihre Strahlen zugleich in des Menschen Geist werfen konnten.« (HN I 422)
Im Mai 1814 zog Schopenhauer nach Dresden um. Dort verbrachte er in den folgenden Jahren die vielleicht glücklichste, sicher aber die produktivste Zeit seines Lebens, in der es ihm gelang, seinen eigenen metaphysischen Ansatz zu elaborieren und zur Niederschrift zu bringen. Lag seine Erkenntnistheorie bereits mit der Dissertation vor, so entstanden nun die Metaphysik der Natur, die Ästhetik und die Ethik, in deren Zentrum die Lehre vom Willen als dem Ding an sich steht. In dem des Sanskrit mächtigen K. C. F. Krause, der später vor allem in Spanien und Lateinamerika rezipiert werden sollte, fand Schopenhauer einen Gesprächspartner, mit dem er sich über das indische Denken austauschen konnte. Das im Entstehen begriffene Werk enthält nach Auffassung des Autors einen einzigen Gedanken: »Meine ganze Ph[ilosophie] läßt sich zusammenfassen in dem einen Ausdruck: die Welt ist die Selbsterkenntniß des Willens.« (HN I 462) Im Dezember 1818 wurde der – auf 1819 – vordatierte Text unter dem Titel Die Welt als Wille und Vorstellung bei Brockhaus veröffentlicht.
Schon vorher war Schopenhauer zu einer Bildungsreise nach Italien aufgebrochen, die ihn unter anderem nach Venedig, Florenz, Rom und Neapel führen sollte. Als er sich im Juni 1819 in Mailand aufhielt, erreichte ihn die Nachricht von der Insolvenz des Danziger Bankiers Muhl, bei dem Mutter und Schwester ihr gesamtes Vermögen und er selbst ein Drittel des seinen angelegt hatten. Darauf kehrte er nach Deutschland zurück. Anders als seine Mutter und Schwester, die einen wenig günstigen Vergleich akzeptierten, gelang es ihm, sein Kapital vollständig zu erhalten. Als Schopenhauer es vom – inzwischen wieder zahlungsfähigen – Muhl einforderte, konstatierte er diesem gegenüber: »Sie sehn, daß man wohl ein Philosoph seyn kann, ohne deshalb ein Narr zu seyn.« (GBr 69)
Im gleichen Jahr faßte Schopenhauer den Entschluß, sich in Berlin zu habilitieren. Anläßlich der Probevorlesung im März 1820 kam es zu einem Disput mit Hegel, in dem Schopenhauer sachlich recht behielt. Freilich war seine Vorlesungstätigkeit nicht von Erfolg gekrönt. Da er seine Veranstaltung zur gleichen Zeit wie Hegel abhielt, der sich gerade auf dem Gipfel seines Ruhmes befand, stellten sich im ersten Semester seiner Privatdozentur nur wenige Hörer und danach gar keine mehr bei ihm ein, so daß die angekündigten Vorlesungen nicht mehr stattfanden. Dazu kam, daß Die Welt als Wille und Vorstellung nicht die erhoffte Aufmerksamkeit hervorrief. Das Werk verkaufte sich mäßig, und die spärlichen Rezensionen fielen eher negativ aus. Anerkennend äußerte sich lediglich Jean Paul Friedrich Richter, als er das Werk 1824 besprach.
Zum beruflichen Mißerfolg gesellten sich private Probleme. Schopenhauer hatte sich 1820 oder 1821 mit der Chorsängerin Caroline Richter liiert, die sich nach dem Vater ihres ersten Sohnes Medon nannte. Zwar hielt die Beziehung – mit Unterbrechungen – bis 1831, doch war sie von Krisen und Spannungen geprägt. So brachte Richter zehn Monate nach Schopenhauers Aufbruch zu einer zweiten Italienreise (1822–1823) einen Sohn zur Welt, der aus einer anderen Affäre hervorging und von Schopenhauer nicht akzeptiert wurde. Eine tatsächlich auf Schopenhauer zurückgehende Schwangerschaft Richters endete 1826 mit einer Fehlgeburt. Ein durch eine Begebenheit im Jahre 1821 ausgelöster Konflikt wirkte sich ebenfalls belastend aus. Schopenhauer hatte seine Nachbarin Caroline Marquet, die sich widerrechtlich im Vorraum seiner Wohnung aufhielt und sich weigerte, diesen zu verlassen, unter Einsatz physischer Kräfte zur Türe hinausbefördert. Dabei war sie zu Fall gekommen und hatte sich – nach eigener Aussage – mit bleibenden Folgen verletzt. Die von ihr angestrengte Klage führte nach einigem Hin und Her 1827 dazu, daß ihr Schopenhauer bis zu zum Lebensende ein Schmerzensgeld in Höhe von fünf Talern pro Monat entrichten mußte. Ihr Ableben (1841) kommentierte der Philosoph mit den Worten: »Obit anus, abit onus.«2
Auf der Rückreise aus Italien wurde Schopenhauer durch eine Krankheit gezwungen, ein Jahr – d. h. bis Mai 1824 – in München zu bleiben. Die von ihm beschriebenen Symptome deuten auf eine schwere, von psychosomatischen Beschwerden begleitete Depression hin. So notierte er: »Hämorrhoiden mit Fistel, Gicht, Nervenübel succedirten sich […]: dabei ist das rechte Ohr ganz taub.« (GBr 92) Den darauffolgenden Winter verbrachte Schopenhauer in Dresden. Er hatte vor, eine Reihe fremdsprachiger Texte (Bruno: De la causa, principio et uno, Hume: Dialogues Concerning Natural Religion und The Natural History of Religion sowie Sterne: Tristram Shandy) ins Deutsche zu übertragen, doch diese Pläne zerschlugen sich letztlich. Eine Begegnung mit Ludwig Tieck endete mit einem Streit, dessen Gegenstand die Religion war. Schopenhauer hatte sich über Tieck mit den Worten »Was? Sie brauchen einen Gott?« (Gespr 53) lustig gemacht.
Im Frühjahr 1825 traf der Philosoph wieder in Berlin ein und kündigte weiterhin, ohne ein Publikum für sich zu gewinnen, Vorlesungen an. Bemühungen, sich an anderen Universitäten (Würzburg, Heidelberg) zu etablieren, blieben ebenso erfolglos wie der Versuch, seine deutsche Übersetzung des Hand-Orakels von Baltasar Gracián bei Brockhaus zu veröffentlichen. Die einzige Übersetzung, die realisiert wurde und zur Publikation gelangte, war die seiner eigenen Abhandlung Ueber das Sehn und die Farben, die 1830 in lateinischer Sprache erschien. Begegnungen mit Alexander von Humboldt (1826) und Adelbert von Chamisso (um 1830) beeindruckten ihn wenig. Demgegenüber erwies sich die ebenfalls in dieses Jahrzehnt fallende Lektüre französischer Sensualisten wie Cabanis und Flourens insofern als nachhaltiger, als sie das Interesse des Philosophen – nach seinem Studium der Medizin – erneut auf anatomische und physiologische Fragestellungen lenkte und es verstärkte.3 Das sollte sich in späteren Publikationen wie Der Wille in der Natur (1836) und dem zweiten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung (1844) niederschlagen.
Während seines Aufenthalts in Berlin scheiterte Schopenhauer mit einem Heiratsantrag, den er einem deutlich jüngeren Mädchen, Flora Weiß, gemacht hatte. Als schließlich 1831 die Cholera an die Stadt heranrückte, brachte er sich in Sicherheit, indem er Berlin verließ und nach Frankfurt aufbrach, das als »cholerafest«4 galt. Damit endete auch die Beziehung zu Caroline Richter, die er gern mitgenommen hätte, aber eben nur unter der – für sie inakzeptablen – Bedingung, ihren Sohn in Berlin zurückzulassen.
Nach seiner Ankunft in Frankfurt verfiel Schopenhauer in eine düstere Stimmung, die ihn zwei Monate lang hinderte, sein Quartier zu verlassen. Zweifel darüber, ob er sich am richtigen Ort niedergelassen hatte, bewogen ihn, im Juli 1832 nach Mannheim umzuziehen, wo er bis Juli 1833 blieb, um wieder in das größere und weltoffenere Frankfurt zurückzukehren, das er – mit Ausnahme einiger kürzerer Ausflüge – bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen sollte. Daß er sich dort letztlich doch wohlfühlte, geht daraus hervor, daß er die Stadt in einem an seinen französischen Jugendfreund Anthime gerichteten Brief als »le meilleur endroit de l’Allemagne« (GBr 158) beschrieb. Dort war er bald als zurückgezogen lebender Sonderling bekannt, der regelmäßig nachmittags mit seinem Pudel spazieren ging und dabei Selbstgespräche führte. Seine spärlichen sozialen Kontakte pflegte er am Mittagstisch des »Englischen Hofs«, der als das führende Lokal der Stadt galt. Schopenhauer gestaltete – ähnlich wie schon Kant – seinen Tagesablauf nach einem rigiden Muster: Morgens arbeitete er drei Stunden an seinen Texten, anschließend spielte er eine Stunde auf seiner Flöte und nahm daraufhin sein Mittagessen ein, auf das ein ausgedehnter Spaziergang mit dem Pudel folgte. Abends zog er sich zurück und las, oder aber er ging ins Konzert, die Oper oder das Theater. Die Anerkennung seiner philosophischen Anstrengungen ließ weiterhin auf sich warten. Zwar trug sich Schopenhauer eine Zeitlang mit dem Gedanken, eine erweiterte Auflage seines Hauptwerks zu veröffentlichen, doch gelangte dieser Plan nicht zur Ausführung. Statt dessen verfaßte er eine eigenständige Abhandlung, die Ergänzungen und Erweiterungen zum zweiten Teil von Die Welt als Wille und Vorstellung enthielt und 1836 unter dem Titel Ueber den Willen in der Natur erschien. Das Werk fand zunächst – wie schon die vorherigen – keine nennenswerte Beachtung.
Erstmals erhielt Schopenhauer eine gewisse Anerkennung, als er 1837 den Professoren Schubert und Rosenkranz, die eine neue Ausgabe von Kants Werken vorbereiteten, den – von ihnen befolgten – Rat erteilte, die erste Auflage der Kritik der reinen Vernunft (1781) darin aufzunehmen, da sie die – im Vergleich zur zweiten – authentischere Gestalt des Buches sei. Die beiden Professoren zitierten in ihrem Vorwort ausgiebig aus dem Schreiben, in dem Schopenhauer seine Empfehlung ausgesprochen hatte. Auf diese Weise hatte sich dieser zumindest einen Namen als kompetenter Kenner der Kantischen Philosophie gemacht. In den Jahren 1837 und 1838 schrieben die Königlich Norwegische Societät der Wissenschaften und die Königlich Dänische Societät der Wissenschaften je eine Preisfrage zu wichtigen Problemen der praktischen Philosophie aus: zur Freiheit des menschlichen Willens sowie zur Grundlage der Moral. Schopenhauer nahm sich beider Themen an und verfaßte die Abhandlungen Ueber die Freiheit des menschlichen Willens sowie Ueber die Grundlage der Moral. Während die erste Preisschrift von der norwegischen Akademie gekrönt wurde, verweigerte die dänische Schopenhauer, der als einziger einen Text eingereicht hatte, den Preis, weil er angeblich das Thema verfehlt und sich abfällig über bedeutende zeitgenössische Denker geäußert habe. In der Tat hatte Schopenhauer für Fichte und Schelling wenig schmeichelhafte Worte gefunden und Hegel gar als »plumpe[n] geistlose[n] Charlatan« (E 187) verhöhnt. In seiner Replik auf das Urteil der dänischen Akademie bestritt Schopenhauer seinerseits energisch, daß es sich bei den Genannten um summi philosophi handle (vgl. E 17 ff.). Die beiden Abhandlungen erschienen 1841 unter dem Titel Die beiden Grundprobleme der Ethik. Ende der dreißiger und Anfang der vierziger Jahre traten mit Friedrich Dorguth (1776–1854) und Julius Frauenstädt (1813–1879) die beiden ersten Anhänger Schopenhauers in Erscheinung, die von diesem die Ehrentitel »Urevangelist« und »Erzevangelist« verliehen bekamen.
In den Folgejahren arbeitete Schopenhauer am zweiten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung, der im wesentlichen Ergänzungen und Erweiterungen zum ersten Band, oftmals in essayistischer Form, enthalten sollte. Eine ganze Reihe von Kapiteln war so konzipiert, daß sie als eigenständige Abhandlungen gelesen werden konnten, so z. B. die Kapitel 17 und 19 (»Ueber das metaphysische Bedürfnis des Menschen«, »Vom Primat des Willens im Selbstbewußtseyn«) sowie das berühmte, mit »Metaphysik der Geschlechtsliebe« überschriebene Kapitel 44. Das Buch erschien 1844 und rief wiederum nur geringe Resonanz hervor. Der Absatz ließ zu wünschen übrig, die Anzahl der Rezensionen blieb überschaubar. Die 1847 erschienene zweite Auflage der Abhandlung Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde war ähnlich erfolglos, sie verkaufte sich mäßig und wurde gar nicht rezensiert. Immerhin gewann Schopenhauer mit Johann August Becker (1803–1881) und Adam von Doß (1820–1873) zwei weitere Anhänger, die sich für sein Denken einsetzten.
Den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 brachte Schopenhauer keine Sympathie entgegen. Als überzeugter Befürworter der Monarchie verachtete er das sich erhebende, eine demokratische Staatsform anstrebende Volk als »Pack« und »souveräne Kanaille« (GBr 234). Mehr noch, er stellte österreichischen Soldaten, die sich anschickten, aus seiner Wohnung auf die Aufständischen zu schießen, sein Opernglas zur Verfügung, damit sie diese besser treffen konnten. Was den Philosophen vor allem beunruhigte, war die Vorstellung, er könne im Zuge der Revolution sein Vermögen verlieren. Es ist charakteristisch für seine politische Einstellung, daß er in seinem Testament den »Fonds zur Unterstützung der in den Aufruhr- und Empörungs-Kämpfen der Jahre 1848 & 1849 für die Aufrechterhaltung u. Herstellung der gesetzlichen Ordnung in Deutschland invalide gewordenen Preußischen Soldaten, wie auch der Hinterbliebenen solcher, die in jenen Kämpfen gefallen sind«5, als Universalerben einsetzte.
1850 beendete Schopenhauer die Arbeit an seinem letzten Werk, den Parerga und Paralipomena. Aufgrund der bescheidenen Verkaufszahlen der beiden Bände von Die Welt als Wille und Vorstellung lehnte es Brockhaus ab, das Buch zu veröffentlichen. Es erschien schließlich 1851 bei A. W. Hayn in Berlin. Wie schon im Titel anklingt, enthält es »Nebenwerke« und »Liegengelassenes«, also kleinere, oftmals in essayistischer Form abgefaßte Texte, die teils Ergänzungen des Hauptwerkes, teils eigenständige Untersuchungen zu verschiedenen – auch außerhalb der Philosophie angesiedelten Themen – darstellen. Besonders interessant darunter sind die »Aphorismen zur Lebensweisheit«, mit denen sich Schopenhauer in die Tradition der europäischen Moralistik einreiht, sowie der Dialog »Ueber Religion«, in dem er seine ambivalente Haltung gegenüber der Religion erläutert. Im Gegensatz zu den früheren Schriften richten sich die Parerga und Paralipomena weniger an ein akademisches als vielmehr an ein breiteres Publikum, das sie dann auch erreichten. Es erschienen mehrere Besprechungen des Buches, nicht zuletzt die umfangreiche Rezension von John Oxenford im Westminster and Foreign Quarterly Review (1852), welcher der Autor in der gleichen Zeitschrift ein Jahr später den – Schopenhauer rühmenden – Aufsatz »Iconoclasm in German Philosophy« folgen ließ. 1854 empfing Schopenhauer den Besuch von David Asher, der in der von Gutzkow herausgegebenen Zeitschrift Unterhaltungen am häuslichen Herd über sein Gespräch mit dem Philosophen berichtete. In diesem Jahr schickte ihm Wagner »aus Verehrung und Dankbarkeit« einen Privatdruck des Rings des Nibelungen und lud ihn zu sich nach Zürich ein. Freilich folgte Schopenhauer der Einladung nicht, denn er hatte wenig Gefallen an dem Werk gefunden. Er bescheinigte dem Komponisten allenfalls dichterisches Talent, nicht aber musikalisches und beendete seine Ausführungen mit den Worten: »Ich, Schopenhauer, bleibe Rossini und Mozart treu!« (Gespr 200) 1856 schrieb die Universität Leipzig eine Preisaufgabe über Schopenhauer aus, und 1857 fanden erstmals Vorlesungen über sein Denken an Universitäten statt. Ebenfalls in diesem Jahr stattete Friedrich Hebbel dem Philosophen einen Besuch ab. Angesichts der Tatsache, daß sich im letzten Lebensjahr der lange ersehnte Ruhm eingestellt hatte, konnte Schopenhauer konstatieren: »Der Nil ist bei Kairo angelangt.«6
Aus der Anerkennung, die er nun erfuhr, resultierte eine Nachfrage nach seinen früheren Werken, so daß neue Auflagen erforderlich wurden, für die Schopenhauer zahlreiche Stellen überarbeitete. So erschien 1854 die zweite Auflage der Abhandlungen Ueber den Willen in der Natur sowie Ueber das Sehn und die Farben. 1859 wurde die dritte Auflage des Hauptwerks Die Welt als Wille und Vorstellung veröffentlicht, 1860 die zweite von Die beiden Grundprobleme der Ethik. Nach der Publikation der Parerga und Paralipomena hatte Schopenhauer kein neues Werk mehr begonnen, sondern seine Arbeitskraft ganz auf die Abfassung der Neuauflagen der genannten Schriften verwendet.
Aufgrund seiner disziplinierten und gesunden Lebensweise, die reichliche Bewegung im Freien, regelmäßigen Schlaf sowie – bei geeignetem Wetter – Bäder im Main beinhaltete, erfreute sich Schopenhauer lange Zeit einer guten Gesundheit und wirkte auch in seinen letzten Lebensjahren ausgesprochen rüstig. Freilich befielen ihn im April 1860 erstmals Atemnot und Herzklopfen. Die Beschwerden traten in der Folgezeit erneut auf, so auch am 18. September, an dem er noch den Besuch seines Testamentsvollstreckers Gwinner empfing. Als in dem Gespräch die Rede auf den Tod kam, erklärte er seinem Gast gegenüber, wie dieser berichtete: »Daß seinen Leib nun bald die Würmer zernagen würden, sei ihm kein arger Gedanke: dagegen denke er mit Grauen daran, wie sein Geist unter den Händen der ›Philosophieprofessoren‹ zugerichtet werden würde.« (Gespr 394) Am Morgen des 21. September wurde Schopenhauer von seiner Haushälterin tot auf seinem Sofa vorgefunden. Ein Arzt gab als Todesursache einen »Lungenschlag« – in moderner Terminologie wohl eine Lungenembolie – an.
1 Johann Wolfgang v. Goethe. Gedichte. Vollständige Ausgabe. Stuttgart o. J., 467.
2 Arthur Hübscher. »Arthur Schopenhauer. Ein Lebensbild.« In: Arthur Schopenhauer. Sämtliche Werke. Bd. I. Hg. v. Arthur Hübscher. Mannheim 1988, 96.
3 Auf das Werk von Bichat stieß Schopenhauer freilich erst 1838.
4 Hübscher (1988), 101.
5 Hugo Busch. Das Testament Arthur Schopenhauers. Wiesbaden 1950, 67.
6 Hübscher (1988), 119.